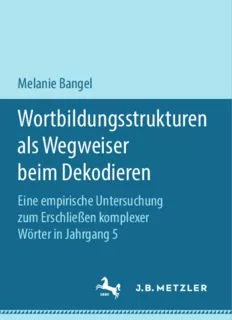Table Of ContentMelanie Bangel
Wortbildungsstrukturen
als Wegweiser
beim Dekodieren
Eine empirische Untersuchung
zum Erschließen komplexer
Wörter in Jahrgang 5
Wortbildungsstrukturen als Wegweiser
beim Dekodieren
Melanie Bangel
Wortbildungsstrukturen
als Wegweiser
beim Dekodieren
Eine empirische Untersuchung
zum Erschließen komplexer
Wörter in Jahrgang 5
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Astrid Müller
Melanie Bangel
Hamburg, Deutschland
Dissertation, Universität Hamburg, 2017
ISBN 978-3-658-20713-7 ISBN 978-3-658-20714-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-20714-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
J.B. Metzler
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
J.B. Metzler ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Geleitwort
Das Deutsche verfügt über eine Vielzahl an wortbildungsmorphologisch kom-
plexen Wörtern, die erheblich zum lexikalischen Ausbau beitragen und beson-
ders schriftsprachliche Texte prägen. Umso mehr muss verwundern, dass es für
das Deutsche kaum empirische Forschungen gibt, die sich damit beschäftigen,
wie Leser/-innen morphologisch komplexe Wörter des Deutschen verarbeiten.
Entsprechende didaktische Konsequenzen fehlen folglich ebenfalls fast gänzlich.
Diese Lücke will die vorliegende Studie schließen, indem sie die Zugriffs-
weisen von jüngeren Leserinnen und Lesern beim Dekodieren wortbildungsmor-
phologisch komplexer Wörter untersucht. Auf der Grundlage einer fundierten
theoretisch-empirischen Basis hat Melanie Bangel ein höchst innovatives Unter-
suchungsdesign entwickelt, das Einsicht in die kognitiven Prozesse von Schüle-
rinnen und Schülern beim Erschließen komplexer Wörter erlaubt. Dazu hat sie
ein zweischrittiges Erhebungsdesigns entwickelt: Den Fünftklässler/-innen wur-
den zum einen komplexe Wörter in Texten und zum anderen isoliert präsentiert,
im Anschluss wurden Gespräche mit ihnen dazu geführt, was das betreffende
Wort bedeuten mag und wie sie sich die Bedeutung erschlossen haben.
Die inhaltsanalytische Auswertung der Daten liefert beeindruckende Befun-
de: Trotz der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Zugriffe, die die Schüler/
-innen mehr oder weniger erfolgreich zur Bedeutungserschließung nutzen, zeigt
sich sehr deutlich, dass die morphologische Transparenz die Worterschließung
stark unterstützt, und zwar besonders dann, wenn die Leser/-innen diese, u.a. auf
der Basis morphologischer Bewusstheit und eines gut entwickelten Wortschat-
zes, zu nutzen verstehen. Die morphologische Analyse bildet eine überaus er-
folgreiche Dekodierstrategie der stärkeren Leser/-innen. Den Textkontext ziehen
sie heran, wenn die Wortbedeutung kontextspezifisch eingegrenzt werden muss.
Die Zugriffe der schwächeren Leser/-innen sind i.d.R. vielfältiger, diffuser und
weniger erfolgreich. Diese Daten sind für weiterführende didaktische Überle-
gungen hochrelevant, zeigen sie doch, wie wichtig sprachanalytisches Lernen,
das schriftstrukturelle und semantische Aspekte verbindet, vor allem im Hin-
blick auf die Entwicklung der Dekodierfähigkeit schwacher Leser/-innen, ist.
Prof. Dr. Astrid Müller
Hamburg, im Oktober 2017
Vorwort
Die ersten Ideen zu dieser Arbeit sind 2008 im Rahmen einer Unterrichtsbeglei-
tung in Jahrgang 6 entstanden. In dieser Klasse waren das Reflektieren und Spre-
chen über den Zusammenhang zwischen Struktur und Bedeutung von Wörtern
fester Bestandteil des Leseunterrichts. Dabei durfte ich mit Erstaunen beobach-
ten, wie sich die zum großen Teil lernschwächeren Schülerinnen und Schüler der
Bedeutung von Wörtern wie geistesgegenwärtig u. a. durch eine Analyse der
morphologischen Struktur genähert haben. Für diesen Einblick in den Unterricht
danke ich der (damaligen) Klasse 6b der Stadtteilschule Eichtalpark sowie der
Lehrerin Anja Issa.
Den Kontakt zu dieser Klasse hat meine Doktormutter Prof. Dr. Astrid
Müller hergestellt. Ihr gilt mein ganz besonderer Dank. Sie hat ihre Betreuungs-
aufgabe jederzeit sehr ernst genommen und mit großem persönlichen Einsatz
ausgefüllt. Ihre Begeisterung für Sprache und Sprachreflexion sowie ihre unter-
richtsnahen Forschungstätigkeiten waren für mich eine entscheidende Mo-
tivationsgrundlage für diese Arbeit. Neben den vielen konstruktiven Anregun-
gen, die sie mir für meine Arbeit gegeben hat, hat sie mir vor allem die Sinnhaf-
tigkeit der Tätigkeit als Deutschdidaktikerin immer wieder vor Augen geführt.
Ihr Einsatz in Forschung, universitärer Lehre und Lehrerbildung für das Voran-
treiben unterrichtlicher Konzepte, die ein widerspruchsfreies schriftsprachliches
Lernen ermöglichen, haben mir bei der Überwindung von Schreibkrisen gehol-
fen und mir den entscheidenen Antrieb gegeben, diesen Weg weiterzugehen.
Prof. Dr. Renata Szczepaniak möchte ich nicht nur für die Übernahme des
Zweitgutachtens danken, sondern vor allem auch für den interdisziplinären Aus-
tausch zwischen Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Ihre Offenheit für un-
terrichtliche Lehr-/Lernprozesse und ihre sprachwissenschaftliche Expertise wa-
ren und sind eine große Bereicherung für mich. Prof. Dr. Barbara Hänel-
Faulhaber hat die Prüfungskommission durch ihre Expertise im Bereich „Schrift-
spracherwerbsprozesse bei gehörlosen Schülerinnen und Schülern“ bereichert
und mich dazu veranlasst, meine Arbeit in einem größeren Kontext zu betrach-
ten. Vielen Dank dafür.
In meiner Kollegin Etje Schröder habe ich eine kompetente und aufmerksame
Gesprächspartnerin gefunden, die mein Interesse für schriftsprachliche Lernpro-
VIII Vorwort
zesse teilt und mir mit ihrem konstruktiv-kritischen Blick an vielen Stellen
wertvolle Hinweise gegeben hat. Mit Jochen Heins habe ich hilfreiche Diskussi-
onen zum forschungsmethodischen Vorgehen geführt. Beiden sowie Leena Eich-
ler und Tobias Stark möchte ich nicht nur für die vielen fachlichen Diskussionen
danken, sondern auch für das soziale Netzwerk, das erheblich dazu beigetragen
hat, (fast) jeden Tag mit Freude ins Büro zu gehen.
Ein besonderer Dank gilt auch den Schülerinnen und Schülern, die mir als In-
terviewpartner/-innen zur Verfügung gestanden haben und mir Einblicke in ihre
Denkprozesse beim Zugriff auf Wortbedeutungen gewährt haben.
Im Entstehungsprozess dieser Arbeit gab es natürlich viele weitere Men-
schen, mit denen ich anregende Diskussionen geführt habe und die diese Arbeit
auf irgendeine Art beeinflusst haben. Sie alle haben ein herzliches Dankeschön
verdient. Namentlich hervorheben möchte ich an dieser Stelle: Wiebke Bosholm,
Prof. Dr. Nanna Fuhrhop, Kristin Kaatz, Prof. Dr. Birgit Mesch und Dr. Ulrike
Sayatz.
Der letzte und wichtigste Dank gebührt meinen Freundinnen und Freunden
sowie meiner Familie, die mich stets in allem unterstützt und für den nötigen so-
zialen Ausgleich gesorgt haben. Ihr seid großartig.
Melanie Bangel
Hamburg, im Oktober 2017
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ......................................................................................................... 1
2 Wortbildungsstrukturen im Deutschen ......................................................... 7
2.1 Strukturelle und semantische Aspekte der Wortbildung ............................. 8
2.1.1 Morphologische Konstituentenkategorien ........................................... 9
2.1.2 Kompositionalitätsprinzip und morphosemantische Motiviertheit .... 15
2.2 Die Grundtypen der deutschen Wortbildung ............................................ 22
2.2.1 Komposition....................................................................................... 23
2.2.2 Derivation .......................................................................................... 28
2.2.2.1 Präfigierung ................................................................................. 28
2.2.2.2 Suffigierung ................................................................................ 30
2.2.3 Konversion ......................................................................................... 32
2.3 Morphologische Schreibungen ................................................................. 34
2.4 Komplexe Wörter in Texten ..................................................................... 38
2.5 Exkurs: Morphologische Strukturen im Türkischen ................................. 41
3 Kognitive und (psycho-)linguistische Aspekte des Lesens ......................... 43
3.1 Kognitionspsychologische Leseprozessmodelle ....................................... 44
3.2 Unterschiede zwischen schwächeren und stärkeren Leser/-innen ............ 48
3.3 Worterkennungsprozess ............................................................................ 50
3.3.1 Worterkennung bei komplexen Wörtern ............................................ 57
3.3.2 Zur Rolle der Schriftstruktur bei der Worterkennung ........................ 58
3.4 Lesekompetenz und Wortschatz ............................................................... 63
4 Morphologische Strukturen im Sprachlernprozess.................................... 67
4.1 Wortbildungsmorphologische Strukturen im mentalen Lexikon .............. 67
4.2 Einsicht in morphologische Strukturen als Teil von Sprachwissen .......... 71
4.2.1 Theoretische und empirische Modellierungen zum Sprachwissen .... 73
4.2.2 Morphologisches Wissen/morphologische Bewusstheit .................... 80
4.3 Verhältnis von morphologischer Bewusstheit, Wortschatz und Lesen ..... 82
4.3.1 Empirische Befunde ........................................................................... 83
4.3.2 Morpholog. Analyse im Kontext lesebezogener Wortschatzarbeit .... 87
4.3.3 Ein Blick in die Lehrwerke ................................................................ 93
X Inhaltsverzeichnis
5 Anlage der empirischen Untersuchung ....................................................... 97
5.1 Einbettung der Erhebung .......................................................................... 97
5.2 Forschungsdesign ................................................................................... 101
5.2.1 Ziele und Fragestellungen ................................................................ 103
5.2.2 Methodisches Vorgehen bei der Datenerhebung ............................. 105
5.2.2.1 Erhebung introspektiver Daten durch Verbalprotokolle ........... 105
5.2.2.2 Interviewablauf und -leitfaden .................................................. 107
5.2.2.3 Verortung im Bereich metakognitiver Verbalprotokolle ........... 112
5.2.3 Stichprobe und Inputmaterial ........................................................... 115
5.2.3.1 Zusammensetzung der Stichprobe ............................................ 115
5.2.3.2 Analyse des Inputmaterials ....................................................... 119
5.2.3.2.1 Textbezogene Auswahlentscheidungen und Analysen ....... 120
5.2.3.2.2 Wortbezogene Auswahlentscheidungen und Analysen ...... 130
5.2.4 Methodisches Vorgehen bei der Datenauswertung .......................... 155
5.2.4.1 Begründung für ein inhaltsanalytisches Vorgehen .................... 155
5.2.4.2 Analyseschritte der primären Datenauswertung ........................ 159
5.2.4.3 Analyseschritte der sekundären Datenauswertung .................... 164
6 Ergebnisse .................................................................................................... 169
6.1 Darstellung des Kategoriensystems ........................................................ 169
6.2 Ergebnisse der fallbezogenen Typenbildung .......................................... 193
6.2.1 Fallbezogene Typenbildung: 1. Setting (Wörter in Texten) ............. 193
6.2.2 Fallbezogene Typenbildung: 2. Setting (isoliert präs. Wörter) ........ 203
6.2.3 Settingübergreifende Auswertung der Typenbildung ...................... 212
6.3 Ergebnisse der wortbezogenen Analysen ............................................... 215
6.3.1 Wortbezogene Typenbildung: 1. Setting (Wörter in Texten) ........... 215
6.3.2 Wortbezogene Typenbildung: 2. Setting (isoliert präs. Wörter) ...... 226
6.4 Erschließung unbekannter Wörter .......................................................... 232
6.4.1 Worterschließungsstrategien: 1. Setting ........................................... 234
6.4.2 Worterschließungsstrategien: 2. Setting ........................................... 238
6.5 Vertiefende Einzelfallanalysen ............................................................... 241
6.5.1 Stärkere Leserinnen und Leser ......................................................... 243
6.5.1.1 Leon: „Und sonst hätte ich es wieder auseinandergetrennt“ ..... 243
6.5.1.2 Hülya: „Also es klingt halt so und deswegen habe ich so eine
Vermutung“ ............................................................................... 256
Inhaltsverzeichnis XI
6.5.2 Schwächere Leserinnen und Leser ................................................... 272
6.5.2.1 Dilara: „Bei manchen Wörtern fällt es mir einfach plötzlich
ein“ ............................................................................................ 272
6.5.2.2 Rafik: „Wenn man das dann zusammenmacht, dann weiß man
eigentlich schon, was das bedeutet“ .......................................... 290
6.6 Vertiefende wortbezogene Analysen ...................................................... 302
6.6.1 Erstes Setting (Wörter in Texten) .................................................... 303
6.6.1.1 Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Wortstruktur und
Bedeutung vor dem Hintergrund textbezogener Informationen
am Beispiel der Konversion gehüllt .......................................... 303
6.6.1.2 Zum Verhältnis der Orientierung am Kotext und an der
Wortbildungsstruktur am Beispiel des Derivats Leichtigkeit .... 311
6.6.2 Zweites Setting (isoliert präsentierte Wörter) .................................. 317
6.6.2.1 Zum Umgang mit morphologischen Schreibungen bei der
Bedeutungserschließung am Beispiel des Derivats Misserfolg . 317
6.6.2.2 Zum Umgang mit Präfixen bei der Bedeutungserschließung
am Beispiel des Derivats unermüdlich ...................................... 324
7 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse .................................. 335
8 Ausblick ........................................................................................................ 349
Literaturverzeichnis ....................................................................................... 353
Anhang ............................................................................................................. 371
Description:Melanie Bangel geht in dieser Studie der Frage nach, inwiefern stärkere und schwächere Leserinnen und Leser Einsicht in Wortbildungsstrukturen für die Bedeutungszuweisung beim Lesen nutzen. Dazu erhebt sie (retrospektive) metakognitive Verbalprotokolle mit Schülerinnen und Schülern in Jahrgang