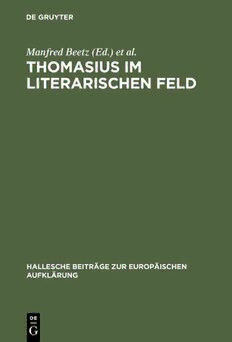Table Of ContentHallesche Beiträge
zur Europäischen Aufklärung 20
Schriftenreihe des Interdisziplinären Zentrums
für die Erforschung der Europäischen Aufklärung
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Thomasius
im literarischen Feld
Neue Beiträge zur Erforschung seines
Werkes im historischen Kontext
Herausgegeben von
Manfred Beetz und Herbert Jaumann
Max Niemeyer Verlag Tübingen
Wissenschaftlicher Beirat:
Karol Bai, Manfred Beetz, Jörn Garber, Notker Hammerstein, Hans-Hermann
Hartwich, Andreas Kleinert, Gabriela Lehmann-Carli, Klaus Luig, François
Moureau, Monika Neugebauer-Wölk, Alberto Postigliola, Paul Raabe,
Richard Saage, Gerhard Sauder, Jochen Schlobach, Heiner Schnelling, Jürgen
Stolzenberg, Udo Sträter, Heinz Thoma, Sabine Volk-Birke
Redaktion: Wilhelm Haefs, Hans-Joachim Kertscher
Satz: Kornelia Grün
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 3-484-81020-3 ISSN 0948-6070
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 2003
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni-
schen Systemen.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Printed in Germany.
Druck: Guide-Druck, Tübingen
Einband: Geiger, Ammerbuch
Inhalt
HERBERT JAUMANN: Thomasius im literarischen Feld. Einfuhrung 1
ERIC ACHERMANN: Substanz und Nichts. Überlegungen zu
Baltasar Gracián und Christian Thomasius 7
MANFRED BEETZ: Konversationskultur und Gesprächsregie in den
Monatsgesprächen 35
VOLKER KAPP: Barbon und Tartuffe. Thomasius
und die französische Literatur 61
KLAUS-GERT LUTTERBECK: Das decorum Thomasii als Faktor sozialer
Kohäsion oder: Systematische Strukturen im Denken eines Eklektikers .... 77
MARTIN MULSOW: Literarisches Feld und philosophisches Feld im
Thomasius-Kreis: Einsätze, Verschleierungen, Umbesetzungen 103
DIRK NIEFANGER: Über „Speisen" und „Artzeneyen". Ansätze einer
kulinarischen Literaturtheorie in der Lohenstein-Kritik von
Christian Thomasius 117
SANDRA POTT: „Le Bayle de Y Allemagne": Christian Thomasius und der
europäische Refuge. Konfessionstoleranz in der wechselseitigen
Rezeption für ein kritisches Bewahren der Tradition(en) 131
MERIO SCATTOLA / FRIEDRICH VOLLHARDT : .Historia litteraria',
Geschichte und Kritik. Das Projekt der Cautelen im literarischen Feld .... 159
VI
PETER SCHRÖDER: Laster und Tugend bei Bernard de Mandeville
(1670-1733) und Christian Thomasius (1655-1728) 187
WINFRIED SCHRÖDER: QUO ruitis? oder: Christian Thomasius
und die Risiken der Aufklärung 203
FRANK GRUNERT: Bibliographie der Thomasius-Literatur 1996-2001 221
Personenregister 233
HERBERT JAUMANN (Greifswald)
Thomasius im literarischen Feld. Einfuhrung
Die Erforschung von Leben und Werk des Christian Thomasius ist seit den 80er
Jahren wieder erfreulich in Gang gekommen. Ich erinnere nur an zwei gewichtige
Tagungsbände: Werner Schneiders (Hg.): Interpretationen zu Werk und Wirkung,
1989, und Friedrich Vollhardt (Hg.): Neue Forschungen im Kontext der Frühauf-
klärung, 1997. Sie hat sowohl an Intensität als auch an interdisziplinärer Vielsei-
tigkeit der Fragestellungen erheblich zugenommen, wie wir das im Einladungsex-
posé zu dieser Tagung dargestellt hatten, die im September 1998 in den Räumen
des Interdisziplinären Zentrums für die Erforschung der Europäischen Aufklärung
der Universität Halle-Wittenberg stattfand. In den beiden Forschungsbiblio-
graphien von Frank Grunert (in den genannten Bänden von 1989, 1997) kann man
diese eindrucksvollen Fortschritte ausfuhrlich dokumentiert finden, so wie das für
die ältere Forschung die 1955 erschienene und noch immer unverzichtbare Biblio-
graphie von Rolf Lieberwirth leistet. Wir haben Frank Grunert (Gießen) für die
Fortschreibung der Bibliographie zu danken, die er für den vorliegenden Band
zusammengestellt hat.
Dennoch hat sich die aktiver gewordene Forschung nicht allen, wohl auch nicht
allen zentralen Gegenstandsbereichen mit gleicher Intensität zugewandt. Manches
bleibt am Rande und im Schatten, und man kann der Forschung auch nicht be-
scheinigen, daß sie sich besonders intensiv Gedanken über die Relevanz und die
Reichweite ihrer jeweils leitenden Fragestellungen und Zurechnungsbegriffe ge-
macht hätte. Zum Beispiel fehlt eine gründliche und grundsätzliche Überprüfung
der immer mit so unerschütterlicher Selbstverständlichkeit vorgenommenen Zu-
rechnung des Thomasius zur Frühaufklärung.1
Der von Vollhardt herausgegebene Band bildet trotz seines Titels davon eigent-
lich eine Ausnahme, weil dort diese Frage vom Herausgeber durchaus reflektiert
und der Kontext Frühaufklärung deshalb auch als eine bewußt selektive Zurech-
nung gewählt wird, und dagegen ist im Prinzip natürlich nichts zu sagen. Es han-
delt sich dabei gerade nicht um die Fortschreibung eines Zurechnungsmonopols,
dessen Folgen eigentlich dem heute angeblich geschärften Blick für wissenschafts-
geschichtliche Zusammenhänge nicht entgehen sollten: Sie liegen in erster Linie in
dem Zwang, alles unter den einzelnen (mehr oder weniger präzisen) Vorgaben und
Blickrichtungen zu sortieren, zu interpretieren und auch zu bewerten, die eine Ka-
tegorie wie die der ,Frühaufklärung' und das unermüdlich reproduzierte Klischee
Dazu jetzt auch kritisch Herbert Jaumann, Art. Thomasius, Christian, in: Theologische
Realenzyklopädie (TRE), Bd. 33 (2001), S. 483^87.
2 Herbert Jaumann
von Thomasius als dem ,Vater der deutschen Aufklärung' erzwingen. Die Herr-
schaft solcher Klischees reizen zu provokanten Fragen, und diesem Reiz sollte
gelegentlich auch nachgegeben werden. Überhaupt gehört ein kritisch-reflektieren-
der Forschungsbericht, der etwas ganz anderes sein müßte als eine erzählte Bi-
bliographie, zu den dringenden Desideraten der Thomasius-Forschung.2
Im Mittelpunkt dieses Bandes steht das Verhältnis von Thomasius zu Literatur
und Poesie in einem weiten Sinn, der den Literaturbegriff seiner Zeit angemessen
berücksichtigt. Die damit aufgeworfenen, bisher sonderbar unterbelichteten Fragen
gaben auch den Anstoß zu der Tagung in Halle. Sonderbar ist diese Vernachlässi-
gung auch deshalb zu nennen, weil gerade diese Interessen und Aktivitäten, wie sie
nicht nur in den Monatsgesprächen dokumentiert sind, Thomasius zu einem hoch-
geachteten Autor und Kritiker gerade auch in der germanistischen Literaturge-
schichte gemacht haben, jedoch eben mit wenig substanziellen Folgen fur unsere
genaue Kenntnis dieses Verhältnisses. Ich sehe die Gefahr, daß sich für Christian
Thomasius (geb. 1655) in der Literaturgeschichte die Rolle des allseits geachteten
Pioniers weiter einspielt, dessen Name gewohnheitsmäßig en passant lobend er-
wähnt wird, ehe man sich ausführlich Gottsched, wenn nicht ohnehin lieber Les-
sing zuwendet. Eine ähnliche Rolle spielt ja der gut zehn Jahre ältere Christian
Weise (geb. 1642), nur mit dem Unterschied, daß in diesem Fall wenigstens die
Spezialliteratur, auch diejenige der letzten Jahrzehnte, über sein literarisches Werk
und dessen Rezeption bei weitem ergiebiger ausfallt.3
Einige der Beiträge haben in unterschiedlichem Grad und in verschiedener
Weise Bourdieus Begriff des literarischen Felds herangezogen. Dabei war es kei-
nesfalls die Absicht der Tagung, die Untersuchung über Thomasius und die Lite-
ratur als Thema oder als Stichwort für eine empirisch-historische Fallstudie zu
benutzen, etwa um bestimmte Leistungen oder Probleme der Bourdieuschen Feld-
theorie selbst zu exemplifizieren, zu erproben oder .durchzuspielen'. Erstens liegt
mir eine solche Art der anachronistischen Verwendung von Theorien in histori-
schen Untersuchungen, bei der die historischen Gegenstände zu beliebigem .Mate-
rial' erklärt werden, das dann irgendwelchen modernen Konzepten subsumiert
wird, prinzipiell fern. Theorien sollen vielmehr eine analytische Blickrichtung auf
den Gegenstand explizit machen und diesen überhaupt erst in bestimmter Weise
konstituieren. Sie sollen auf diese Weise dabei helfen, latente Bedeutungen und
Strukturen der Sache sichtbar, analysierbar zu machen, Anschlußmöglichkeiten
aufzuzeigen und Anschlüsse herzustellen, also landläufig Getrenntes zusammenzu-
2 Ein Forschungsbericht ist leider auch nicht enthalten in: Schröder, Peter, Christian Thomasius
zur Einfiihrung. Hamburg 1999 (Zur Einführung. Bd. 197).
3 Ich nenne nur die Studien von Baraer, Wilfried, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren ge-
schichtlichen Grundlagen. Tübingen 1970 (insb. Teil II, Kap. 3); Beetz, Manfred, Rhetorische
Logik. Prämissen der deutschen Lyrik im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert. Tübingen
1980; Zeller, Konradin, Pädagogik und Drama. Untersuchungen zur Schulcomödie Christian
Weises. Tübingen 1980.
Einfìihrung 3
bringen. Zweitens gibt es sehr wohl eine Reihe von Gründen, aus denen man der
Kultursoziologie Bourdieus insgesamt sehr reserviert gegenüberstehen kann: ihrem
inhärenten Ökonomismus und Utilitarismus etwa, zu dem sich ein gewaltiger
Unterschied zu der im prinzipiellen Strukturfunktionalismus auch verwandten
Systemtheorie Luhmanns erkennen läßt.4 Drittens, und vor allem, war an den Feld-
Begriff in erster Linie im Sinne eines heuristisch nützlichen Fragehorizonts oder
Fragerasters gedacht - was natürlich keinen der Autoren der Beiträge im mindesten
daran hindern sollte, bei der Applikation Bourdieus auf die für Thomasius und
seine Kontexte geltenden Sachverhalte darin auch viel weiter zu gehen. Dazu nur
einen Hinweis auf wenigstens zwei Punkte.
Die Rezeption der FeW-Theorie Bourdieus ist in der Literaturwissenschaft hier-
zulande seit den 90er Jahren durch gegenläufige Tendenzen wie die programmati-
sche Verabschiedung der ,Sozialgeschichte' gehemmt und weitgehend auch blo-
ckiert. Die dabei ausgegebenen Parolen (,linguistic turn', ,Dekonstruktion') speku-
lieren allesamt mit der falschen Alternative zwischen ,Sozialgeschichte' oder
.Textanalyse', und die Beliebtheit der letzteren läßt sich in den meisten Fällen
einfach daraus erklären, daß dem Interpreten in Aussicht gestellt wird, der müh-
same Erwerb historischen Wissens werde ihm erlassen. Wenn sich der modische
Nebel der Konjunktur dieser Art Studienreform gelichtet hat, wird man sich dem
Theorieangebot Bourdieus mit weniger Vorurteilen neu zuwenden können. Den-
noch hat es auch in den vergangenen Jahren eine Kontinuität der Diskussion um
Bourdieus Theorie und deren erste Erprobungen seit den 80er Jahren gegeben.5
Aus ihr ergibt sich meines Erachtens, daß die Gefahr einer bloß metaphorischen
Verwendung des Feld-Begriffs - statt eines theoretischen Konstrukts - besondere
Aufmerksamkeit beansprucht. Ein zweiter Brennpunkt der Probleme scheint mir
darin zu liegen, daß bei allem erklärten Interesse Bourdieus an historischen Prozes-
sen in seinem hier interessierenden Hauptwerk von 1992: Les règles de l'art. Ge-
nèse et structure du champ littéraire,6 die logique du champ littéraire {intellectuel)
eigentlich erst in der späteren Neuzeit, nach den Studien von Bourdieu selbst und
seinen Schülern in Frankreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts, wirklich ,greift'.
Eine gute Einfuhrung in die Theorie Bourdieus vor allem unter Aspekten der
Geschichtswissenschaft und Soziologie jetzt bei Flaig, Egon, Pierre Bourdieu: Entwurf einer
Theorie der Praxis (1972). In: Erhart, Walter / Jaumann, Herbert (Hg.), Jahrhundertbücher.
Große Theorien von Freud bis Luhmann. München 2000, S. 358-382. Dort auch weitere
neuere Literatur.
5 Vgl. unter den im Anschluß an diese Einfìihrung beigefugten Titeln und Autoren: Alain Viala
(1993) als einer der literarhistorisch produktivsten ,Schüler', Joseph Jurt (1995) mit einer sehr
erfolgreichen Einfuhrung und Markus Schwingel (1995) mit einer Darstellung mehr unter
Aspekten der Sozialtheorie, Ökonomie und Politik.
6 Die deutsche Ausgabe in der Übersetzung von Bernd Schwibs und Achim Russer unter dem
Titel: Bourdieu, Pierre, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes.
Frankfurt/M. 1999. Dazu auch die Beiträge von und über Bourdieu in dem Band Streifzüge
durch das literarische Feld, hg. von Louis Pinto und Franz Schultheis (1997).