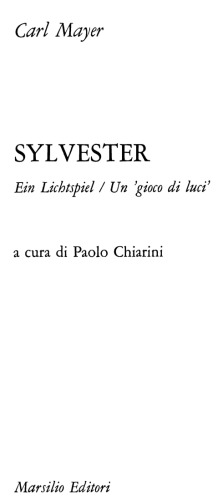Table Of ContentCarl Mayer
SYLVESTER
Ein Lichtspiel/ Un 'gioco di luci'
a cura di Paolo Chiarini
Marsilio Editori
I edizione 1924
© Copyright 1924 by Gustav Kiepenheuer Verlag A.G.,
Potsdam.
I edizione italiana agosto 196 7
Traduzione di Vanda Perretta
PUBBLICATO DALLA MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA CON LA
COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA
NA PER LE RICERCHE DI STORIA DEL CINEMA
Proprieta letteraria riservata
© Copyright 1967 by Marsilio Editori
Stampa delta Stamperia di Venezia
INDICE
VIII Enleitung des Herausgebers
IX Introduzione dell'editore
XVIII Vorwort des Regisseurs
XIX Prefazione del regista
XXIV Technische Vorbemerkungen des Autors
XXV Avvertenze tecniche dell'autore
XXVIII Personen
XXIX Personaggi e interpreti
1 Sylvester. Ein Lichtspiel / Un 'gioco di luci'
171 Appendice
173 Vanina
177 Der letzte Mann
183 Nota del curatore
189 Illustrazioni
EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS
Film als Industrie - Film als Technik - Film als
Kunst (Lehrmittel, Unterhaltung): die drei Formen, in
denen sich die neue Erscheinung „Film" ausdrückt, zugleich
auch die drei Entwicklungsprozesse, denen sie unterworfen
ist. Es liegt in der Natur des Films und seines Zeitalters,
dass sein inneres, sein künstlerisches Wachstum hinter der
Frühreife seiner rapiden technischen und industriellen Ent
wicklung weit zurückblieb, wozu die ständige Verwechslung
und Vermengung der drei artverschiedenen Kriterien nicht
wenig beitrug. Ja, dem noch Unfertigen wurde - gerade
angesichts seiner weiten Natur, die bald der äusseren Sensa
tion, bald der eindeutigen, bald der zweideutigen „Aufk lä
rung", bald der zusammenhanglosen Bewegungskomik zu
neigte - von ahnungslosen Freunden ebenso wie von
beschränkten Feinden die Möglichkeit künstlerischer Ent
wicklung überhaupt abgesprochen!
Die Industrie, anfangs eine Kolonie kühner Lander
oberer, gemengt mit zweifelhaften Abenteurern, tüchtig,
aber traditionslos, mit allen Eigenschaften einer überraschen
Karriere begabt, tat - mit wenigen Ausnahmen - von sich
aus alles, diese Verwirrung zu erhöhen. Während sich die
Phantasievolleren unter den Künstlern bemühten, dem Film
aus seinen Bedingungen und seinem Material heraus zu orga
nischen Gestaltungen zu verhelfen, verteidigte der Grossteil
der deutschen Industrie den technisch-industriellen Film
Herstellungsprozess gegen dessen eigentliche Vorausse{zung,
die sie nicht kannten: den künstlerischen Film-Herstellungs
prozess, den sie nicht anerkannten. Erst als W egener und
Lubitsch - jener in Stoff und Stil, dieser in Ausdruck und
Sylvester VIII
Einfall - längst Bahn gebrochen hatten, als die Branche
,,Verpflichtungen" fühlte, rief man allgemein nach "Kunst".
Da man instinktlos war gegenüber dem eigenen Material,
angelte man nach Abgestempeltem in der Runde. Man griff
nach "hochliterarischen" Stoffen, von deren Kredit das
daraus zurechtgebogene, unfilmische Machwerk leben sollte
(es ist im allgemeinen schwerer, ein Wortkunstwerk ins
Filmische umzukomponieren, als ein künstlerisches Film
werk frei zu erfinden). Da man nie die Idee, immer nur
deren Klischee auffing, fiel man auf jede oberflächliche Parole
herein. Da man die souveräne Fähigkeit entbehrte, aus dem
Gestus und Körperakzent eines Menschen, aus der Sug
gestionskraft seiner gesprochenen Bildvorstellungen, aus sei
nem angewandten Effektinstinkt, kurz: aus seiner Persön
lichkeit die spezifische Filmbegabung zu erfühlen 1, tastete
man willkürlich unter Modeliteraten, Zeitklassikern, Theater
professoren herum, nur um nach dem selbstverständlichen
Misserfolg dieser Ausflüge ins angeblich "Künstlerische"
sogleich wieder den "Publikumsfilm" gegen den doch von
niemandem verfochtenen ,}iterarischen Film" auszuspielen!
Genügen nicht schon diese von Missverständnis geschwolle
nen Bezeichnungen? Als ob nicht jede Qualität im Film
nur dem Filmischen entspränge! Als ob nicht der gelungene
Film, wie jedes gelungene Schau-Spiel, seinen äusseren und
seinen inneren Sinn und Effekt gleichzeitig auswirken
müsste! Als ob nicht Ethik, Kunst und Erfolg in der Vol
lendung sich stets die Hände reichten! Als ob nicht das
Tiefe, gut gemacht und gut gebracht, über das ebenso wir
kungsvolle Plache letzten Endes siegen müsste, schon mit
dem Vorsprung seiner Leidenschaft! 0\7e s halb allein es sich
- trotz allem - immer noch zu arbeiten lohnt.).
Der höhere Typ des Regisseurs, der den künstlerischen
Produktionsprozess des Autors in sich wiederholt und
1 die im Gipfel/all eine kombinierte Manuskript-, Regie-, Schauspieler
und Organisationsbegabung sein wird. - Mit demselben Recht, mit
dem man den Schauspieler "vorsprechen" lässt, müsste ein künstleri
scher Filmleiter den Regie-Aspiranten sich „vorinszenieren" lassen.
Dieser wird, sofern er wirklich Regie im Blut hat, mit Sprache,
Bewegung oder Ausdruck eine spontan geschaffene Bilderwelt eines
geplanten oder aufgegebenen Stoffes im Direktionszimmer in Takt
und Tempo erstehen lassen.
Sylvester X
umsetzt, um ihn mit dem technisch-industriellen in Einklang
zu bringen, blieb lange vereinzelt; sein höchster Typ, in dem
Autor, Regisseur, Techniker und Organisator zu schöpfe
rischer Einheit verschmelzen, ist heute erst in Ansätzen
sichtbar: In den Kämpfen, die sich zwischen Manuskript
einerseits, Regie und Industrie andererseits entwickelten,
unterlag - der Film. Da auch das Manuskript einer
"Technik" bedurfte, die sich äusserlich als Kenntnis des
Ateliers und als Publikumsroutine kennzeichnete, hüllte man
sich gerade dem höheren Autor gegenüber in die Mysterien
des Faches und veschloss ihm nach Möglichkeit das Atelier.
Der Regisseur strich und verbesserte Szenen, die Diva
diktierte neue hinein, das "dramaturgische Büro" lieferte
"Titel" und die Direktion "milderte" den Rest. Den höhe
ren Bedürfnissen wurde Rechnung getragen, indem man
ausser dem Hause "originelle Ideen" suchte, diese aber im
Hause möglichst banal verarbeiten liess; dabei klagte man
über "Mangel an Manuskripten", da man zwischen Mangel
an Film-Routine, die sich lernen lässt, und Mangel an Film
Sinn, Film-Phantasie, Film-Komposition, die sich nicht
lernen lassen, nicht zu unterscheiden vermochte. Am sicher
sten blieb man bei der Inzucht: Filmautor und Filmregisseur
konnte im allgemeinen nur werden, wer Filmautor und Film
regisseur schon gewesen war.
Man missverstehe nicht: es gab natürlich immer und
gibt insbesondere heute ein paar Stellen in Deutschland, an
denen mit höheren Ansprüchen und unter höheren Aspekten
wesentliche Arbeit geleistet wurde und wird, aber nicht
Ausnahmebetriebe und Spitzenpersönlichkeiten, sondern die
künstlerische und vor allem psychologische Gesamtsituation
der Industrie mussten Tempo und \Vachstum der inneren
Filmentwicklung bestimmen.
Zur Förderung dieser inneren Filmentwicklung, zur
Klärung der Begriffe und allseitigen Interessen unternahm
es der Herausgeber 1, den künstlerischen Produktionsprozess
dort, wo er noch ungetrübt zu fassen ist: im bisher verbor-
2 ungeachtet seiner unveränderten Überzeugung, die den künstlerischen
Filmtyp der Zukunft im dramaturgisch und dichterisch organisierten
Regisseur sieht (Siehe Berl. Börs.-Courier v. 11. VIII. 21).
Sylvester XII
genen Man u s k r i p t, dem Verständnis des Publikums,
der Kontrolle der Kritik zu erschliessen. Es wurde als erstes
das Werk eines schon anerkannten Autors gewählt, um
dem ohnehin neuartigen V ersuch den Charakter des „Expe
rimentes" wenigstens nach dieser Richtung hin zu nehmen
(womit an den Wunsch, diese Sammlung einmal vielleicht
als Mittler zwischen unbekannten Autoren und Industrie
einsetzen zu können, nicht gerührt sein sollte). Die gleich
zeitige Herstellung des Films durch ein künstlerisch be
mühtes Unternehmen ermöglicht es, das Verhältnis der ,
verschiedenen Produktionsprozesse zueinander zu beobach
ten, die sichtbaren Arbeiten des Autors auf der einen Seite,
des Regisseurs, Photographen, Architekten auf der anderen
Seite gegeneinander abzugrenzen.
Der Herausgeber wandte sich an Carl Mayer, weil
dieser Autor fast als einziger unter den deutschen Film
künstlern vom Manuskript aus Filmstil geschaffen hat.
Sylvester war niemals zur gedruckten Veröffentlichung
bestimmt, das Manuskript lag fast fertig vor, als der Buch
vorschlag erfolgte. Nicht w e i l, sondern o b wo h l Carl
Mayer seine Manuskripte in einem ungewöhnlichen, höchst
persönlichen Wort- und Satzstil schreibt, musste die Wahl
auf ihn fallen; denn es wäre formal näher gelegen, diese
Sammlung mit einem Drehbuch zu eröffnen, das in der Form
in nichts sich von der üblichen unterschied, schon um das
Missverständnis zu vermeiden, als ob etwa jedes Filmmanu
skript in ähnlichem Bau und Rhythmus gearbeitet sein
müsste! Doch Aufgabe und Sinn eines Filmbuches kann
es einzig und allein sein, die in Bildern ersonnene Handlung
mitsamt ihrer Atmosphäre und allen Kompositionsdetails
auf Spielleiter, Architekten und Schauspieler durch das
Mittel des Wortes präzisest zu übertragen - durch alle
Mittel des Wortes, wenn irgend sie nur dem Verstand, dem
Gefühl, der Phantasie sich mitzuteilen vermögen. Wenn
hierzu die grosse Mehrzahl eine deskriptive, sachlich be
richtende Sprache wählt, wenn andere versuchen, ihre Ge
sichte malerisch impressionistisch zu übertragen, so unter
nimmt es Carl Mayer, durch Ablauf und Rhythmus seiner
Sätze selbst, durch Cäsuren, Artikulationen und Tempi,
Sylvester XIV
durch das wechselnde Mienenspiel seiner Sprache gleichsam,
die gewollten Wirkungen unmittelbar und unwillkürlich
hervorzurufen, wobei selbst die technischen Angaben in den
Strom einbezagen werden. Nichts wäre verfehlter, als diese
Sprache, die hier in doppeltem Sinne nur „Mittel", nur ein
Glied in der Kette von der Vision des Bilddichters bis zum
abrollenden Bildstreifen darstellt, sprachkritisch oder gar
schulmeisterlich abzutasten; Carl Mayers Sprachstil, den sich
nur beileibe niemand zum „Muster" zu nehmen versuche,
wäre schon durch Carl Mayers auf der Leinwand erschienene
Filme, schon durch seine Scherben allein vollauf bestätigt,
selbst wenn sich nicht - über den ursprünglichen Zweck
hinaus - an vielen Stellen eine selbständige, originale, bal
ladesk-dichterische Wirkung schon aus der Lektüre ergäbe.
Was die Wahl des Lichtspiels Sylvester speziell anlangt,
so soll mit dieser Publikation keineswegs dem Werturteil
über das Manuskript oder gar über dessen Inszenierung und
Darstellung vorgegriffen werden. Doch darf hier erwähnt
werden, was dem Herausgeber in dramaturgischer Hinsicht
bemerkenswert schien: dass der Konflikt dieses Lichtspiels
nicht, wie gewohnt, aus einer Leidenschaft oder einer Intri
gue, sondern aus einer fast passiven Zuständlichkeit, grund
los, fast anlasslos aus dem scheinbaren Nichts erwächst;
dass ferner hier vielleicht zum erstenmal die vielfältige Um
welt eines einfachen Geschehens nicht als Gegen- oder
Neben -Handlung, sondern als Gegen- und Neben -
Rhythmus, als An-, Mit- und Abklang, als verstär
kendes, sinngebendes und erweiterndes Symbol eingeführt
wird, bis zu solchem Masse, dass an entscheidender Stelle
die Handlungsspannung abbricht und - gleichsam unterir
disch - handlungslos durch die Steigerung der unbeteiligten
Umwelt bis zur Wiederaufnahme der Handlung weiterge
leitet wird.
Aus dem völlig neuen Charakter der Publikation, aber
auch aus dem rhythmisch abgesetzten Stil des Autors ergab
sich eine Reihe von Problemen buch- und satztechnischer
Art, die nach mancherlei Versuchen - hoffentlich zur Zu
friedenheit auch der Leser - gelöst wurden.
ERNST ANGEL
Sylvester XVI
VORWORT DES REGISSEURS
Ein Novum dieses Buch. Ein Novum das Vorwort des
Regisseurs. Beides ist für das Publikum, nicht für die Leute
vom Fach bestimmt. Es kann sich also in diesen knappen
Zeilen nicht um einen Beitrag zu dem Thema „Wie steht
der Filmregisseur zu seinem Manuskript" handeln.
Im Untertitel nennt Carl Mayer Sylvester „ein Licht
spiel". Es wird ihm nicht nur daran gelegen haben, durch
diesen Untertitel auf den rein technischen Vorgang des
Wechsels, der Bewegungen von Lichtern, hinzuweisen. Er
wird wohl auch das Hell und Dunkel im Menschen selbst,
in seiner Seele haben aufzeigen wollen. Den ewigen Wechsel
von Licht und Schatten in den seelischen Beziehungen der
Menschen zueinander. So wenigstens wirkte der Untertitel
auf mich. Ich war, als ich das Manuskript las, ergriffen
von der Ewigkeit der Motive. Und ich wollte die Empfin
dungen, die ich beim Lesen hatte, auf den Zuschauer
übertragen. Inwieweit dies gelungen ist, steht mir zu beurtei
len nicht zu. Aber im Verlaufe der Herstellungszeit des
Films öffneten sich immer mehr Ausblicke, erkannte ich
immer mehr, dass hier ein Stoff, der ewig ist und weit ist
wie die Welt - im Manuskript wenigstens - meisterhaft
eingefangen ist in das Geschehen einer einzigen Stunde.
Einer Stunde, die seltsamerweise entgegen ihrer sinngemäs
sen Bestimmung von der Menschheit weniger dazu benutzt
wird, um über sich nachzudenken, als um sinnlos zu jubeln. -
Zu diesem Buche selbst: Es erfüllt - nach meiner
Ansicht - schon deswegen die Vorbedingung eines Film
manuskriptes, weil es - bei der Lektüre - nicht nur rein
optisch Vorstellungsreihen vermittelt. Es löst in stärkerem
Sylvester XVIII
Masse noch rein gefühlsmässig Empfindungen aus, die uns
alle bewegen. Indem man also die drei Menschen in ihrem
engen Bezirk sich seelisch zerfleischen s i e h t, f ü h l t man
mit jedem Einzelnen den Schmerz, dass er in Wahrheit gut
zu dem anderen sein möchte - und es doch nicht vermag.
Indem man das Prosten, Jubeln und Feiern der Umwelt
s i e h t, fü h lt man, wie sehr alle diese Menschen anei
nander vorbeirennen, jagen, irren. Fühlt man mit einem
Wort den Fluch, der auf der Menschheit lastet: Beschaffen
zu sein wie ein Tier und denken zu können - wie eben ein
Mensch. Notabene, wenn man fühlen will und nicht nur
sehen.
Die oft skandiert klingende Sprache des Manuskripts
vermittelt nach meiner Erfahrung am besten allen Mitwir
kenden die Vorstellung des unmittelbaren Ablaufs des
Geschehens. In diesem Sinne ist also jedes ,,Jetzt" - oder
„Und" von Bedeutung, weil durch diese Einschaltungen
das jeweilig gewollte „Tempo des Spiels" fühlbar wird,
ähnlich wie bei dem gedruckten Notenblatt durch die ver
schiedensten Bezeichnungen oder Vorzeichen, Fermaten
usw .... Die neuartigen Bildbewegungen wie - „Vor und
zurück" oder „seitwärts" usw. sind bedeutungsvoll und
untrennbar von diesem Manuskript. Sollte der Film an und
für sich schon seinem Wesen nach nur b e w e g t e s B i l d
sein, so ist hier die Anregung des Autors um so bemerkens
werter (im Sinne neuer Möglichkeiten), als dadurch die
Vision ausgelöst wird, dass die Umwelt den engen Schau
platz des Geschehens gleichsam umfiiesst ... Wie das Meer
eine Insel ...
Neuartig erscheint mir die Komposition des Lichtspiels
auch deswegen, weil sie das Geschehen selbst im engsten
Rahmen hält, der Umwelt aber eine bedeutende, ja beinahe
die Hauptrolle im Rahmen des Ganzen zuteilt, ohne diese
Umwelt - was banal wäre - mit der Handlung selbst zu
verquicken. Deswegen auch glaubte ich die Umwelt von epi
sodischen Einzelheiten möglichst freihalten zu sollen. Sie
soll in gewolltem Sinne wirken einfach dadurch, dass sie da
ist. Nicht dadurch, dass sie etwa „zurechtgemacht für ihren
Zweck" gezeigt wird. Sie soll den sinfonischen Unter- und
Sylvester XX