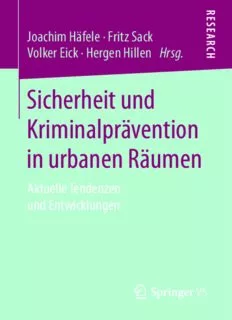Table Of ContentJoachim Häfele · Fritz Sack
Volker Eick · Hergen Hillen Hrsg.
Sicherheit und
Kriminalprävention
in urbanen Räumen
Aktuelle Tendenzen
und Entwicklungen
Sicherheit und Kriminalprävention in
urbanen Räumen
Joachim Häfele · Fritz Sack
Volker Eick · Hergen Hillen
(Hrsg.)
Sicherheit und
Kriminalprävention
in urbanen Räumen
Aktuelle Tendenzen
und Entwicklungen
Herausgeber
Joachim Häfele Volker Eick
Hamburg, Deutschland Berlin, Deutschland
Fritz Sack Hergen Hillen
Berlin, Deutschland Hamburg, Deutschland
Gefördert durch die „Stiftung Lebendige Stadt“
ISBN 978-3-658-16314-3 ISBN 978-3-658-16315-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-16315-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
(cid:1)
Inhaltsverzeichnis
Sicherheit und Kriminalprävention in urbanen Räumen – Eine
Einführung in den Band.........................................................................................7
Joachim Häfele
Die (europäische) Stadt auf dem Weg zum Nicht-Ort?.......................................13
Aldo Legnaro
„Vorbild New York“ und „Broken Windows“: Ideologien zur
Legitimation der Kriminalisierung der Armen im Namen der
Sicherheit in der unternehmerischen Stadt...........................................................29
Bernd Belina
„Open City“ – From „Eyes on the Street“ to „Zero Tolerance“.
Jane Jacobs’ Visionen einer sichereren Stadt......................................................47
Dirk Schubert
Meines Bruders Hüter? ›Community‹ herstellen, das Urbane ordnen.................69
Andrew Wallace
Pazifizierungsagenten. Zu einem Tätigkeitsprofil kommerzieller
Sicherheitsdienste.................................................................................................91
Kendra Briken, Volker Eick
Sicherheit schaffen und die Angst vor dem Anderen in
Rinkeby, Schweden............................................................................................109
Ann Rodenstedt
Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen oder: Vom Umgang
mit urbanen Vergnügungen und mit Risiken des Lebens..................................129
Monika Litscher
Normen für eine städtebauliche Kriminalprävention in Europa?......................151
Günter Stummvoll
Modernisierungsängste, lokale Verwerfungen und die Furcht
vor dem Verbrechen. Beobachtungen aus Hamburg.........................................169
Helmut Hirtenlehner, Klaus Sessar
Disorder, (Un-)Sicherheit, (In-)Toleranz...........................................................193
Joachim Häfele
6 (cid:11)(cid:16)(cid:10)(cid:2)(cid:14)(cid:22)(cid:21)(cid:25)(cid:7)(cid:20)(cid:28)(cid:7)(cid:11)(cid:5)(cid:10)(cid:16)(cid:11)(cid:21)(cid:1)
Hausaufgaben und Schularbeiten: Kriminalpräventive
Polizeibearbeitung von Kindern und Jugendlichen...........................................223
Volker Eick
Vom Tauscher zum Getäuschten: Unsicherheiten im urbanen Alltag
von Konsumgesellschaften................................................................................241
Ingrid Breckner
Zur impliziten Erzeugungsgrammatik dieses Bandes:
Einige abschließende Überlegungen..................................................................255
Fritz Sack
(cid:1)
Sicherheit und Kriminalprävention in urbanen
Räumen – Eine Einführung in den Band
Joachim Häfele
Sicherheit und Kriminalprävention sind längst zu zentralen handlungsleitenden
Begriffen europäischer Stadtpolitik und Stadtplanung geworden. Ohne an dieser
Stelle eine genauere Begriffsbestimmung vornehmen zu können, lässt sich fest-
halten, dass inzwischen eine Vielzahl öffentlicher und privater Akteure existie-
ren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kriminalität – oder das, was sie
dafür halten – zu verhindern und das häufig als bedroht betrachtete subjektive
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern. So dehnbar der Begriff „sub-
jektive Sicherheit“ auch sein mag (etwa ökonomische und/oder soziale Sicher-
heit); im Vordergrund steht hier die Furcht vor (Gewalt-)Kriminalität. Ausgelöst
vor allem durch die Broken Windows-Idee und 1982 von James Q. Wilson und
George W. Kelling in der konservativen Monatszeitschrift The Atlantic formu-
liert, werden dabei auf politisch-medialer sowie wissenschaftlicher Ebene zu-
nehmend strafrechtlich nicht oder kaum relevante (abweichende) Handlungen im
öffentlichen Raum (personifiziert z. B. in Bettelnden, Obdachlosen, Drogenkon-
sumierenden, männlichen Migranten) und physisch-materielle Substrate (z. B.
Müll oder verwahrloste Grünflächen) als zentrale unabhängige Variablen zur
Erklärung kriminalitätsbezogener (Un-)Sicherheitsgefühle betrachtet.
Allein die Thematisierung solcher urbaner Disorder-Phänomene, häufig
nichts anderes als sichtbare Erscheinungsformen von Armut, als Auslöser von
Kriminalitätsfurcht und Kriminalität haben die Debatten um den Verlust der
„inneren Sicherheit“ seit Anfang der 1990er Jahre vielerorts verstärkt. Deutlich
zeigt sich dabei die kriminalpolitische Tendenz, bestimmte Personengruppen wie
Bettler, Obdachlose oder Jugendliche als Problem der „inneren Sicherheit“ zu
betrachten, um entsprechende Maßnahmen zu ihrer Verdrängung zu legitimieren.
Solche Maßnahmen reihen sich in eine neue neoliberale Kontrolllogik ein, die
basierend auf der Grundlage des Begriffspaares Sicherheit und Unsicherheit die
freie Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Räume zugunsten eines selektiven Vor-
gehens gegen bestimmte Menschen oder Personengruppen immer stärker ein-
schränkt und reglementiert. Maßnahmen im Sinne von „Zero-Tolerance“ er-
scheinen so als einzig legitime Handlungsalternative, während (wohl-
fahrts-)staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der städtischen Armut immer
stärker in den Hintergrund geraten.
Diese Entwicklung ist umso problematischer, als der Bedarf nach Toleran-
zen zwischen Individuen, sozialen Gruppen und unterschiedlichen Institutionen
in zeitgenössischen Großstädten umso dringlicher geworden ist, je mehr die
Ausdifferenzierung von Lebensstilen, die soziale Spaltung und die Migration
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
J. Häfele et al. (Hrsg.), Sicherheit und Kriminalprävention
in urbanen Räumen, DOI 10.1007/978-3-658-16315-0_1
8 (cid:12)(cid:17)(cid:2)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:15)(cid:1)(cid:10)(cid:3)(cid:8)(cid:7)(cid:14)(cid:7)(cid:1)
von Menschen aus ‚fremden’ Kulturen gerade in den urbanen Zentren der Ge-
genwart zunehmen. Seit gut zwei Jahrzehnten häufen sich jedoch Hinweise, dass
eine Vielzahl genuin urbaner (Disorder-)Phänomene für immer mehr Menschen
zu einem Problem geworden sind und urbane Toleranz zunehmend unter Druck
zu geraten scheint. Beispiele hierfür finden sich in Teilen einer neuen Protestbe-
wegung, die sich ausdrücklich gegen die räumliche Nähe von Randständigen
oder deren Institutionen richtet, in neuen Formen abgeschirmten oder bewachten
Wohnens in zentralen Stadtteilen, in Forderungen nach freiheitseinschränkenden
städtischen Raumkontrollen oder in der zunehmenden Problematisierung von
abweichenden Siuationen in Medien, Politik und der städtischen BewohnerIn-
nenschaft. Die entsprechende sicherheitsgesellschaftliche Organisation urbaner
Räume geht u. a. einher mit einer zunehmenden Privatisierung von urbanen
Räumen und kommerziellen Sicherheitsdienstleistungen. So wird die Herstellung
urbaner Sicherheit in immer größerem Ausmaß auch vom profitorientierten Sek-
tor initiiert und finanziert: In privatisierten (ehemals) öffentlichen Räumen pa-
trouillieren private Sicherheitsdienste. Unternehmen entwickeln Kontrolltechni-
ken und Sicherheitsarchitekturen. Anwohner übernehmen in unterschiedlicher
Weise (Selbst-)Verantwortung für ihre Sicherheit, rüsten ihre Privatsphäre mit
Sicherheitstechnik auf oder gründen Bürgerwehren. Andere, sehr viel weiterrei-
chende Maßnahmen sind verschlossene Hinterhöfe oder ganze Wohngebiete mit
Zugangsbeschränkungen für die Öffentlichkeit.
Zugespitzt lassen sich solche Entwicklungen innerhalb der im Eingangsbei-
trag von Aldo Legnaro beschriebenen „Nicht-Orten“ beobachten. Wer in diese
Orte eintritt, seien es die modernen Shopping-Bahnhöfe, Flughäfen oder mallifi-
zierten Innenstadtareale, fällt unter ein generalisiertes Verdachtsprofil. Unange-
passte Handlungen oder schlicht alles, was einen reibungslosen Konsum stören
könnte, werden in diesen Räumen rigide untersagt und verdrängt. Ob sich zu-
künftig ganze Städte zu Nicht-Orten verwandeln, muss zwar offen bleiben. Vie-
les deutet inzwischen allerdings auf ein derartiges (düsteres) Bild hin, wie es
bereits Mike Davis für Los Angeles beschrieben hat. Wichtig erscheint jedoch
auch der Hinweis des Autors auf „hoffnungsvolle Anzeichen“ von „neuen An-
eignungen“, womit sich neue Perspektiven für die zukünftige Stadtforschung
eröffnen, denn es wäre zu kurz gegriffen, die kontrollierten Nicht-Orte des Kon-
sums einem mystifizierten öffentlichen Raum gegenüberzustellen, der aufgrund
der o. g. Entwicklungen verloren gegangen oder zerstört sei.
Dass diese Formen der (Wieder-)Aneignung urbaner Räume in der neolibe-
ralen Stadt mit ihren dominanten Sicherheits- und Sauberkeitsdiskursen dennoch
immer schwieriger werden dürften, zeigt Bernd Belina im zweiten Beitrag. So
verfolgen zahlreiche neue Sicherheitspolitiken einen raumorientierten Ansatz mit
dem Ziel, „sichere Stadträume“ zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die
wachsende Regionalisierung von (Un-)Sicherheit, indem diese als Eigenschaft
bestimmten Vierteln, Plätzen oder Straßen zugeschrieben wird. Als gefährlich
gelten insbesondere „soziale Brennpunkte“ oder „Problemgebiete“. Dieser Pro-
(cid:7)(cid:11)(cid:16)(cid:7)(cid:1)(cid:7)(cid:11)(cid:16)(cid:8)(cid:24)(cid:10)(cid:20)(cid:23)(cid:16)(cid:9)(cid:1)(cid:11)(cid:16)(cid:1)(cid:6)(cid:7)(cid:16)(cid:1)(cid:4)(cid:2)(cid:16)(cid:6)(cid:1) (cid:41)
zess legitimiert u. a. eine zunehmende Punitivität gegenüber typischen Armutser-
scheinungen bei gleichzeitiger Entproblematisierung einer neoliberalen Verar-
mungspolitik. Folgerichtig führen Belinas Ausführungen schließlich zu der Auf-
forderung, Armut fortan nicht mehr als Ursache für Kriminalität, sondern als
Gegenstand von Kriminalisierung zu betrachten.
Der dritte Beitrag von Dirk Schubert erinnert daran, dass sich
(Un-)Sicherheit und Kriminalität in den USA und insbesondere in New York
bereits seit den 1960er Jahren als zentrales stadtpolitisches Thema etabliert hat.
Gleichzeitig war dies die Geburtsstunde von Jane Jacobs’ Klassiker „Death and
Life of Great American Cities“. Starke Suburbanisierungsprozesse führten sei-
nerzeit zu einem erheblichen Bedeutungsverlust der Stadtzentren und in der
Folge zu einer Konzentration insbesondere von Armut und sozialer Benachteili-
gung. Fallbeispielhaft beschreibt Schubert hier die bewegte Geschichte der South
Bronx und die Etablierung von „Community Planning“ und „Community Poli-
cing“. Im Zentrum seiner Ausführungen stehen die zentralen Thesen Jacobs’
zum Zusammenhang von Stadt und Sicherheit, die bis heute nicht an Aktualität
verloren haben. Die seit einigen Jahren verstärkt geführten Diskussionen um die
Bedeutung des lokalen Sozialkapitals für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
und entsprechende Forschungsarbeiten mögen als Belege dienen. Besonders
aktuell erscheinen auch die an Jane Jacobs und Henri Lefebvre angelehnten Aus-
führungen zum Zusammenhang zwischen dem alltäglichen Umgang mit Diffe-
renz und einer „natürlichen Sicherheit“.
Wesentlich problematischer betrachtet Andrew Wallace den Topos „Com-
munity“ in seiner Bedeutung für eine neoliberale urbane Sicherheitspolitik. Er
beschreibt in diesem Zusammenhang eindrücklich die Entstehung einer „kom-
munitären Landschaft“ als „Regime moralischer Regulierung“ in Zeiten von New
Labour. Zentrale Bedeutung nimmt hier der „Kampf gegen asoziales Verhalten“
ein. Ähnlich wie Legnaro beschreibt Wallace für Großbritannien ein Szenario
„moralisch aufgewerteter bürgerschaftlicher Räume“, die bereinigt sind von
jeglichen Formen abweichender oder „asozialer“ Handlungen und die kontrol-
liert werden von den jeweiligen EinwohnerInnen selbst. Hier kann der Autor
deutliche Parallelen zum Kommunitarismus der 1990er Jahre aufzeigen, etwa
den New Democrats in den USA mit ihrer Strategie des harten Durchgreifens
gegen Kriminalität und abweichendes Handeln. In einem eigenen Abschnitt
(„asoziales“ Verhalten) gelingt Wallace der empirische Nachweis von Communi-
ties, die mit quasi polizeilichem Mandat und teilweise menschenfeindlichen
Strategien gegen alles vorgehen, was der vorherrschenden (neuen) moralischen
Ordnung zu widersprechen scheint. Als besonders prägnant und geradezu sinn-
bildlich für diese neuen Communities kann die Strategie der Kontrolle (Beobach-
tung) des Verhaltens der Armen durch die anderen Armen herausgestellt werden.
Ein Teil dieser Sicherheits- und Ordnungspolitik ist in immer größerem
Umfang auch der Einsatz privater Sicherheitsdienste. Nach einer kurzen Entste-
hungsgeschichte des privaten Sicherheitsgewerbes in Deutschland, das Kendra
10 (cid:12)(cid:17)(cid:2)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:15)(cid:1)(cid:10)(cid:3)(cid:8)(cid:7)(cid:14)(cid:7)(cid:1)
Briken und Volker Eick im fünften Beitrag zu Recht als ‚kommerzielle’ Veran-
staltung charakterisieren, analysieren sie anschließend ältere klassische Tätig-
keitsprofile und jüngere Aufgabenbereiche kommerzieller Sicherheitsdienste, die
als „Pazifizierungsagenten“, u. a. etwa im Rahmen von Police Private Partners-
hips in halb öffentlichen Räumen wie in Bahnhöfen und auf deren Vorplätze
zum Einsatz kommen. Derartige Strategien des „Auf- und Abräumens“ kommen
vermehrt und unter besonders prekären Vorzeichen auch in benachteiligten
Stadtquartieren zum Einsatz. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden städti-
schen Festivalisierungspolitik stellen Analyse und Kritik des privaten Sicher-
heitsgewerbes als Teil einer weltweit stark expandierenden kommerziellen Si-
cherheitsindustrie zunehmend auch wichtige Aufgabenfelder für Kriminologie
und Stadtforschung dar. Das von den AutorInnen vorgestellte Konzept der Pazi-
fizierung (Befriedung) ermöglicht hierfür im Vergleich zum Konzept der Krimi-
nalprävention wesentlich differenziertere Beobachtungsperspektiven.
Auf eine ähnliche Dimension verweisen auch die Ergebnisse der Studie von
Ann Rodenstedt im sechsten Beitrag. Am Fallbeispiel des Stockholmer Bezirks
Rinkeby gelingt ihr der Nachweis einer „moralischen Geografie“, die geprägt ist
von zahlreichen bürgerschaftlich organisierten Intoleranzen gegenüber abwei-
chenden Handlungen. Die Gleichung (Un-)Ordnung = Un(Sicherheit), bekannt
geworden vor allem durch den populärwissenschaftlichen Aufsatz von Wilson
und Kelling (1982), ist auch hier zur Handlungsmaxime vielfältiger Maßnahmen
und Programme situativer Kriminalprävention geworden. Hervorzuheben ist vor
allem ihre Analyse der Etablierung „halbformeller Ordnungspartnerschaften“ zur
Herstellung sozialer Kontrolle. Weiter wird der wichtigen Frage nachgegangen,
ob derlei Maßnahmen geeignet sind, eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls
der BewohnerInnen herzustellen. Insgesamt scheinen genuin urbane Differenzen
immer stärker unter Druck zu geraten, zugunsten einer scheinbar „heilen Welt“
ohne das verunsichernde Andere.
Ein weiteres empirisches Beispiel für das sukzessive Verschwinden von
Stadt als Möglichkeitsraum liefert Monika Litscher im siebten Beitrag zur Weg-
weisungspraxis in unterschiedlichen Stadträumen der Schweiz. Zentrale Bezugs-
größe sind auch hier wachsende Sensibilitäten gegen als störend oder gefährdend
wahrgenommene Ungebührlichkeiten. Dabei scheint es, wie bereits im vorheri-
gen Beitrag deutlich wurde, prinzipiell beliebig, wer aufgrund welcher Merkmale
als störend, gefährlich oder fremd wahrgenommen wird. Aktuell, so ihre Beob-
achtungen, geraten vermehrt Jugendliche bzw. Gruppen von Jugendlichen unter
ein generalisiertes Verdachtsprofil und damit in den Fokus der urbanen Wegwei-
sungspraxis. Allmählich werden so Möglichkeitsräume ersetzt durch „irritations-
freie Räume“, die zunehmend kriminalpräventiv von raumpsychologischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Minimierung von Tatgelegenheitsstrukturen
dominiert werden.
Auch auf gesamteuropäischer Ebene, nämlich innerhalb des Europäischen
Normungskomitees (CEN), werden seit Mitte der 1990er Jahre Empfehlungen