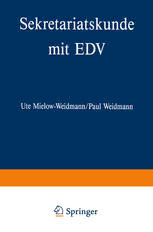Table Of ContentUte Mielow-Weidmann/Paul Weidmann
Sekretariatskunde mit EDV
Ute Mielow-Weidmann/Paul Weidmann
Sekretariatskunde
mit EDV
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Mielow-Weidmann, Ute:
Sekretariatskunde mit EDV / Ute Mielow-Weidmann/Paul
Weidmann. - Wiesbaden: Gabler, 1994
NE: Weidmann, Paul:
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann International.
© Springer Fachmedien Wiesbaden 1994
Ursprünglich erschienin bei Gabler Verlag 1994
Lektorat: Brigitte Stolz-Dacol
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbeson
dere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion
und Verbreitung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf säurefreiem
und chlorarm gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschweißfolie besteht aus Polyäthylen und damit
aus organischen Grundstoffen, die weder bei der Herstellung noch bei der Verbrennung Schadstoffe
freisetzen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
Satz: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, Hemsbach
ISBN 978-3-409-19784-7 ISBN 978-3-663-07884-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-07884-5
Vorwort
Schwer ist zu bestimmen, was eigentlich eine gute Sekretärin kennzeichnet.
Gemein mit allen Tüchtigen ist ihr das Streben nach beruflichem Erfolg auf
Grund fachlichen Könnens, schöpferischer Ideen und einem hohen Grad per
sönlicher Anständigkeit, die Zuverlässigkeit, Fleiß, Selbstdisziplin, Verantwor
tungsgefühl einschließt. Kurzum: Sekretärin und Sekretär gelten als Persönlich
keit.
Die Anlagen dazu können ausgebildet werden, sind aber kaum erlernbar. So
kommt es, daß es Sekretärinnen gibt, die dies ohne spezielle Ausbildung gewor
den sind, und andere haben es trotz bestandener Prüfung schwer, eine gute
Sekretärin zu werden.
Der Wille, immer weiterzulernen, zeichnet die Sekretärin aus. Die Leistung
ihres Vorgesetzten wird mitbestimmt durch den Einsatz seiner Sekretärin. Sie
ist der "Stabsoffizier" ohne Namen, von dem das Gelingen aller Mühen ab
hängt. Das aber verpflichtet selbstverständlich nicht nur die Sekretärin ihrem
Vorgesetzten, sondern im besonderen den Vorgesetzten seiner Sekretärin gegen
über. Erfolgreiche Zusammenarbeit setzt immer die Achtung und Anerkennung
der Leistung des anderen voraus. Erfolg ist stets ein Triumph des Miteinander.
So müßten eigentlich auch die Vorgesetzten jede Gelegenheit nutzen, sich über
Möglichkeiten zur harmonischen und effektiven Zusammenarbeit mit ihrer
Sekretärin oder ihrem Sekretär zu informieren.
Dieses Buch ist daher keineswegs nur ein Buch für die Damen oder Herren, die
nach einer Tätigkeit im Sekretariat streben, oder für diejenigen, die bereits in
einem Sekretariat tätig sind und kritisch über ihr Tun reflektieren wollen, son
dern eben auch ein Buch für die Chefs.
Führen kann immer nur derjenige, der auch die Tätigkeit derer kennt, zu deren
Vorgesetztem er berufen ist.
Wir wünschen Ihnen Nutzen aus dem Studium dieses Buches: Erfassen Sie die
Fakten, verstehen Sie die Zusammenhänge, üben Sie Kritik, bilden Sie sich eine
fundierte Meinung! Viel Erfolg!
Ute Mielow-WeidmannlPaul Weidmann
V
Inhaltsverzeichnis
1 Die Sekretärin und ihr Sekretariat .................... .
1.1 Das Berufsbild der Sekretärin ........................ .
1.1.1 Das Image des Berufes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Life-Iong Learning als Verpflichtung .... . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3 Die Aufgabenbereiche einer Sekretärin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.4 Die Eigenschaften einer Sekretärin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Die Stellung der Sekretärin im Unternehmen. . . . .. . . . . . . 6
1.2.1 Das Sekretariat als Stab stelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.2 Inhalt der Stelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3 Das Sekretariat in der Aufbauorganisation . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.4 Informationswege im Stab-Linien-System . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.5 Die Organisation der Arbeit im Sekretariat. . . . . . . . . . . . . . 16
2 Die Arbeit mit dem Personalcomputer im Sekretariat. . . . . 23
2.1 Grundlagen der Arbeit mit dem Computer. . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.1 Was sind Daten? .................................... 23
2.1.2 Was bedeutet "EVA"-Prinzip? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3 Aufbau einer EDV-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3.1 Die Zentraleinheit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3.2 Die Peripherie ...................................... 32
2.2 Der Personalcomputer (PC) am Arbeitsplatz der
Sekretärin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.1 Die Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.2 Hardware-Informationen. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 35
2.2.2.1 Das Bildschirmgerät = Monitor....................... 36
2.2.2.2 Der Drucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.2.3 Datenträger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2.4 Die Zentraleinheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.2.5 Die Tastatur ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.2.6 Die Entwicklung der Hardware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.2.3 Software-Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 45
2.2.3.1 Systemsoftware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.3.2 Anwendersoftware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.3.3 Software-Entwicklung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2.4 Netzwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.2.4.1 Das Ringnetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.4.2 Das Busnetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.4.3 Das Sternnetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
VII
2.2.4.4 Das Maschennetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3 Datenschutz und Datensicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.1 Das Märchen vom Rumpelstilzchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.3.2 Das Bundesdatenschutzgesetz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3.3 Der betriebliche Datenschutzbeauftragte . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.4 Die Datensicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.4.1 Hardware-Schutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.4.2 Software-Schutz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3 Die Bearbeitung der ein- und ausgehenden Post ......... 69
3.1 Regeln für die Bearbeitung der Eingangspost . . . . . . . . . . . . 70
3.2 Die Post ist eingetroffen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.2.1 Das Zustellen der Post ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.2.2 Das Öffnen der Eingangspost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2.3 Das Herausnehmen, Prüfen und Stempeln ............. 77
3.2.4 Das Sortieren und Verteilen der Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.2.5 Innerbetriebliche Transportanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.2.6 Die Stabsfunktion der Sekretärin bei der Postbearbeitung . 84
3.2.7 Termine und Fristen ................................. 86
3.2.8 Das Ordnen der Posteingänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.2.9 Lesehilfen für den Chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3 Vorbereitende Arbeiten zum Postausgang . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.1 Das Unterschreiben der Sekretariatspost . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.2 Das Vertretungsrecht der Sekretärin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.3.3 Die Unterschriftsorganisation .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.3.4 Die Sekretärin als Vertreterin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.3.5 Kontrollfunktionen der Sekretärin ..................... 93
3.3.6 Grundsätze zur Vertraulichkeit ........................ 93
3.4 Der Postausgang .................................... 94
3.4.1 Arbeitsablauf beim Postausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.4.2 Postbearbeitungsmaschinen im Sekretariat . . . . . . . . . . . . . . 95
3.4.3 Porto kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4 Terminorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.1 Ziele der Terminorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.2 Arten der Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3 Terminplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.4 Terminüberwachung ................................. 108
VIII
5 Veranstaltungen persönlicher Kommunikation:
Besprechungen, Sitzungen, Tagungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.1 Besucher im Sekretariat ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2 Besprechungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.3 Das Mitarbeitergespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.4 Die Aktennotiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.5 Die Konferenz oder Sitzung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.6 Ausschüsse und Arbeitskreise ......................... 128
5.7 Tagungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.7.1 Planung einer Tagung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.7.2 Welche Aufgaben übernimmt die Sekretärin? . . . . . . . . . . . . 130
5.8 Die Pressekonferenz ................................. 133
5.9 Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Ehrungen. . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6 Die Vor- und Nachbereitung von Dienstreisen. . . . . . . . . . . 141
6.1 Reisevorbereitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.1.1 Allgemeine Überlegungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.1.2 Spezielle Überlegungen - Situationsbeispiele ........... 143
6.1.2.1 Der/die Vorgesetzte fährt mit dem Auto. . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.1.2.2 Der/die Vorgesetzte fährt mit der Bahn. . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.1.3 Hotel- und Zimmerbestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.1.4 Eigene Informationssammlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.1.5 Vorbereitung von Auslands- und Flugreisen ............. 154
6.1.6 Messebesuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1.7 Das Zusammenstellen der termingebundenen
Reiseunterlagen ..................................... 159
6.1.8 Vorbereitungen für die Zeit der Abwesenheit des/der
Vorgesetzten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
6.1.9 Platzhalterschaft .................................... 161
6.2 Auswertung der Reise/Nachbereitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2.1 Die Sekretärin informiert den Chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.2.2 Der Chef informiert die Sekretärin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.2.3 Die Reisekostenabrechnung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.2.3.1 Die gesetzlichen Vorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.2.3.2 Die Technik der Reisekostenabrechnung ................ 168
6.2.3.3 Beispiele ........................................... 169
6.2.3.4 Vorsteuerabzug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.2.3.5 Besondere Regelungen bei Auslandsreisen. . . . . . . . . . . . . . . 173
IX
7 Telekommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.1 Das Telefon......................................... 175
7.1.1 Richtiges Telefonieren formt das Image des Betriebes. . . . . 175
7.1.2 Wie melden Sie sich richtig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7.1.3 Die Telefonnotiz. .. ................ ........... ... . . .. 181
7.1.4 Besondere Gesprächssituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.1.5 Kostenbewußt telefonieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.1.6 Zusatzeinrichtungen am Fernsprecher .................. 187
7.1.7 Sprech- und Suchanlagen .. ..... ....... . ..... ........ . 189
7.2 Telex, Teletex, Telefax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.2.1 Telex und Teletex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.2.2 Telefax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7.3 Bildschirmtext ...................................... 195
7.3.1 Informationen vom Unternehmen an den Verbraucher.... 195
7.3.2 Mitteilungsdienst im Btx ............................. 196
7.3.3 Thlebox (oder Mailbox). .... . ..... ....... . ...... . . . . . . 197
7.3.4 Datensicherung ..................................... 198
7.3.5 Ausblick in die Zukunft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8 Der Umgang mit Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201
8.1 Informationsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.2 Bedingungen der Informationsübermittlung . . . . . . . . . . . . . 201
8.3 Formen und Dimensionen von Information . . . . . . . . . . . . . 202
8.4 Information und Manipulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 203
8.5 Informationsaufbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
8.5.1 Wie kann die Sekretärin eingehende Informationen
aufbereiten? ........................................ 205
8.5.2 Wie kann sich die Sekretärin Informationen beschaffen? . . 205
8.5.3 Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8.6 Die innerbetriebliche Weiterleitung von schriftlichen
Informationen ...................................... 208
9 Konventionelle Informationsspeicher . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 211
9.1 Karteien im Sekretariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 211
9.2 Ordnungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.2.1 Die alphabetische Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.2.2 Die numerische Ordnung.. . ..... . ... . . .... . . . . ... .... 216
9.2.3 Die alphanumerische Ordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217
9.2.4 Die mnemotechnische Ordnung........................ 217
9.2.5 Die chronologische Ordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 218
x
9.3 Registratur ......................................... 218
9.3.1 Wertigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
9.3.2 Registraturformen im Sekretariat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
9.3.3 Die Mikrofilmablage . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 222
9.3.4 Registraturorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
9.3.5 Die Organisation der Schriftgutablage . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226
9.3.6 Kosten der Registratur ............................... 230
10 Rationalisierung der Textverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233
10.1 Arbeitsablauf bei der Postbeantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10.2 Das Diktieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 235
10.2.1 Diktat in die Schreibmaschine oder den AC. . . . . . . . . . . .. 235
10.2.2 Das Diktat auf Tonträger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.2.2.1 "Regeln für das Phonodiktat" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.2.2.2 Diktatbegleitzettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
10.2.2.3 Diktiergeräte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
10.2.3 Zentrale Diktatanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
10.2.4 Das Diktat ins Stenogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239
10.3 Das Zusammensetzen von Texten .......... . . . . . . . . . . .. 240
10.4 Der Einsatz vorgedruckter Textteile .................... 243
10.4.1 Vordrucke und Formulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244
10.4.2 Kurzbriefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
10.4.3 Pendelbriefe ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10.4.4 Blitzantwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10.4.5 Auswahltexte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
10.5 Das Schreiben ...................................... 248
10.5.1 Schreibmaschinen ................................... 249
10.5.2 Schreibdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
11 Vervielfältigungen ................................... 255
11.1 Durchschreiben ..................................... 255
11.2 Kopieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
11.3 Drucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
11.4 Kosten der Vervielfältigungen ......................... 259
12 Arbeitsplatz- und Raumgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
12.1 Funktionale Aspekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
12.2 Psychologische und soziale Aspekte: das Betriebsklima . .. 262
12.3 Physiologische Aspekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.3.1 Büromöbel ......................................... 263
XI