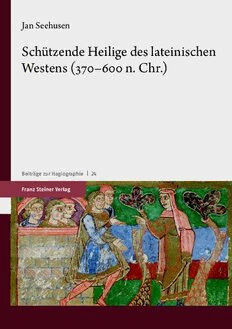Table Of ContentMit dem Ende Westroms stellte sich und führten Gesandtschaftsreisen Jan Seehusen
s
die Frage, wer nun politische Aufgaben durch. n
e
in der Spätantike übernehmen konn- t
s
te. Lateinische Heiligenviten (Vitae Jan Seehusen zeigt, wie sich die e
W
sanctorum) dokumentieren, dass es ‚schützenden‘ Heiligen im hagio- Schützende Heilige des lateinischen
die ‚Heiligen‘ waren, die zwischen graphischen Diskurs des lateinischen n
e
dem vierten und sechsten Jahrhundert Westens zunehmend etablierten und h
Westens (370–600 n. Chr.)
n. Chr. einen großen Teil der öffent- in welchen Schattierungen ihr Wirken c
s
lichen Funktionen wahrnahmen. In zu beobachten ist. Neben einer neuen ni
diesen Biographien erscheinen die Typisierung der Heiligen liegt ein wei- ei
t
Heiligen als Mittler zwischen der städ- terer Schwerpunkt auf der Wirkabsicht a
l
tischen und ländlichen Bevölkerung und den intendierten Adressaten ihrer s
e
auf der einen und den römischen wie Viten. Seehusen macht damit in um-
d
gentilen Machthabern auf der anderen fassender Weise rezeptionsästhetische e
g
Seite. Bischöfe, Äbte, Äbtissinnen und Überlegungen für die Erforschung
i
l
andere heilige Männer und Frauen von Heiligenviten fruchtbar, die zum i
e
setzten sich für die Befreiung von Verständnis ihrer Genese sowie ihrer H
Kriegsgefangenen ein, organisierten Einbindung in die spätantike Lebens- e
d
die Versorgung mit Nahrungsmitteln welt insgesamt beitragen.
n
e
z
t
ü
h
c
S
Beiträge zur Hagiographie | 24
ISBN 978-3-515-13020-2
www.steiner-verlag.de 24 Franz Steiner Verlag
Franz Steiner Verlag
9 783515 130202
n
e
s
u
h
e
e
S
Beiträge zur Hagiographie
Herausgegeben von
Hedwig Röckelein (federführend), Dieter R. Bauer, Andreas Bihrer,
Klaus Herbers und Julia Weitbrecht.
Band 24
Schützende Heilige des lateinischen Westens
(370–600 n. Chr.)
Jan Seehusen
Franz Steiner Verlag
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Studienstiftung des deutschen Volkes
Umschlagabbildung:
Les gardiens de la prison de Péronne donnent à Radegonde une explication mensongère
à propos des détenus, aus: Vie de Sainte Radegonde.
Médiathèque François-Mitterrand (Poitiers), Ms 250 (136), f. 25 v.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist unzulässig und strafbar.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021
Layout und Herstellung durch den Verlag
Satz: Fotosatz Buck, Kumhausen
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier.
Printed in Germany.
ISBN 978-3-515-13020-2 (Print)
ISBN 978-3-515-13021-9 (E-Book)
Danksagungen
Die vorliegende Arbeit ist die leicht überarbeitete Fassung meiner Dissertationsschrift,
die am 04.02.2020 an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg
eingereicht und im Sommersemester 2020 verteidigt wurde. Für die Drucklegung
wurde weitere Literatur bis einschließlich 2019, vereinzelt auch aus dem Jahre 2020
aufgenommen.
Mein Dank gilt an erster Stelle meinem Erstbetreuer Prof. Dr. Werner Rieß (Universi-
tät Hamburg), dessen althistorisches Oberseminar „Martin von Tours und Severin von
Norikum – zwei Heilige im Vergleich“ (Sommersemester 2014) mein Interesse für la-
teinische Heiligenviten geweckt hat. In den folgenden Jahren ist aus diesem Interesse in
zunehmendem Maße eine Leidenschaft geworden, diese Texte hinsichtlich ihrer Gene-
se, intertextuellen Zusammenhänge und Wirkabsichten zu untersuchen. Das Ergebnis
dieser Studien ist dieses Buch, welches, wie ich hoffe, meine Freude gleichermaßen am
althistorischen wie am literaturwissenschaftlichen Arbeiten widerspiegelt. Die intensive
Förderung durch Prof. Rieß und durch den gesamten Arbeitsbereich Alte Geschichte
der Universität Hamburg hat wesentlich dazu beigetragen, die Auseinandersetzung
mit den Heiligen in Gesprächen und Vorträgen zu bündeln und zu Papier zu bringen.
In gleichem Maße möchte ich meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Peter Gemeinhardt
(Georg-August-Universität Göttingen) danken, der die Dissertation von ihrer Entste-
hung bis zu ihrem Abschluss begleitet und in der Phase der schriftlichen Ausarbeitung
mit großem Einsatz unterstützt hat. Neben den regelmäßigen Betreuungsgesprächen ist
hier auch meine Aufnahme in den Kreis der Göttinger Doktorandinnen und Doktoran-
den zu erwähnen, welche zu fruchtbaren interdisziplinären Diskussionen mit Nicolas
Anders, Christoph Brunhorn, Dr. Maria Munkholt Christensen und Dorothee Schenk
geführt haben – bisweilen auch im Kleinbus während der Durchquerung des mir bis
dahin unbekannten Göttinger Umlandes. Das kirchenhistorische Kolloquium, an dem
ich teilnehmen durfte, hat mir dazu verholfen, den theoretischen Zugriff auf das Thema
meiner Dissertation zu schärfen. Ich danke ebenfalls Prof. Dr. Hartmut Leppin (Goe-
the-Universität Frankfurt) für das Drittgutachten und Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu
(Universität Hamburg) für ihre Tätigkeit als Drittprüferin in der Disputation wie für
unseren regelmäßigen Austausch über Heilige in Ost und West.
Meinen akademischen Lehrerinnen und Lehrern verdanke ich bedeutsame Anregun-
gen und Impulse; ihnen bleibe ich auch über die Studien- und Promotionszeit hinaus
6 Danksagungen
verbunden. Meinen Dank aussprechen möchte ich Prof. Dr. Claudia Benthien (Uni-
versität Hamburg), Prof. Dr. Marie-Theres Federhofer (HU Berlin), Prof. Dr. Andreas
Körber (Universität Hamburg), Prof. Dr. Karin Nissen-Rizvani (HfMT Hamburg)
und Prof. Dr. Thomas Zabka (Universität Hamburg). Mit Prof. Dr. Helmut Halfmann
(Universität Hamburg) durfte ich während der letzten Jahre ein gemeinsames Büro
teilen und einzelne Thesen vertieft diskutieren. Gesondert erwähnen möchte ich den
Hamburger Kreis der Doktorandinnen und Doktoranden sowie Postdoktorandinnen
und Postdoktoranden. Neben den gemeinsamen Exkursionen (Griechenland, Italien)
haben auch die regelmäßigen Stammtische dazu beigetragen, am Arbeitsbereich eine
kritisch-wohlmeinende Atmosphäre entstehen zu lassen, welche die Abfassung der Dis-
sertationsschrift erheblich befördert hat. Für den schnellen und unkomplizierten Aus-
tausch beim Mittagessen und in Flurgesprächen möchte ich hier Philip Egetenmeier,
Agnes von der Decken und Dr. Michael Zerjadtke danken.
Der Studienstiftung des deutschen Volkes und der Claussen-Simon-Stiftung danke
ich für die Gewährung von Doktorandenstipendien im frühen Stadium meiner Pro-
motion. Der großzügig bewilligte Druckkostenzuschuss der Studienstiftung hat mir
darüber hinaus dazu verholfen, die Drucklegung zügig in Angriff zu nehmen. Prof. Dr.
Hedwig Röckelein (Georg-August-Universität Göttingen) und Prof. Dr. Klaus Herbers
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) danke ich für die Aufnahme
meiner Dissertation in die Reihe ‚Beiträge zur Hagiographie‘.
Meine Familie ist und bleibt ein wichtiger Bezugspunkt für mich und bot während
der letzten Jahre vielfach Unterstützung und Bestätigung für meine wissenschaftlichen
Vorhaben und darüber hinaus. Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern Martina und
Jörg Seehusen, meinen Schwestern Nele Fenske und Rieke Seehusen, meinem Schwa-
ger Mathis Fenske sowie meiner Großmutter Heike Schröder. Dankbar bin ich ebenfalls
Svenja und Ronja Helms, Wiebke, Marc, Birgit, Aenne, Motje und Jos Kunz sowie Silke
und Volker Reith. In einer späten Phase des Promotionsstudiums verstarb leider mein
Großvater Jürgen Schröder, der mich seit dem Beginn meines Lebens begleitete und
dem ich immer verbunden sein werde.
Einen ganz wesentlichen Anteil am Abschluss und Gelingen der Dissertation haben
meine Freundinnen und Freunde inne, deren Kontakt mich über die letzten Jahre hin-
weg immer wieder getragen hat. Nennen möchte ich Johanna Cordes, Jannis Fürchte-
nicht, Alexander Ganzhorn, Friederike und Jan Heinig, Sander Oliver Henriksen, Ines
und Edward Koch, Lilli Meißner, Tobias Nowitzki und Mareike Eckardt-Nowitzki, Ste-
ven Peemöller, Fabian Pleß, Christopher Pöhls, Michaela Rethmeier, Frida Steimer und
Julian Steiner, Timo Sylvester, Annika und Marco Vieregge, Vincent Warlich, Michael
Watzlawik und Julia Worlitzsch. Tobias, Michael, Timo, Steven und Vincent danke ich
für alle wissenschaftlichen Höhen und Tiefen, die sie mit mir geteilt haben, wie für ihre
Bestärkung, auch meine didaktischen Interessen weiter zu verfolgen.
Freiburg im Breisgau, den 15.01.2021 Jan Seehusen
Inhaltsverzeichnis
Danksagungen ............................................................. 5
I Einleitung ............................................................ 11
1 Gegenstand und Grundlegung ........................................ 13
1.1 Hinführung ............................................................ 13
1.2 Leitfragen und Untersuchungsfokus ..................................... 19
1.3 Forschungsstand und Desiderat ......................................... 22
1.4 Heiligenviten als Quelle und Vorgehen der Untersuchung ................. 25
2 Patronatsverhältnisse des 4.–6. Jahrhunderts im lateinischen Westen .. 29
2.1 Salvian von Marseille und Sidonius Apollinaris: Ländliches patrocinium
und die Aufgaben eines ‚guten Bischofs‘ ................................. 29
2.2 Bischöfe und ihre karitativen Pflichten ................................... 33
2.3 Heilige als spirituelle patroni ............................................ 42
2.4 Der defensor civitatis und lateinische Heiligenviten ........................ 45
3 Das Corpus der Untersuchung: Einführung und Begründung der
Auswahl .............................................................. 51
3.1 Viten ‚schützender‘ Heiliger des 5./6. Jahrhunderts ....................... 51
3.2 Gallische und italische Hagiographie aus dem 6. Jahrhundert .............. 54
3.3 Frühe lateinische Heiligenviten .......................................... 56
3.4 Bischofsviten aus dem 5. und 6. Jahrhundert .............................. 59
3.5 ‚Alte Heilige‘ – neue Viten .............................................. 61
3.6 Liste der hagiographischen Literatur ..................................... 62
4 Methoden im Umgang mit Hagiographie .............................. 64
4.1 Der hagiographische Diskurs ............................................ 64
4.2 Der hagiographische Vergleich .......................................... 68
4.3 Die hagiographische Plausibilität ........................................ 70
4.3.1 Definition ............................................................. 70
4.3.2 Hagiographische Plausibilität und historische Triftigkeit .................. 73
8 Inhaltsverzeichnis
5 Intertextualität ........................................................ 80
5.1 Definitionen und Begrifflichkeit ......................................... 80
5.2 Die frühen lateinischen Heiligenviten .................................... 83
5.3 Martin und die ersten ‚schützenden Heiligen‘ ............................ 87
5.4 Die ‚schützenden‘ Heiligen des späteren sechsten Jahrhunderts ............ 96
II Hagiographischer Vergleich ........................................... 101
6 Umgang mit weltlicher Bevölkerung .................................. 103
6.1 Die karitativen Leistungen der Heiligen .................................. 103
6.2 Die Gesandten des Volkes .............................................. 110
6.2.1 Vita Germani (Constantius von Lyon) ................................... 110
6.2.2 Vita Epiphanii (Ennodius von Pavia) ..................................... 114
6.3 Die Beschützer bei Einfällen von Gentilheeren und Hungersnöten ......... 118
6.3.1 Vita Severini (Eugippius) ................................................ 118
6.3.2 Vita Genovefae ......................................................... 126
6.4 Die Gefangenenbefreier ................................................ 129
6.4.1 Vita Caesarii (verschiedene Hagiographen) .............................. 130
6.4.2 Libri IV Dialogorum (Gregor d. Große) .................................. 132
6.5 Fazit ................................................................... 135
7 Umgang mit weltlichen Autoritäten ................................... 138
7.1 Konflikt und Einvernehmen ............................................ 139
7.2 Das Eintreten für Gefangene und Schuldige .............................. 142
7.3 Die Gesandten ......................................................... 143
7.3.1 Vita Germani (Constantius von Lyon) ................................... 143
7.3.2 Vita Epiphanii (Ennodius von Pavia) ..................................... 146
7.3.3 Vitae Patrum Iurensium und Liber Vitae Patrum (Gregor von Tours) ........ 150
7.3.4 Zwischenfazit .......................................................... 151
7.4 Die Beschützer ......................................................... 153
7.4.1 Vita Severini (Eugippius) ................................................ 153
7.4.2 Liber Vitae Patrum (Gregor von Tours) .................................. 158
7.5 Die Gefangenenbefreier ................................................ 160
7.5.1 Vita Caesarii (verschiedene Hagiographen) .............................. 160
7.5.2 Vita Genovefae ......................................................... 162
7.5.3 Libri IV Dialogorum (Gregor d. Große) .................................. 163
7.6 Fazit ................................................................... 164
8 Umgang mit geistlichen Autoritäten ................................... 169
8.1 Heilige Gesandte, Beschützer und Gefangenenbefreier .................... 169
8.2 Geschlechterspezifische Darstellungsmodi ............................... 173
8.3 Fazit ................................................................... 178
Inhaltsverzeichnis 9
9 Wunder ............................................................... 180
9.1 Einleitung ............................................................. 180
9.2 Vermehrung und Erhalt von Nahrung .................................... 183
9.2.1 Das plötzliche Auftauchen von Nahrung ................................. 183
9.2.2 Keine Bedrohung der Nahrungsmittel durch Naturgewalten ............... 184
9.2.3 Die wundersame Vermehrung bereits vorhandener Nahrungsmittel ........ 187
9.3 Wundersame Gefangenenbefreiungen ................................... 188
9.3.1 Das Gebet der Heiligen ................................................. 190
9.3.2 Die Berührung und der Blick der Heiligen ............................... 190
9.3.3 Träume und Visionen .................................................. 192
9.3.4 Reliquien .............................................................. 194
9.4 Fazit ................................................................... 195
10 Exkurs: Die Abwehr von Gentilheeren ................................ 199
11 Zwischenfazit: Das schützende und helfende Patronat als Leitbild der
hagiographischen Erzählwelt .......................................... 206
11.1 Zusammenfassung nach Kapiteln ........................................ 206
11.2 Zusammenfassung nach Viten ........................................... 210
11.3 Die Rolle der Réécriture ................................................. 213
11.4 Geschlechterspezifische Darstellungsmodi ............................... 217
III Hagiographische Plausibilität und Sitz im Leben ...................... 221
12 Einflüsse der spätantiken Lebenswelt .................................. 223
12.1 Die Übernahme von Gesandtschaften ................................... 223
12.2 Der christliche Gewaltdiskurs ........................................... 226
12.3 Gefangenenfürsorge und -befreiung ..................................... 230
12.4 Die Perspektive der hagiographischen Literatur .......................... 235
13 Adressaten ............................................................ 240
13.1 Einleitung und Methode ................................................ 240
13.2 Einzelne monastische Gemeinschaften ................................... 246
13.3 Bürgergemeinschaften bestimmter geographischer Räume ................ 255
13.4 Fazit ................................................................... 258
14 Gesamtfazit: Funktionen ‚schützender‘ Heiligenviten in ihrer
Lebenswelt ........................................................... 260
14.1 Methodische Überlegungen ............................................. 260
14.2 Gründungserzählungen für eine monastische Gemeinschaft ............... 263
Vita Severini ........................................................... 263