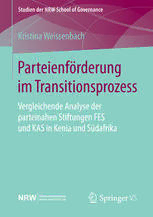Table Of ContentStudien der NRW School of
Governance
Herausgegeben von
Prof. Dr. Christoph Bieber
Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Andreas Blätte
Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte
Universität Duisburg-Essen
Die Studien der NRW School of Governance sind eine praxisorientierte Schrift en-
reihe, die einen wichtigen Beitrag zur modernen Regierungsforschung leistet. Sie
dokumentiert die Forschungsergebnisse der NRW School of Governance und bie-
tet zugleich ein Forum für weitere wissenschaft liche Arbeiten aus ihrem themati-
schen Umfeld. Das Interesse gilt der Komplexität politischer Entscheidungsprozes-
se in den Bereichen Politikmanagement, Public Policy und öff entliche Verwaltung.
Untersucht werden die praktischen Bemühungen rational handelnder Akteure
ebenso wie die Wirkungsweise institutioneller Koordinationsmechanismen auf der
Landes- und Bundesebene. Mit dem Fokus auf ethische Aspekte werden aber auch
neue, bisher vernachlässigte Fragestellungen des modernen Politikmanagements
wie moralbegründete Argumentations- und Entscheidungsvorgänge sowie ethi-
sche Beratungsorgane thematisiert.
Die Reihe veröff entlicht Monographien und Konzeptbände, die frei eingereicht
oder auf Anfrage durch die Herausgeber der Schrift enreihe verfasst werden. Auf
eine sorgfältige theoretische Fundierung und methodische Durchführung der em-
pirischen Analysen wird dabei ein besonderer Wert gelegt. Die Qualitätssicherung
wird durch ein anonymisiertes Begutachtungsverfahren sichergestellt.
Herausgegeben von
Prof. Dr. Christoph Bieber Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte
NRW School of Governance NRW School of Governance
Universität Duisburg-Essen Universität Duisburg-Essen
Duisburg, Deutschland Duisburg, Deutschland
Prof. Dr. Andreas Blätte
NRW School of Governance
Universität Duisburg-Essen
Duisburg, Deutschland
Kristina Weissenbach
Parteienförderung im
Transitionsprozess
Vergleichende Analyse der
parteinahen Stiftungen FES
und KAS in Kenia und Südafrika
Kristina Weissenbach
Duisburg, Deutschland
Diese Arbeit wurde von der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität
Duisburg-Essen als Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. pol.) geneh-
migt.
Namen der Gutachter:
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte
Prof. Dr. Christof Hartmann
Tag der Disputation: 25.01.2012
Studien der NRW School of Governance
ISBN 978-3-531-18560-6 ISBN 978-3-531-94206-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-531-94206-3
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi-
bliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)
Herausgebervorwort
Vorwort des Herausgebers
Parteien spielen im demokratischen Prozess für die Qualität einer Demokratie
eine zentrale Rolle. In konsolidierten, westlichen Demokratien wird hiervon
ausgegangen. In jungen und häufig noch nicht konsolidierten Demokratien tref-
fen wir hingegen häufig auf instabile und schwach institutionalisierte Parteien.
Externe Demokratieförderer in diesen Ländern stehen damit vor großen Heraus-
forderungen: Ohne eine Unterstützung der Parteien vor Ort droht die Demokrati-
sierung insgesamt zu scheitern, die Förderung einzelner Parteien stellt anderer-
seits eine direkte Einmischung dar und kann – je nach Intensität der Förderung –
den Parteienwettbewerb aushebeln.
In Ihrer Arbeit widmet sich Kristina Weissenbach den international promi-
nentesten Akteuren der Parteienförderung: den deutschen parteinahen Stiftungen.
Anhand der Förderpraxis der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Kenia und Südafrika rekonstruiert Kristina Weissenbach
kontextsensitiv und theoriegeleitet, wie sich die Förderansätze und die Instru-
mente im Verlauf des Transitionsprozess der beiden Länder seit den 1970er
Jahren gewandelt haben.
Die deutschen Stiftungen gelten vor dem Hintergrund ihrer langen Tradition
im Feld der internationalen Parteienförderung und ihrer weltweit vernetzten
Förderpraxis als Vorbild. Trotz dieser langen Förderpraxis wissen wir nur wenig
über diesen sensiblen Arbeitsbereich der deutschen parteinahen Stiftungen: Eva-
luierungen liegen kaum vor und werden nicht öffentlich gemacht, Studien, wel-
che die Geschichte der Förderung aufarbeiten, sind rar. Zudem gibt es kaum
verlässliche länderspezifische Daten zu Parteienentwicklung und Fördermaß-
nahmen der Stiftungen. Aus diesem Grund stützt sich die empirische Analyse
von Kristina Weissenbach mitunter auf eine Datengrundlage, die sie selbst im
Rahmen von Interviewführung mit Stiftungsvertretern, den Partnerparteien der
Stiftungen vor Ort und wissenschaftlichen Experten, sowie teilnehmender Be-
obachtung in Deutschland, Kenia und Südafrika erhoben und schließlich inhalts-
analytisch ausgewertet hat.
„Strategiebildung im Bereich der Parteienförderung“, so eine Vorannahme
der vergleichenden Analyse, „benötigt theoretische Leitbilder“. Diese lagen auf
Seite der deutschen Stiftungen im Feld der Parteienförderung bislang aber kaum
vor!
6 Herausgebervorwort
An der Schnittstelle von Transitionstheorie, internationaler Parteienfor-
schung und den bestehenden Studien der Demokratisierungs- und Parteienförde-
rung erarbeitet die Verfasserin nun erstmals ein solches Leitbild, ein „Phasen-
modell der Parteienförderung“ und eine „Synopse der Parteieninstitutionalisie-
rung“. Sie erklärt damit die Interdependenz von Demokratisierungsstatus eines
Landes, Grad der Parteieninstitutionalisierung und Ansätzen und Instrumenten
der Parteienförderung.
Die umfassenden und detailgenauen Fallstudien über die Praxis der Partei-
enförderung von Friedrich-Ebert- und Konrad-Adenauer-Stiftung in Kenia und
Südafrika sind geprägt von großer Sachkenntnis über die beiden Länder, decken
Folgen des ideellen und normativen Hintergrunds der Stiftungen für die Parteien-
förderung auf und bereichern unser Wissen über die Möglichkeiten und Heraus-
forderungen dieses geheimnisvollen Bereichs, der im Kontext weltweiter Demo-
kratisierungsprozesse immer stärker an Bedeutung gewinnt.
Duisburg, im November 2014
Für die Herausgeber
Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte
Direktor NRW School of Governance
Dank
Dank
„Dazu erfahren Sie ohnehin nichts. Das ist ein zu sensibler Bereich“. Mit diesen
Worten startete eines der frühen Hintergrundgespräche mit einem „Experten“ im
Rahmen meines Dissertationsprojekts. Und zunächst schien es tatsächlich so,
dass die Spurensuche nach der Förderpraxis, nach Strategien und Instrumenten
der deutschen Stiftungen in Sub-Sahara Afrika nicht sehr erhellend wird. Die
Stiftungen selbst haben ob des sensiblen Themas in den letzten dreißig Jahren
kaum dazu beigetragen, Licht in diesen geheimnisvollen Arbeitsbereich zu brin-
gen – erst jüngst wurden erste Evaluierungen veröffentlicht und Leitlinien für die
Parteienförderung publiziert. Auch die empirischen Vorstudien zu Parteien in
Kenia und Südafrika sind begrenzt, Datenmaterial dazu häufig rar und wenig
verlässlich.
Für die vorliegende Studie bedeutete dieser Befund nicht nur das Aktenstu-
dium entsprechender Stiftungsdokumente und eine Vielzahl an Hintergrundge-
sprächen und Interviews zu führen, sondern vor allem Feldforschung und Be-
obachtung vor Ort. Umsetzbar war dieses Vorhaben nur dank der Unterstützung
einer Vielzahl von Förderern und „guten Geistern“ im Hintergrund.
Am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen möchte
ich meinen größten Dank meinem Doktorvater und Erstgutachter Prof. Dr. Karl-
Rudolf Korte aussprechen: für sein Vertrauen in mich und in das Projekt – trotz
des für einen Lehrstuhl „Politisches System der Bundesrepublik Deutschland“
exotischen Themas. Ihm ist es immer wieder gelungen mir Freiräume zum Den-
ken, zum Forschen und Schreiben zu ermöglichen. Seiner Begeisterungs- und
Überzeugungsfähigkeit, an einem solch langjährigen Projekt festzuhalten, ist es
zu verdanken, dass es seinen Abschluss gefunden hat.
Prof. Dr. Christof Hartmann hat im Rahmen dieser Forschungsarbeit sicher-
lich eine weitaus größere Rolle eingenommen als die eines gewöhnlichen Zweit-
gutachters. Von Beginn an war er ein vertrauensvoller Ratgeber und Ansprech-
partner. Er wusste es, mich mit interessanten Gesprächspartnern zusammenzu-
bringen und hat die Arbeit durch seine Expertise inspiriert. Dafür danke ich ihm
sehr.
Neben meinem Erst- und Zweitgutachter waren Prof. Dr. Andreas Blätte
(als Vorsitzender) und Prof. Dr. Christoph Strünck Mitglieder der Prüfungs-
8 Dank
kommission. Ihnen möchte ich für ihr Engagement und die professionelle Gestal-
tung der Disputation danken.
Mein Dank gilt zudem der Stiftung Mercator, die das Forschungsvorhaben
für förderwürdig befand und mich mit einem zweijährigen Stipendium an der
NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen unterstützte. Ohne
diesen Beitrag, sowie die Förderung und den wissenschaftlichen Austausch im
Rahmen des Promotionskollegs der NRW School of Governance, wäre das For-
schungsvorhaben nicht in dieser Intensität durchführbar, die aufwändigen For-
schungsreisen und Feldaufenthalte in Kenia und Südafrika nicht umsetzbar ge-
wesen.
Gerade zu Beginn meiner Studien habe ich von der kritischen Diskussion
meiner Ideen in unterschiedlichen Kollegenkreisen profitiert: Mein Dank gebührt
vor allem Dr. Timo Grunden und Dr. Martin Florack, die es wussten meine Ar-
beit konstruktiv auseinander zu nehmen und wieder neu zusammen zu setzen.
Prof. Dr. Thorsten Faas möchte ich an dieser Stelle ebenfalls danken, für das
offene fachliche Ohr einerseits und die Teepausen gegen 17:00 andererseits. Die
viel zitierte „Endphase“ überstand ich nicht zuletzt dank der konstruktiven Ge-
spräche mit Dr. Frank Gadinger und auch Prof. Dr. Susanne Pickel engagierte
sich in der Abschlussphase stets als fachliche und emotionale Ansprechpartnerin.
Inspiriert wurde meine Arbeit zudem durch ihre Diskussion im Rahmen der
Graduiertenkonferenz Parteienforschung am Düsseldorfer „Institut für Deutsches
und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung“, sowie durch die fach-
lichen Anregungen von Prof. Dr. Peter Burnell, Thomas Carothers, Prof. Dr.
André Gerrits und Prof. Dr. Lars Svåsand, die mir in unterschiedlichen Phasen
der Dissertation inhaltliches Feedback gaben.
Das gesamte Team der NRW School of Governance hat mir während des
Forschungsprozess wertvolle Hinweise und Anregungen mit auf den Weg gege-
ben. Für die Unterstützung im Transkriptionsprozess möchte ich mich herzlich
bei Claudia Hertel bedanken und gerade in der Endphase konnte ich mich, nicht
nur hinsichtlich der abschließenden Korrekturen, stets auf Steffen Bender, Pat-
rick Hintze, Britta Schewe, Julia Staub und Susanne Steitz verlassen. Meinen
Kolleginnen Stefanie Delhees und Julia-Verena Lerch gebührt besonderer Dank
für das sorgfältige Korrekturlesen.
Bei aller fachlicher Unterstützung könnte ein solches Forschungsprojekt
ohne emotionalen Rückhalt jedoch nicht gelingen. Dafür danke ich meinen Ge-
schwistern ebenso wie meinen Eltern Margarete Weissenbach und Helmut Weis-
senbach, die mich beide stets bedingungslos auf meinem Weg unterstützt haben.
Auf jeweils ihre eigene Art und Weise haben mir Sabrina Hezinger, Christi-
ne Hobelsberger, Dr. Kathrin Loewe, Theresa von Morozowicz, Mariella Scherer
und Axinja Schnarr Durchhaltekraft und freundschaftliche Unterstützung ge-
Dank 9
spendet. Und es war Jakob Biazza, der mir gezeigt hat, dass man trotz For-
schungsehrgeiz stets noch Chaos in sich haben sollte.
Mein größter Dank gilt Niko. Er war es, der nicht nur jede Passage dieser
Studie mehrfach gelesen hat und mir mit fachlichem Rat zur Seite stand, sondern
der mich gleichzeitg durch die Hoch- und Tiefphasen der langen vier Jahre be-
gleitet hat. Ihm und Luis ist dieses Buch in Liebe und Dankbarkeit gewidmet.
Köln, im September 2014
Kristina Weissenbach