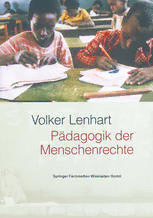Table Of ContentVolker Lenhart
Pädagogik der Menschenrechte
Volker Lenhart
Pädagogik der
Menschenrechte
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2003
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek-Cl?-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für die Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich
ISBN 978-3-8100-3726-8 ISBN 978-3-663-10985-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-10985-3
© 2003 Springer Fachmedien Wiesbaden
Ursprünglich erschienin bei Leske + Budrich, Opladen in 2003
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfliltigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Vorwort.................................................................................................. 9
1. Der Menschenrechtskanon und seine Institutionalisierung
seit 1948 ..................................................................................... . 11
1.1 Die Entwicklung des Menschenrechtskanons in den letzten
fünfzig Jahren ............................................................................. . 11
1.2 Die universale Geltung der Menschenrechte .............................. . 13
1.2.1 Argumente gegen die universale Geltung ................................... . 13
1.2.2 Menschenrechtsskepsis und begrenzte Funktionszuschreibung .. . 15
1.2.3 Begründungen der universalen Geltung ...................................... . 18
2. Die Menschenrechtspädagogik in der Systematik
der Erziehungswissenschaft ..................................................... . 29
3. Die internationalen Dokumente
der Menschenrechtsbildung ..................................................... . 31
3.1 World PlanofAction ( 1993) ....................................................... . 32
3.2 Declaration and Integrated Framework ( 199415) ....................... . 33
3.3 International PlanofAction ( 1998) ........................................... .. 35
3.4 Guidelines for National Plans ( 1998) .......................................... . 39
3.5 Amnesty 1ntemational's Human Rights Education Strategy
41
( 1996) ···························································································
3.6 Regionale Handlungspläne der Menschenrechtsbildung ............ . 43
6 Inhalt
4. Menschenrechtsbildung in formalen Lehr-Lernsituationen,
der schulpädagogische Aspekt ................................................. . 45
4.1 Analyse von Menschenrechtsbildungsmaterialien ...................... . 45
4.1.1 Analyseraster ............................................... .' .............................. . 45
4.1.2 United Nations High Commissioner for Human Rights: ABC,
teaching human rights (1998) .................................................... .. 47
4.1.3 All human beings ... Manual for human rights education (1998) . 52
4.1.4 Thementag Menschenrechte (1995) ............................................ . 57
4.1.5 Reardon, Educating for Human Dignity (1995) .......................... . 59
4.1.6 Amnesty International-Unterrichtspraxis Menschenrechte
(1995-1998) ................................................................................. 66
4.2 Menschenrechtsdidaktik ............................................................... 70
4.2.1 Lernziele ...................................................................................... 71
4.2.2 Lerninhalte ................................................................................... 72
4.2.3 Vermittlungsverfahren ................................................................. 80
4.2.4 Begründungen der Methodenvorgaben ........................................ 82
4.2.5 Entwicklungsorientierte Werteerziehung ..................................... 83
4.2.6 Lernevaluation ............................................................................. 88
5. Bildung als Menschenrecht und Menschenrechte
in der Bildung . .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. ... .. .. .... ... .. . .. ... 89
5.1 Bildung als Menschenrecht.......................................................... 89
5.1.1 Das Menschenrecht auf Bildung im Völkerrecht ......................... 89
5 .1.2 Die Realisierung des Menschenrechtes auf Grundbildung .... .. .. .. 95
5.2 Menschenrechte in der Bildung .................................................. . 100
5.2.1 Förder-und Schutzmaßnahmen nach der Konvention gegen
Diskriminierung in der Bildung .................................................. . 100
5.2.2 Die Europäische Menschenrechtskonvention und der
Bildungsartikel ............................................................................ . 100
5.2.3 Menschenrechtssicherung im Bildungskontext .......................... .. 102
5.2.4 Fallbeispiele ............................................................................... . 104
Inhalt 7
6. Ausbildung von Personal in menschenrechtsrelevanten
Berufsfeldern . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 10 9
6.1 Professionsübergreifende Anleitung ............................................ 109
6.2 Polizistenl-innen .......................................................................... 112
6.3 Soldaten ....................................................................................... 116
6.4 Sozialarbeiterl-innen ................................................................... 120
6.5 Naturwissenschaftlerl-innen ........................................................ 123
6.6 Medizinisches Personal ............................................................... 129
6.7 Lehrerl-innen ............................................................................... 132
6.8 Weitere Professionsgruppen ........................................................ 135
7. Kinderrechte ............................................................................... 137
7.1 Die Kinderrechtekonvention- Überblick .................................... 137
7.2 Kindheitsdefinition und Grundsätze............................................. 137
7.3 Rechte beim Aufwachsen ................ .............................. ............ ... 138
7.4 Zivile Rechte ................................................................................ 139
7.5 Rechte auf Schutz in besonderen Lebenssituationen und vor
Misshandlung und Ausbeutung .................................................... 142
7.5.1 Überblick ..................................................................................... 142
7.5.2 Flüchtlingskinder ......................................................................... 143
7.5.3 Gesundheitsgefahrdete Kinder ..................................................... 150
7.5.4 Arbeitende Kinder........................................................................ 157
7.5.5 Sexuell missbrauchte und ausgebeutete Kinder ........................... 163
7.5.6 Kriegskinder ................................................................................ 165
7.6 Prozedurale Vorschriften............................................................. 178
Literatur . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 181
Vorwort
Mit der vorliegenden Studie wird der Versuch unternommen, den Gegenstand
der "human rights education" über die Menschenrechtserziehung und -bil
dung im engeren Sinne, also die Bildung über die und zu den Menschen
rechten, hinaus zu erweitern. Nach der Klärung der gegenwärtigen Institutio
nalisierung der Menschenrechte war daher gewiss die Menschenrechtsbil
dung in der Schule zu thematisieren. In der Untersuchung konkreter men
schenrechtsbezogener Lehr- Lernmaterialien wird die theoretische Einord
nung an die Unterrichtspraxis zurückgebunden. Dann aber werden die Siche
rung des Menschenrechtes auf Bildung und der Menschenrechte in der Bil
dung, die Ausbildung von Personal in menschenrechtsrelevanten Berufsfeldern
(wieder mit didaktischer Konkretion) und die- gerade auch für sozialpädago
gisches Handeln richtungweisenden - Rechte des Kindes in den Blick genom
men. Die Strukturierung ist dieselbe, die auch dem Themenheft Human Rights
Education der International Review of Education 2002 (UNESCO-Institut
Hamburg) zugrunde liegt, das der Verfasser gemeinsam mit der zuständigen
Direktorin in der UNESCO-Zentrale Kaisa Savolainen edierte.
Der Thematik ist Aktualität nicht abzusprechen. Nach den Menschen
rechtsverletzungen in den Bürgerkriegen der 90er Jahre und nach den An
schlägen des elften September 2001 sind die Menschenrechte zwar nicht -
wie manche übersteigernd propagieren- als säkulare Heilsperspektive, aber
als nüchterner Orientierungspunkt für ein freiheitliches, gerechtes, solidari
sches und friedliches Zusammenleben von Individuen, staatlich verfassten
Gesellschaften, Staatenbünden, Weltregionen und Kulturen in den Fokus
weltgesellschaftlicher Aufmerksamkeit gerückt.
Die Abhandlung fügt sich in die Tradition der verständigungsorientierten
Heidelberger International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswis
senschaft ein, die von Hermann Röhrs gerade auch mit seinen Studien zur
Friedenspädagogik begründet worden ist. Der Verfasser knüpft an seine eige
nen empirischen und theoretischen Arbeiten der letzten zwei Jahrzehnte zur
Evolution des erzieherischen Handelns, der Pädagogik der Dritten Welt und
der Versöhnungspädagogik nach Bürgerkriegssituationen an.
10 Vorwort
Zu danken hat der Autor den Studierenden, die an seinen thematisch ein
schlägigen Lehrveranstaltungen an der Universität Heidelberg und der Hum
boldt- Universität Berlin seit Mitte der 90er Jahre teilgenommen haben. Ihre
Seminarbeiträge und verschiedene im Kontext der Veranstaltungen entstan
dene Qualifizierungsarbeiten haben nicht nur auf Problemdokumentationen
und Materialien hingewiesen. Für Mithilfe bei der Erstellung der Druckfas
sung des Manuskripts ist der Verfasser dankbar den Heidelberger Mitarbei
terlinnen Katarina Batarilo MA, Gürkan Ergen MA, Özkan Ergen MA, Nos
rat Kazemi-Trensch MA, Stefanie LeBmann MA, Sonja Gerdes und der Se
kretärin Gabriele Huber.
Heidelberg, im Mai 2002
VolkerLenhart
1. Der Menschenrechtskanon und seine
Institutionalisierung seit 1948
1.1 Die Entwicklung des Menschenrechtskanons in den letzten
fünfzig Jahren
Die Menschenrechte haben ihre für die Gegenwart grundlegende Ausformu
lierung in der "Allgemeinen Erklärung" erfahren, die die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen im Dezember 1948 beschloss. Das Dokument hat
den Charakter einer Deklaration, es ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Entspre
chend der damaligen weltpolitischen Situation ist die Erklärung von den
Rechtsvorstellungen der dominierenden Staaten der nördlichen Hemisphäre
geprägt. Zahlreiche heutige UN-Mitgliedsstaaten waren an der Erklärung noch
nicht beteiligt, da sie ihre politische Unabhängigkeit erst in den folgenden Jahr
zehnten erlangten. Der in der Erklärung fixierte Katalog umfasst Freiheits- und
Schutz- sowie politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Teilhaberechte.
Er reicht von der Proklamation der Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit (Artikel 1), über das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Per
son (Artikel 3), die Anerkennung als Rechtspersönlichkeit (Artikel 6), die
Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 7), den Schutz vor Verhaftung und Auswei
sung (Artikel 10), ferner über Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit (Arti
kel 13), Asylsuche (Artikel 14), Freiheit der Eheschließung und Schutz der
Familie (Artikel 16) bis zur Religions-, Meinungs- und Vereinigungsfreiheit
(Artikel 18-20). Die Teilhaberechte beginnen mit dem allgemeinen und glei
chen Wahlrecht (Artikel 21), setzen sich fort mit Ansprüchen auf soziale Si
cherheit, Arbeit und gleichen Lohn sowie Koalitionsfreiheit, Erholung und
Freizeit, soziale Betreuung, auf Bildung und die Gewährleistung des Eltern
rechts (Artikel 22-26) und schließen die ungehinderte Ausübung kultureller
und wissenschaftlicher Aktivitäten (Artikel 27) sowie das Recht auf eine an
gemessene einzel- und zwischenstaatliche Sozialordnung (Artikel 28) ein. Die
Erklärung definiert in ihren letzten Passagen Grundpflichten, zu denen insbe
sondere die Unterlassung jeder Handlung gehört, die auf die Abschaffung der
zuvor genannten Rechte und Freiheiten gerichtet ist (Artikel 29-30).
Auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung wurden verschiedene in
ternationale Konventionen geschlossen, die als Pakte hohe Rechtsverbind
lichkeit besitzen und in die - meist in Form eines internationalen Ausschus
ses und einer Berichtspflicht der Unterzeichnerstaaten - Kontrollmechanis-
12 Der Menschenrechtskanon und seine Institutionalisierung seit 1948
men zur Einhaltung der jeweiligen Vereinbarung eingebaut sind. Solche Ab
kommen sind z.B.
der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte
das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras
sendiskriminierung
die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau
das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
die Konvention über die Rechte des Kindes.
Die jüngste Standard-Setzung hat auf der Wiener Weltkonferenz für Men
schenrechte 1993 stattgefunden. In dem Abschlussdokument wird die Uni
versalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte herausgestellt. Kulturelle
Sonderperspektiven erhalten nur eine untergeordnete Bedeutung (Ziffer 1).
Zwar wird in klassischer Tradition das Individuum als Träger der Rechte und
Grundfreiheiten herausgestellt (bes. Ziffer 10), aber das Dokument verstärkt
doch den Gedanken der Gruppenrechte, wobei die Verbindung zu Individual
rechten mit der eher Salvatorischen Formel "Personen, die zu ... gehören"
(z.B. Ziffer 25), hergestellt wird. Gruppen, die als Rechteträger besonders
angesprochen werden, sind: Frauen, Kinder, Flüchtlinge, Behinderte, "beson
ders verwundbar Gemachte" (Ziffer 24), genannt ausdrücklich: Wanderar
beiter, schließlich indigene Völker und nationale und ethnische, religiöse und
kulturelle Minoritäten. Der bisherige Menschenrechtskatalog wird ergänzt.
Neben einem Recht auf ökologisch intakte Umwelt (Ziffer 11) erscheinen ein
Gebot auf Schutz vor extremer Armut (Ziffer 25) und - mehrfach unterstri
chen-das Recht auf Entwicklung (u.a. Ziffer 9).
Man hat die Menschenrechte einerseits in negative und positive, anderer
seits in verschiedene Generationen eingeteilt. Negative Menschenrechte sind
die klassischen Grundfreiheiten und Schutzrechte, deren Gewährung die
Staaten im wesentlichen durch bloßes Unterlassen sichern können, indem sie
eben niemandem die Eigenschaft einer Rechtspersönlichkeit absprechen,
niemandem die Staatsbürgerschaft entziehen, nicht ungerechtfertigte Ver
haftungen vornehmen, nicht foltern. Die Gewährung der positiven Menschen
rechte, im wesentlichen der politischen, ökonomischen, sozialen und kultu
rellen Teilhaberechte, setzt aktives Staatshandeln einschließlich der Bereit
stellung der entsprechenden Ressourcen voraus. Das kann man am Recht auf
Bildung verdeutlichen. Es bedeutet nicht nur, dass niemand willkürlich vom
Besuch von Bildungseinrichtungen ausgeschlossen werden darf, sondern dass
Staaten verpflichtet sind, Schulen in eigener oder fremder Trägerschaft einzu
richten und zu unterhalten.
Menschenrechte der ersten Generation sind die Freiheiten und Schutz
rechte, der zweiten Generation die positiven Teilhaberechte, wie sie z.B. als