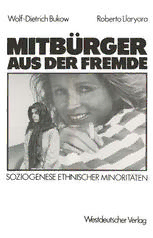Table Of ContentWolf-Dietrich Bukow . Roberto Llaryora
Mitbiirger aus der Fremde
Wolf-Dietrich Bukow . Roberto Llaryora
Mitbiirger aus der Fretnde
Soziog enese ethnischer Minoritaten
Westdeutscher Verlag
Der Westdeutsche Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann.
Aile Rechte vorbehalten
© 1988 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich
geschiitzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzullissig
und strafbar. Das gilt insbesondere flir Vervielfliltigungen, Ober
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter BUrkle, Darmstadt
Satz: Ewert, Braunschweig
TSBN-13: 978-3-531-11876-5 e-TSBN-13: 978-3-322-84199-5
DOl: 10.1007/978-3-322-84199-5
gewidmet Eva und Joanna
INHALT
EINLEITUNG 1
ERSTER TEIL: VONDER "GASTARBEITERFORSCHUNG" ZUR 5
MINORITATENFORSCHUNG
1.1 ZUR FORSCHUNGSLAGE 7
1.2 DIEDIFFERENZHYPOTHESEN 12
1.2.1 Kulturdifferenzhypothese 12
1.2.2 ModernWitsdifferenzhypothese 15
1.2.3 Gemeinsame Ausgangsproblematik 17
1.3 ZUR ENDOGENEN BELANGLOSIGKEIT 20
1.3.1 Irrelevanz interner Differenzierung 20
1.3.2 Zur Toleranzbreite interner Differenzierung 26
1.4 ZUR EXOGENEN BELANGLOSIGKEIT 33
1.4.1 Strukturelle Analogien 34
1.4.2 Zentrum-Peripherie-Variationen 41
1.5 KONSEQUENZEN 46
ZWEITER TEIL: SOZIOGENESE DER ETHNIZITAT 49
2.1 ETHNISIERUNG DES FREMDEN: 51
ANSATZPUNKTE
2.2 SOZIOKULTURELLE BEREITSCHAFf 63
ZUR ETHNISIERUNG
2.2.1 Herrschaft im Alltag 64
2.2.2 Ethnogonie und Ethnogenese 75
2.3 DIE POLITIK DER ETHNISIERUNG 82
2.3.1 1m strukturellen Bereich 84
2.3.2 1m alWiglichen Bereich 99
ANMERKUNGEN 111
zur Einleitung 111
zum ersten Teil 112
zum zweiten Teil 131
LITERAT URVERZEICHNIS 166
STICHWORTVERZEICHNIS 191
EINLEITUNG
Es ist jetzt schon einige Jahre her, daB einer der bekanntesten Ethnologen,
Claude Meillassoux, davor warnte, Arbeitsmigranten vorrangig unter eth
nologischer Perspektive zu sehen.1
"(Es ist) nicht nur eine verfehlte Einsicht in die Realitiit, wenn versucht wird,
Arbeitseinwanderer in ihre EthniziHit einzubinden, vielmehr stehen solche
Versuche in vollkommener Ubereinstimmung mit einer Politik der Nicht
integration von Arbeitseinwanderern und ihren Familien."
Meillassoux kritisiert hier nicht direkt die Ethnologie, sondern die ethnologische
Handhabung der Migrationsproblematik in fortgeschrittenen Industriegesellschaf
ten. In w~itgehender Ubereinstimmung mit der Social anthropology of complex
societies mochte er weg von einer romantisierend-asthetisierenden, ja antiqua
risch anmutenden Einstellung, wie sie nicht nur in dies em Zusammenhang be
klagt wird.3 Bei dieser Einstellung werde der Migrant verkannt, die ihn kenn
zeichnenden Probleme wtirden eher verdeckt als erhellt. Die kritisierte Sichtweise
sei jedoch insofern interessant, als sie eine bestimmte politische Linie des Um
gangs mit dem Arbeitseinwanderer wiederspiegele.
Nun haben wir es im vorliegenden Zusammenhang nicht direkt mit ethnolo
gischen Arbeiten tiber den Migranten zu tun, sondem einerseits mit sozial
wissenschaftlichen und andererseits mit ganz alltaglichen Stellungnahmen. Aber
was Meillassoux kritisiert, gilt erst recht hier. Vielleicht gerade weil es sich nicht
urn ethnologisch fundierte Positionen handelt, treten so etwas wie "Ethnologis
men" auf. Besonders in der Bundesrepublik werden immer wieder ethnische
Eckdaten in ethnologischer Manier zur Grundlage der Diskussion gemacht. Man
behauptet, es seien vor allem die differenten kulturellen Eigenschaften des Mi
granten, die seine Lage in der Bundesrepublik so schwierig machten. Und man
ktimmert sich dann darum, diese differenten kulturellen Eigenschaften zu ver
rechnen.4 Dies geschieht entweder wohlwollend, indem man im "wohlverstan
denen" Interesse des Migranten fUr eine schrittweise Rtickkehr des Wanderers
pladiert, oder tiberheblich, indem man die fremde Kultur zu einer moglichen
Ausgagsbasis degradiert, mitunter wohl auch als mogliches zweites Standbein
des Fremden akzeptiert.
Was Meillassoux kritisiert, und was im Blick auf die Bundesrepublik erneut
bestatigt werden kann,5 war fUr uns der AnstoB dazu, die Situation des Migran
ten emeut aufzurollen. Es ist einfach paradox, wenn moderne sozialwissen
schaftliche Theorien den formal-rationalen Charakter fortgeschrittener Industrie-
-2-
gesellschaften herausarbeiten, andererseits aber in der "Gastarbeiterforschung"
ethnische Besonderheiten zu brisanten Punkten stilisiert werden. Wir waren
deshalb von Beginn an daran interessiert, sowohl die ethnologische bzw.
kulturdifferenzfixierte Analyse zu relativieren, als auch genau diese Analyse im
Sinn eines Bestandteiles des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Migranten zu
verstehen. Bald zeigte sich, daB diese beiden Anliegen in einem Konzept zu
biindeln sind, daB es moglich ist, ein Interpretationsmuster zu formulieren, das
die ganze Problematik in einem erfaBt. Wir haben dieses Interpretationsmuster
mit "ProzeB der Ethnisierung" bezeichnet. Was den Menschen zum Migranten
macht, sind ethnisierende, soziogenetisch zugeschriebene und dementsprechend
individuell realisierte Eigenschaften, die zwar die gesellschaftliche Lage des
Betroffenen verzeichnen, gleichwohl aber eine bestimmte Strategie enthalten, den
Migranten einzuordnen und "real" werden zu lassen.
Man kann, urn es noch deutlicher zu machen, die Situation des Migranten mit der
eines autochthonen Gesellschaftsmitgliedes vergleichen: Der Migrant wird zu
dem, was von ibm erwartet wird, indem er sich nicht Hinger mit seiner historisch
konkreten Existenz, sondern mit einem spezifischen kulturellen Standort identi
fiziert. Das autochthone Gesellschaftsmitglied wird zum Biirger, indem es seine
historisch-konkrete Existenz politisch ernst nimmt und sich nicht Hinger auf eine
rein kulturelle Identitat bezieht. Der ProzeB der Ethnisierung meint eine "kontra
faktische" Vergesellschaftung. Das ist genau der Vorgang, urn den es letztlich
gehen solI. Er solI iiberhaupt erst einmal beschrieben, dann aber auch im gesell
schaftlichen Zusammenhang gedeutet werden.6
Freilich ist es unter diesen Bedingungen nicht einfach, einen angemessenen Zu
gang zur Problematik zu gewinnen. Wir werden zunachst den AnchluB an die
"Gastarbeiterforschung" herstellen und von dort aus die Briicke zur Minoritaten
forschung schlagen. Wenn dabei sehr viel Wert auf praxisbezogene Ansatze
gelegt wird, so hat das mit dem oben formulierten doppelten Anliegen zu tun,
nicht nur eine bestimmte Auffassung zu kritisieren, sondern sie gleichzeitig auch
als Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Strategie zu deuten. Danach
wird es moglich, die vorgesehene neue Linie einzuschlagen, wobei die kritisier
ten Positionen reflexiv einbezogen werden. Dementsprechend wird im zweiten
Teil unser eigentliches Anliegen unter dem Titel "Soziogenese der Ethnizitat"
vorgetragen. Und dort geht es zunachst urn grundlegende Anhaltspunkte, im
AnschluB daran urn die soziokulturelle Bereitschaft zur Ethnisierung. Sind diese
Punkte geklart, ist es einfacher, den ProzeB der Ethnisierung im Sinn eines
politischen Vorganges auf den verschiedenen hier gesellschaftlich bedeutsamen
Ebenen darzustellen. Es wird sich zeigen, daB ein allgemeiner systemisch-okono
misch bedingter Steuerungsbedarf exisitiert, der in gezielten politischen Steue
rungsimpulsen auftritt und gegeniiber den Migranten eingesetzt wird. Das Ergeb-
-3-
nis sind vielfaItige Reaktionen auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft, die
bis hin zum existentiellen Arrangement des Migranten skizziert werden.7
Wir haben uns an dieser Stelle bei vielen zu bedanken. Insbesondere hat uns
Hennes Hess bei dieser brisanten Thematik beraten und unterstiitzt.
ERSTER TEIL
VON DER "GASTARBEITERFORSCHUNG" ZUR
MINORITATENFORSCHUNG
Einer angemessenen Erforschung der Lage "ethnischer Minderheiten", der
Migranten in der Bundesrepublik, stehen zwei auf den ersten Blick vielleicht
tiberraschende Hindemisse im Wege. Es sind die thematische Brisanz und die
interdisziplinare Art der Fragestellung.
Die Brisanz der Thematik ftihrt zu einem sozialpolitischen Handlungsdruck, der
eine langfristig angelegte und von tagespolitischen Interessen freie Reflexion be
hindert. Hier steuem nicht nur die Institutionen, die einerseits Mittel verge ben,
andererseits bestimmte gesellschaftliche Imperative zu vertreten haben, hier wir
ken sich auch Offentliche Interessen unmittelbar aus. Weil die Thematik relativ
stark im gesellschaftlichen BewuBtsein hervortritt, und well infolgedessen immer
auch schon Vorstellungen dartiber bestehen, wie Dinge angesehen waren,
existiert ein ausgepragter Finalisierungsdruck gegentiber der Forschung, der so
ohne weiteres nicht aufzuheben ist1. Auf diese Weise bleiben die die Forschung
leitenden Fragestellungen eng und modisch, spiegeln mitunter sogar die politi
sche Konjunktur bestimmter Einste11ungen wider. AuBerdem handelt es sich eben
urn eine Fragestellung, die ausgesprochen interdisziplinar verlauft. Dies muB
gerade im deutschsprachigen Raum, wo die verschiedenen Wissenschaftsberei
che klar gegeneinander abgegrenzt sind, zu erheblichen Schwierigkeiten ftihren.
So sind in der Tat Konzepte von der Psychologie, Soziologie, Padagogik, Poli
tologie und nicht zuletzt Ethnologie vorgelegt worden, die kaum miteinander
kompatibel sind, obwohl sie ahnliche Fixpunkte verwenden.
Hinzu kommen Stellungnahmen von kleineren, eher praxisorientierten Forscher
gruppen, die zum Teil nur tiber den grauen Markt erreichbar sind, gleichwohl
aber eine erhebliche sozialpolitische Bedeutung erhalten haben.
Man sollte meinen, die Vielfalt der Beitrage, die Unterschiedlichkeiten der
Perspektiven, all das wtirde einen fruchtbaren Forschungsstrom bewirken.
Genau das ist jedoch nicht der Fall, weil gleichzeitig der oben angedeutete
Finalisierungsdruck wirkt, so daB zwar das Bild eines "glasemen Fremden"
entsteht, aber dieses Bild durchaus eindimensional ausfiillt2. Die ethnische
Minoritiit wird unter dem Vorzeichen des Fremdlings, des ethnischen Abweich
lers betrachtet.
Damit ist bereits der Punkt markiert, an dem hier eingehakt werden so11: bei dem
Konzept des "Fremden". Das dahinter verborgene Grundmuster soIl zunachst