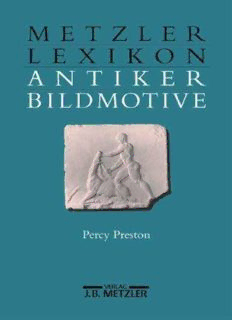Table Of ContentMETZLER LEXIKON
ANTIKER BILDMOTIVE
METZLER LEXIKON
ANTIKER BILDMOTIVE
Von Percy Preston
Übersetzt und überarbeitet
von Stela Bogutovac und Kai Brodersen
Mit Abbildungen von Abgüssen
aus der Mannheimer Antikensaalgalerie
von Stefanie EichZer
Verlag]. B. Metzler
Stuttgart · Weimar
IV
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufuahme
Preston, Percy:
Metzler-Lexikon antiker Bildmotive I von
Percy Preston. Übers. und überarb. von Stela Bogutovac und Kai
Brodersen. - Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1997
ISBN 3-476-01541-6
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
ISBN 3-476-01541-6
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere fiir Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 1997 J. B. Metzlersehe Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Percy Preston, A Dictionary of Pictorial
Subjects From Classical Literature. A Guide to their identification in works of art.
© 1983 Percy Preston
Originalverlag: Macmillan Library Reference, An Imprint of
Sirnon & Schuster Inc., NewYork, NewYork, USA
Einbandgestaltung: Willy Löffelhardt
Satz: Typomedia Satztechnik GmbH, Ostfildern
Druck und Bindung: Franz Spiegel Buch GmbH, Ulm
Printed in Germany
Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar
V
INHALT
Einleitung
Vorwort ...... . VI
Einfiihrung . . . . . VII
Liste der Stichworte XI
Lexikon antiker Bildmotive
von ~Abschied« bis »Zwilling« 1
Anhang
Griechische Namen und ihre römischen Entsprechungen 234
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Werke antiker Literatur 235
Ausgaben und Übersetzungen der zitierten antiken Werke 239
Weiterführende moderne Literatur 245
Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
VI
VORWORT
Welche Mythen und Legenden, welche Personen und Szenen der Antike sind auf einem
Kunstwerk dargestellt? Wie lassen sich literarische Vorlagen des Künstlers ermitteln, wenn wir
nur das Kunstwerk kennen? Antworten auf Fragen dieser Art sucht das vorliegende Werk zu
geben. Sein Verfasser, Percy Preston (28.6.1914-11.6.1989), hat an der Princeton University
Kunstgeschichte und an der Columbia University Altertumswissenschaft studiert und war 35
Jahre lang Lehrer für antike Sprachen und ftir die Kultur des Altertums an der angesehenen St.
Paul's School in Concord, New Hampshire, USA. Das hier in einer von uns überarbeiteten
Übersetzung vorgelegte Werk stellt die Summe seiner Erfahrungen dar; mit welchem Engage
ment und welcher Liebe zu seinem Thema er dabei vorgegangen ist, bezeugt jede Seite aufs
Neue.
Zu diesem Buchprojekt hatte den Autor, wie er schreibt, Professor Rensselaer W. Lee
ermuntert, Anregungen hatte er von John R. Martin und W. Robert Connor (Princeton),
Frances E Jones (Princeton Art Museum), Charles Scribner III. und den Mitarbeitern der
Marquand Library sowie der Firestone Library erhalten. Für die amerikanische Erstausgabe im
Verlag Charles Scribner's Sons in New York hatten ihm Charles Scribner Jr. und Jacques
Barzun Rat und Hilfe bei Auswahl und Präsentation des Materials gegeben, Lynda Emery
hatte sich um die Schreibarbeiten, Marshall De Bruhl und Janet Hornberger um die Her
stellung sowie insbesondere Christiane Deschamps um das Lektorat verdient gemacht.
Die deutsche Ausgabe verdankt ihre Entstehung der Initiative und dem Engagement von
Oliver Schütze vom Verlag J.B. Metzler in Stuttgart. Wir haben uns bemüht, die Nützlichkeit
des Originals als Nachschlagewerk durch ausführlichere Stellenangaben, vermehrte Quer
verweise und einen völlig neu erarbeiteten Anhang zu erhöhen.
Alle Abbildungen stammen aus der Antikensaalgalerie im Mannheimer Schloß, die vom
Archäologischen Seminar der Universität Mannheim betreut wird; dessen Leiter, Reinhard
Stupperich, danken wir für die Abbildungserlaubnis, Stefanie Eiehier ftir die Herstellung der
Photographien, die eigens für diese Ausgabe angefertigt worden sind; unterstützt wurde sie
dabei dankenswerterweise von Nicole Albrecht und Stefan Eichler. Wiedergegeben sind
ausschließlich neuzeitliche Abgüsse antiker Kunstwerke, die in Mannheim seit der Barockzeit
gesammelt und der interessierten Öffentlichkeit präsentiert wurden und heute in der Universi
tät im Mannheimer Schloß zugänglich sind. Sie zeugen vom vielfältigen Nachleben der
Bildwerke aus dem Altertum und somit von einer lebendigen Tradition antiker Bildsymbole,
deren Identifizierung das vorliegende Buch allen an der Antike und ihrem Nachleben
Interessierten erleichtern will.
Institut für Altertumswissenschaft und Klassische Tradition der Universität Mannheim,
im Frühjahr 1997
Stela Bogutovac Kai Brodersen
VII
EINFÜHRUNG
Dieses Buch verdankt seine Entstehung meiner Tochter. Ihr war aufgefallen, daß es an einem
Nachschlagewerk mangelt, das allen, die sich ftir antike Bildmotive in der Kunst von der
Antike bis in die Gegenwart interessieren, die Identifizierung jener Motive erleichtert. Sie
arbeitete damals an einem Museum und war mit einem Gemälde des 16. Jahrhunderts im Stil
des Paolo Veronese befaßt, das unter dem Titel »Apollo und Daphne« katalogisiert war, aber
etwas anderes dars~ellte, als der Mythos ihrer Erinnerung nach besagte. Neugierig geworden
suchte sie in den Bibliotheken von Boston und Cambridge/Mass. nach Informationen, doch
da sie keine der dargestellten Figuren namentlich identifizieren konnte, halfen ihr die üblichen,
nach antiken Namen geordneten Nachschlagewerke zur antiken Mythologie nicht weiter. Sie
ahnte aber, daß es sich um eine Szene handeln könnte, die in Ovids Metamorphosen
beschrieben sein könne, las dieses Werk und stieß wirklich im zehnten Buch auf eine Passage,
in der die Geburt des Adonis beschrieben wurde - was genau zu der Darstellung auf dem Bild
paßte.
Die richtige Antwort hatte meine Tochter also doch gefunden; wäre aber die antike Vorlage
nicht zufällig tatsächlich Ovid gewesen, hätte sie vergeblich gesucht. Sie sagte mir - als
jemandem, der lange als Lehrer ftir antike Sprachen und ftir die Kultur des Alterturns tätig
gewesen war und der auch eine gewisse Erfahrung mit der Kunstgeschichte hatte -, wie
interessant und nützlich es sein könne, wenn Probleme von der Art, wie sie sie gerade erlebt
hatte, durch ein Nachschlagewerk gelöst werden könnten.
Mein Interesse war sogleich wachgerufen. Der erste Schritt bestand natürlich darin,
herauszufinden, ob es ein solches Werk bereits gebe, etwa als Nebenprodukt der deutschen
Lexikographie. Meine Recherchen in Bibliotheken und Nachfragen bei Kunsthistorikern,
Alterturnswissenschaftlern und anderen Gelehrten ftihrten mich zu der Meinung, daß ein
solches Buch noch nicht vorgelegt worden sei, aber willkommen wäre.
Sodann stellte sich die Frage, wie man ein Werk dieser Art erstellen könnte: Die Mythen
und Legenden des Altertums mußten so präsentiert werden, daß jeder, der ein auf antiken
Stoffen beruhendes Kunstwerk betrachtet, dUJch Nutzung dieses Buches ermitteln kann, wer
oder was auf dem Bild dargestellt ist und bei welchem antiken Autor man mehr über die
dargestellte Szene lesen kann.
Daraus ergab sich, daß ein Verzeichnis benötigt wird, das die jeweiligen Besonderheiten bei
der künstlerischen Wiedergabe antiker Mythen und Legenden verzeichnet, ohne daß der
Betrachter den Namen dieser Figur kennen muß. Zu beschreiben waren vielmehr die
grundlegenden spezifischen Merkmale einer Figur oder die besonderen Aktivitäten einer Figur
in der jeweiligen Szene. Kurz: Die Stichworte sollten keine Eigennamen sein, sondern
vielmehr Begriffe wie »Axt«, »Bär«, »Essen« oder »Krieger«.
Freilich ließ sich angesichts der riesigen Zahl von Kunstwerken, in denen von der Antike bis
in die heutige Zeit antike Mythen und Legenden dargestellt sind, ein solches Verzeichnis nicht
durch deren Betrachtung und Auswertung erstellen (auch der jüngste solche Versuch, das im
Anhang genannte große Werk von Jane Davidson Reid, mußte sich auf die Kunst seit dem 14.
Jahrhundert beschränken). Vielmehr bot es sich an, einmal von dem anderen Medium
auszugehen, nämlich von der antiken Literatur, in der die Mythen und Legenden tradiert sind.
EinfOhrung VIII
Ich habe also diese Literatur gelesen, im Hinblick auf bildlich darstellbare Szenen ausgewertet
und die jeweils markanten Begriffe dann zu Stichworten in diesem Buch gemacht.
Als Beispiel dafür, wie man das Buch benutzen kann, mag das eingangs erwähnte, falschlieh
als »Apollo und Daphne« bezeichnete Gemälde dienen. Dargestellt sind hier drei Frauen, von
denen eine ein Baby hält, während sich die beiden anderen sehr für das Kind interessiert
zeigen. Hinter ihnen steht ein Baum, in dessen unterem Teil man den Oberkörper einer Frau
ausmachen kann. Für die Identifizierung sind nun sicher Stichworte wie »Baby« oder »Baum«
nützlicher als »Frau« oder »Mann«, da erwachsene Menschen den Großteil der Bildmotive
ausmachen und in den meisten Fällen keine spezifischen Merkmale aufWeisen. So finden wir
im vorliegenden Buch beim Hauptstichwort »Baby« Unterstichworte über die verschiedenen
Umstände, in denen Babies dargestellt werden können, etwa »Geburt« oder »von Mutter oder
Amme gehalten«. Unter »Geburt« finden wir nun den von Ovid erzählten Mythos verzeich
net, daß Adonis von einem Baum geboren wird, in den die schwangere Myrrha (Smyrna)
verwandelt worden war - was den Baum in unserer Szene erklärt. Zu demselben Ergebnis
kommen wir, wenn wir in der Darstellung der Frau in jenem Baum eine Verwandlung
vermuten und unter dem Hauptstichwort »Baum«, Unterstichwort »Verwandlung in einen
Baum« nachschlagen. Und wenn wir statt dessen bis zur Angabe »Geburt: Adonis« weiterlesen,
finden wir noch eine weitere, von Ovids Angaben abweichende Darstellung.
Das Thema des Bildes ist damit also geklärt; um nun aber auch die Namen der drei Frauen
und die wundersamen Umstände der Szene zu ermitteln, müssen wir den angegebenen
Belegen in der antiken Literatur nachgehen oder zumindest eines der üblichen Mythologie
Lexika zur Hand nehmen, wie sie der Anhang verzeichnet. (Im übrigen sind die nach ihrer
Bedeutung für die Interpretation, nicht nach der Chronologie ihrer Entstehung angeordneten
Belege in der antiken Literatur auch selten die einzigen Schilderungen der jeweiligen Szene,
doch wird jedenfalls die Weiterarbeit mittels der angegeben Quellen oder über Lexika
erleichtert.) So erfahren wir, daß Lucina bei der Geburt half und daß das Baby in die Obhut
der Najaden gegeben wurde, was die Darstellung auf dem Bild erklärt; wir erfahren auch,
warum Myrrha schwanger und in einen Baum verwandelt worden war.
Die Hauptstichworte bezeichnen also besonders markante Darstellungsmerkmale, die Un
terstichworte konzentrieren sich dann in der Regel auf das, was an einer Szene oder
Szenengruppe für eine bildliehe Darstellung spezifisch ist. Wo dies - wie etwa bei »Boot«,
»Himmelfahrt« oder »Zentaur«-nicht möglich oder nötig war, sind die Unterstichworte nach
den Namen der Hauptbeteiligten angeordnet; im Zweifelsfall muß man in diesen Fällen also
den ganzen Artikel zum Hauptstichwort lesen.
Im übrigen kann das Buch auch alljenen von Nutzen sein, die Themen wie »die Zentauren
im Mythos« oder »die Symbolik der Schlange« bearbeiten; hier nämlich finden sich rasch
vielerlei Belege in der antiken Literatur, mittels derer die Weiterarbeit erleichtert wird.
Gelegendich vermag das Buch auch zur Klärung einer Anspielung-etwa auf ein »Prokrustes
Bett«- dienen. Und nicht zuletzt kann man dem Buch auch manch vergessenen Namen in
einer unvergessenen Szene entnehmen; wer sich also vage an den Mythos erinnert, daß ein
König Eselsohren bekam, oder den, daß eine Frau einen goldenen Apfel in eine Hochzeits
gesellschaft warf und damit die Ereignisse veranlaßte, die zum Trojanischen Krieg führten,
findet hier die entsprechenden Namen und Belegstellen in der antiken Literatur.
Die gesamte griechische und lateinische Literatur zu Mythen und Legenden von Homer
und Hesiod bis zu den Grammatikern und Mythographen des Mittelalters vollständig auszu
werten, wäre freilich nicht praktikabel gewesen. Ich habe mich daher auf die wichtigen Werke
der griechischen Klassik und der frühen römischen Kaiserzeit konzentriert, aber auch spätere