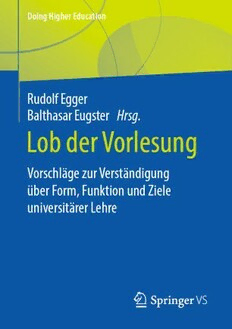Table Of ContentDoing Higher Education
Rudolf Egger
Balthasar Eugster Hrsg.
Lob der Vorlesung
Vorschläge zur Verständigung
über Form, Funktion und Ziele
universitärer Lehre
Doing Higher Education
Reihe herausgegeben von
Rudolf Egger, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, Österreich
Tobina Brinker, Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik, Fachhochschule Bielefeld,
Bielefeld, Deutschland
Balthasar Eugster, Hochschuldidaktik, Universität Zürich, Zürich, Schweiz
Jan Frederiksen, Institut for Medier, Erkendelse & Formidling, Københavns
Universitet, Kopenhagen, Dänemark
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/16187
Rudolf Egger · Balthasar Eugster
(Hrsg.)
Lob der Vorlesung
Vorschläge zur Verständigung
über Form, Funktion und Ziele
universitärer Lehre
Hrsg.
Rudolf Egger Balthasar Eugster
Karl-Franzens-Universität Graz Universität Zürich
Graz, Österreich Zürich, Schweiz
ISSN 2524-6380 ISSN 2524-6399 (electronic)
Doing Higher Education
ISBN 978-3-658-29048-1 ISBN 978-3-658-29049-8 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29049-8
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt
sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Planung/Lektorat: Stefanie Laux
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
„Also was ich sehe, ist, dass zu viele Studierende sich heute schon sehr schwer
auf ein Thema einlassen können. Ich mache das jetzt also doch schon fast
30 Jahre und da hat es das also immer auch schon gegeben, das ist klar. Aber
ich merke das auch bei den Arbeiten und den Diskussionsbeiträgen, also das
Einlassen auf das Handwerkszeug der Wissenschaft und auch auf Ideen ist
geschwunden. Ich sage das jetzt einfach einmal so, dass das nicht nur ein
hierarchisches Problem ist oder dass ich älter geworden bin. Aber heute glauben
viele Studierende, dass sie nicht mehr zuhören müssen, weil sie das ohnehin im
Netz finden.“ (Soziologin)
„Was ich hier feststelle, ist, dass das schon als studierendenzentriert und
damit als gut bezeichnet wird, wenn man was Allgemeines abfragt oder einfach
Meinungen abholt. Das bleibt dann alles irgendwo im luftleeren Raum hängen
und da entsteht keine Erkenntnis für mich, keine Zuspitzung oder eine zu dis-
kutierende These oder auch eine Ahnung davon, wie das eigene theoretische Herz
hier schlägt.“ (Physiker)
Das sind zwei Ausschnitte aus Interviews mit Lehrenden an Universitäten,
die stellvertretend für viele KollegInnen die Veränderungen der konkreten
Bezugnahme der Studierenden auf die Vermittlungsabsichten der Lehrenden
ausdrücken. Was hier angesprochen wird, ist einerseits die Rolle der Wissens-
weitergabe an Studierende durch die ausgedehnte Nutzung digitaler Medien
und deren Auswirkungen in der „Informationsbeschaffung“ von Studierenden.
Andererseits wird aber die Studierendenbezogenheit der Lehrenden selbst
thematisiert, wenn grundlegende Fähigkeiten zur Reflexion, zur begrifflichen
Klarheit im akademischen Alltag in einer „Neuformulierung“ des Vermittlungs-
auftrages verschwinden. Zur Disposition gestellt werden dabei nicht nur die Rolle
der Lehrenden, sondern auch die wichtigsten Kernelemente hochschulischen
V
VI Vorwort
Lehrens und Lernens: die Begriffsbildung und das kritische Denken. Beide
Bereiche sind überaus voraussetzungsvoll. Zum einen geht es dabei um die Wahr-
nehmung von Autorität (nicht um Macht), die Lehrende brauchen, um Lernende
dabei zu unterstützen, sich auszubilden, indem sie den Weg der Erkenntnis dazu
nutzen, um Bedeutungen interpretieren zu können. Dazu bedarf es zum anderen
nicht bloß der „richtigen“ Informationen oder der Texte, sondern der Begriffe.
Begriffe sind im Wissenschaftssystem aber stets analytische Werkzeuge, die uns
etwas darzustellen erlauben (Strukturen, Zusammenhänge), was ohne sie auf
diese Weise unsichtbar wäre. Diese Begriffsarbeit trägt oft zur Unsicherheit und
zur Frustration von Studierenden bei, da sie diese Arbeitsmittel fälschlicherweise
als abgehobene Fremdbestimmungsinstrumente verstehen, ohne deren unerläss-
liche Bedeutung für alle Vorgänge zu verstehen, wo wir forschend in die Welt ein-
greifen. Die Frage dabei ist, wie diese (fach)wissenschaftliche bzw. disziplinäre
Orientierung am besten zu fördern ist und wie viel an (und auch welche Art von)
Vermittlung Studierende „vertragen“, um das Erkannte wieder der Korrektur
durch die Wahrnehmung oder die Erfahrung auszusetzen. Weitergedacht geht es
auch darum, zu bestimmen, welche Legitimität und Sinnhaftigkeit die klassische,
methodisierte Form der Vorlesung innerhalb der Verbindung von Erkenntnis,
Wahrnehmung und Erfahrung haben kann.
Die Vorlesung war bis weit in das 20. Jahrhundert jene akademische Lehrform,
die die Entwicklung des universitären Selbstverständnisses auf ihrem höchsten
Niveau repräsentierte. Die dahinterstehende formal postulierte „Gemeinschaft
von Lehrenden und Lernenden“ (universitas magistrorum et scholarium) stellte
auf eine idealisierte Lehr-Lern-Beziehung ab, die geprägt war von Autorität und
einem dauerhaften akademischen Habitus. Auch wenn sich das Konzept „Uni-
versität“ von der mittelalterlichen universitas über die Neuzeit bis zum Neu-
humanismus des frühen 19. Jahrhunderts wesentlich veränderte, blieb die
Vorlesung als Lehrformat der Institution Universität in wesentlichen Zügen
erstaunlich stabil. Erst die sogenannte Studentenbewegung des letzten Jahr-
hunderts hat mit ihrer Infragestellung ideologisch abgesicherter Postulate und
Autoritätsbezüge, aber auch mit ihren gesellschaftspolitischen Forderungen
nach persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Mündigkeit durch Bildung die
traditionellen Formen universitären Lehrens und Lernens fundamental infrage
gestellt. Studierende werden seitdem unmittelbarer als Akteure im universitären
Geschehen sichtbar und ihre Bedürfnisse nach kritischer Weltaneignung und
kommunikativen Beziehungsstrukturen (zumindest formal) besser wahr-
genommen. Diese Bemühungen haben die Mitbestimmungsrechte und die
Lehrstrukturen der Universitäten grundlegend verändert, wobei sich die tat-
sächliche Zuwendung zum „studierenden Subjekt“ z. B. in den seminaristisch
Vorwort VII
ausgerichteten Lehrveranstaltungen an den Universitäten doch recht unter-
schiedlich entwickelt hat. Historisch betrachtet haben sich die „neuen“ Formate
und Inhalte universitärer Lehre großteils recht bald widerspruchslos in die alten
Strukturen der Universität integriert. Die gängigen studentischen Mitbeteiligungs-
formen wurden und werden vielfach als Präsentationsmarathons von Referaten
abgehalten. Nach den gesellschaftspolitisch und wissenschaftskritisch orientierten
Zielen in den 1970er-Jahren sind es heute vor allem „studientechnische“ Gründe,
die die Bedeutung der Vorlesung bestimmen. Dies hat einerseits mit einer
pädagogischen Haltung der „verantwortungsvollen“ Wissensvermittlung zu tun,
andererseits ist sie aber auch vor allem in den durch einen regen Studierenden-
zuspruch geprägten Studiengängen eine zentrale Form, wie mit geringen
finanziellen Mitteln viele Studierende „betreut“ werden können. Bildungsöko-
nomisch gesehen, ist die Vorlesung in diesem Sinne ein überaus gewichtiges
Format. Dennoch steht die Vorlesung heute aus verschiedenen – insbesondere
pädagogischen – Gründen erneut auf dem Prüfstand. Die wichtigsten Bedenken
lassen sich kurz zusammenfassen.
Einmal sind es didaktische Vorbehalte, die die Studierenden zu stark in eine
passive Rolle gezwängt sehen, während die Lehr-Lern-Forschung seit Jahren
Lernen als einen aktiven Prozess ausweist. Vorlesungen verstärken dadurch
auch die Anonymität in der Massenuniversität, mindern die Motivation, da hier
kaum Chancen zur Entwicklung von Selbstorganisationsprozessen des Lernens
bestehen können. Stattdessen werden Prozesse des Konsumierens und der
Rezeptivität gefordert und gefördert, die spärlich Gelegenheiten zu sozialem
Lernen bieten. Demgegenüber stehen heute Forderungen, wonach Lernende vor
allem zur Entwicklung von individuellen Lern- und Suchbewegungen angeregt
werden sollen. Im Mittelpunkt soll dabei eine Ermöglichungsdidaktik stehen, die
sich deutlich von der bisherigen „Belehrungsdidaktik“ unterscheidet und die zum
Ziel hat, Kompetenzen im direkten Praxisbezug mittels Coaching und Mentoring
selbstorganisiert in emotionsaktivierenden, motivationsschaffenden Erkenntnis-
und Erfahrungsformen aufzubauen.
Ein weiterer Baustein ist der seit Jahren propagierte Begriff des „Shift from
Teaching to Learning“, der betont, dass der geforderte Übergang vom Lehren hin
zum Lernen zu einem „besseren Output“ bei Studierenden führt. Die Intention
dabei ist eine möglichst lückenlose Verzahnung zwischen Lehrzielen, Lehrhand-
lungen und den Prüfungsformen hin zu Learning Outcomes nach dem Prinzip des
Constructive Alignment.
Diese Bestrebungen werden großflächig von den forcierten Digitalisierungs-
strategien der Universitäten gerahmt, die durch mediale Begleitung Lernräume
(„Ermöglichungsrahmen“) gestalten sollen, in denen die oben genannten aktiven
VIII Vorwort
Suchbewegungen und Problemlösungen selbstgesteuert und individuell mit Sinn
belegt, geübt und verinnerlicht werden. Hier sind die elektronischen Möglich-
keiten gesamtgesellschaftlich gesehen dabei, jegliche Form des Unterrichtens der-
gestalt zu verändern, dass Lernende prinzipiell zu mehr unmittelbaren Aktivitäten
geführt werden sollen, weil damit Möglichkeiten der Vernetzung mit dem Stoff,
den Lehrenden und unter Studierenden in ungeahnt reichhaltiger Form geschaffen
werden können. Das Format der Vorlesung als Möglichkeit der Präsentation von
Informationen soll dabei gänzlich vorgefertigten Podcasts u. dgl. weichen, um die
gemeinsame Präsenz im Hörsaal besser zu nutzen.
Das alles sind Gründe, die neben den althergebrachten Vorwürfen (Vor-
lesungen als Gehäuse autoritärer Hörigkeit, als Motivationsbremsen, als Schlaf-
mittel u. dgl.) dieses Format als zumindest veränderungswürdig, wenn nicht gar
als überholt bezeichnen. Trotz dieser weit verbreiteten Bedenken stellt sich aber
die Frage, ob es (neben den erwähnten bildungsökonomischen Veranlassungen)
weitere hochschuldidaktische und wissenschaftssozialisatorische Beweggründe
gibt, die Bedeutung und Möglichkeitsräume der Vorlesung einer erweiterten
Diskussion zu unterziehen. Kann die Vorlesung mit ihrer weiterhin großteils
asymmetrischen und monologischen Form, mit ihrer meist starr vorgegebenen
Rollenverteilung den heute vielfach geforderten Veränderungen entsprechen?
Ziel dieses Sammelbandes ist es zu klären, wie eine hochschul- und wissen-
schaftsdidaktisch schlüssige Verbindung von Lehren und Lernen, Lehr- und
Lernhandlungen aussehen kann und welche Rolle die Vorlesung in ihren ver-
schiedenen Ausprägungen hierbei spielen kann: eine Bestandsaufnahme der
Stärken und Schwächen des Status quo der Vorlesung, eine Vergewisserung,
welche empirischen und didaktischen Befunde es dazu gibt, eine Erkundung der
Optionen und Handlungsszenarien für eine mögliche (Neu-)Positionierung und
schließlich Vorschläge, angesiedelt zwischen dem pädagogisch, hochschul- und
wissenschaftsdidaktisch Wünschenswerten, dem wissenschaftlich Gesicherten
und dem realpolitisch Machbaren. Die Texte des Sammelbandes sollen – in
einer dezidierten Gegenbewegung zu technokratischen, aktivistischen und
postulatorischen Ansätzen – versuchen, die Spannungsverhältnisse aufzugreifen,
zu untersuchen und begrifflich wie empirisch gehaltvoll auszuleuchten, die
sich zwischen den Ansprüchen der Vorlesung als didaktischem Format und den
Antworten der lernenden und lehrenden Subjekte, der Beharrlichkeit der uni-
versitären Struktur und den prinzipiellen Aktivitätsmodi der Medien ergeben.
Es gilt, den Blick darauf zu schärfen, wie die Appelle und Chancen einer Lehre
ohne Belehrung zu welchen hochschul- und wissenschaftsdidaktischen Möglich-
keiten führen. Welcher tatsächliche Shift entsteht hochschulspezifisch durch
die geforderte Wende in der Lehre, die sich vor allem durch die inflationäre
Vorwort IX
Verwendung von Adjektiven wie konstruktivistisch, studierendenorientiert, aktiv,
offen, partizipativ etc. charakterisieren lässt? Welche Wege eröffnen sich dabei,
welche verschließen sich – und: verschwindet die Vorlesung innerhalb der uni-
versitären Lehr- und Lernprozesse tatsächlich oder wird sie bildungs- und wissen-
schaftsspezifisch neu justiert?
Konkret setzen sich die einzelnen Beiträge dabei mit folgenden Inhalten aus-
einander:
Der Aufsatz von Christiane Bender beschäftigt sich eingangs damit, „Aspekte
des Wandels der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden in der Geschichte
der Vorlesung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland“ aufzu-
zeigen, wobei drei unterscheidbare bildungspolitische Phasen den Lehrbetrieb
rahmen und die Beziehungen zwischen Studierenden und ihren Professoren bis
heute prägen.
Maximilian Schuh rekonstruiert in seinem historisch ausgerichteten Bei-
trag „Rhetorikvorlesungen an der spätmittelalterlichen Universität. Wissensver-
mittlung zwischen Autoritätentexten und studentischer Lebenswirklichkeit“ die
Bedeutung dieses Veranstaltungstyps im ausgehenden Mittelalter und zeigt die
lebensweltliche Orientierung des Unterrichts im spätmittelalterlichen Hörsaal.
Peter Tremp zeigt ebenfalls anhand von historischen Beispielen anschaulich,
wie „Vorlesungskritik als Universitätskritik“ verstanden und wie die Rolle der
Universität heute darin bestimmt werden kann.
Alberto Gil beschreibt in seinem Beitrag mit dem Titel „Die Vorlesung
im Kontext der Universität als Gemeinschaft. Zur Interrelation von Rhetorik
und Hochschuldidaktik“ die Möglichkeiten universitärer Vorlesungen als
Kommunikationsakte jenseits von gängigen manipulatorischen Prinzipien.
Gabi Reinmann klärt in ihrem Aufsatz „Die Vorlesung in der Hochschul-
didaktik“ Begründungen dafür, wie der eigentliche Zweck der Vorlesung in ver-
schiedenen Disziplinen wiederzufinden oder neu zu erfinden ist.
Das AutorInnenteam Alexander Renkl, Alexander Eitel und Inga Glogger-Frey
geht im Aufsatz mit dem Titel „Die Vorlesung – nur schlecht, wenn schlecht vor-
gelesen: Warum eine gut gemachte Vorlesung einen Platz im Methodenrepertoire
verdient“ der Frage nach, wie die Realisierung von guten Vorlesungen gelingen
kann und welches didaktische Wissen hierzu notwendig ist.
In seinem Beitrag mit dem Titel „Schweigen, zuhören, kritisch weiterdenken.
Vorlesungen und die Wissenschaftlichkeit wissenschaftlichen Wissens“ geht es
Balthasar Eugster um eine differenzierte Darstellung der vielfältigen Wirkungs-
zusammenhänge in Vorlesungen sowie um einen didaktisch fundierten Ansatz der
Wissenschaftsforschung.