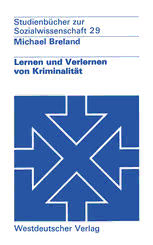Table Of ContentMichael Breland
Lernen und Verlernen
von Kriminalität
Ein lernpsychologisches Konzept der Prävention im
sozialen Rechtsstaat
Westdeutscher Verlag
Fritz Bauer (1903-1968) gewidmet
© 1975 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
C. Berte1smann, Vertretung für Wien, Gesel1schaft mbH
Umschlaggestaltung: studio für visuel1e kommunikation, Düsseldorf
Satz: Friedr. Vieweg, Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfaltigung des
Werkes (Fotokopie, Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vor
herigen Zustimmung des Verlages.
ISBN 978-3-531-21324-8 ISBN 978-3-322-85857-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-85857-3
Studienbücher zur Sozialwissenschaft Band 29
Michael Breland
Lernen und Verlernen von Kriminalität
Inhalt
Vorwort: Für ein lernzielorientiertes Strafrecht . . . . . . . . .. 9
1. Priivention als Forschungsobjekt ......... . 13
1.1. Feuerbach : Die Theorie des psychologischen
Zwanges der Strafdrohung .. . . . . . . . . . . . . . .. 13
1.2. Die heutige Situation: Schuldstrafe mit
Abschreckungszweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
1.2.1. Rechtsprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
1.2.2. Lehre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
1.2.3. Kritik von Rechtsprechung und Lehre ......... 20
1.3. Prävention: ein sozialpsychologisch ungelöstes
Problem ............................. 23
1.3.1. Allgemeines Strafrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23
1.3.2. Wirtschaftsstrafrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25
2. Ansätze empirischer orientierter Priiventionsforschung 28
2.1. Allgemeine Überblicke. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
2.1.1. Das Präventionskonzept der Polizei ........... 28
2.1.2. Präventionsforschung in Staaten mit marxistisch-
leninistischer Staatskonzeption (insb. DDR) ..... 29
2.1.2.1. Zusammenfassung ....................... 37
2.1.3. "Deterrence"-Forschung in den USA .......... 38
2.2. Einzelne Forschungsarbeiten . . . . . . . . . . . . . . .. 46
2.2.1. Schwartz/Orleans: On Legal Sanctions . . . . . . . .. 46
2.2.2. Kaiser: Verkehrsdelinquenz und Generalprävention . 48
2.3. Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
3. Die psychologische Lerntheorie als Theorie der
Prävention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.1. Erklärungskonzepte delinquenten Verhaltens. . . .. 52
5
3.1.1. Soziologische Kriminalitätstheorien . . . . . . . . . .. 52
3.1.1.1. Die Anomie-Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52
3.1.1.2. Die Labeling -Theorie ................ 54
3.1.2. Die psychoanalytische Erklärung dissozialen
Verhaltens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1.3. Die Lerntheorie: Delinquenz als erlerntes Verhalten 58
3.2. Grundlagen der Lernpsychologie . . . . . . . . . . . 60
3.2.1. Reaktives und operantes Verhalten ......... 60
3.2.2. Operante Konditionierung (Lernen am Erfolg) . . .. 60
3.2.2.1. Die Funktion des Verstärkers . . . . . . . . . . . . . .. 62
3.2.2.2. Primäre und sekundäre Verstärker . . . . . . . . . . .. 65
3.2.2.3. Motivation ........................... 66
3.2.2.4. Die Rolle der Mitwelt bei der operanten Konditio-
nierung .............................. 69
3.2.3. Beobachtungslernen (Lernen am Modell) . . . . . . .. 70
3.2.3.1. Stellvertretende Verstärkung. . . . . . . . . . . . . . .. 70
3.2.3.2. Weitere Bedingungen für das Nachahmen des
Modells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.2.3.3. Die Bedeutung des Beobachtungslernens für die
Analyse wirtschaftskriminellen Verhaltens. . . . . 72
3.3. Prävention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75
3.3.1. Allgemeines Strafrecht ............ . 75
3.3.1.1. Prävention und Strafe .............. . 75
3.3.1.2. Die Voraussetzungen präventiver Verhaltens
konditionierung . . . . . . . . . . . . . . . . .... 79
3.3.1.3. Der optimale aversive Stimulus . . . . . . . . . . 80
3.3.1.4. Soziale Verhaltenskonditionierung ............ 83
3.3.1.4.1. Spezialprävention ....................... 83
3.3.1.4.2. Generalprävention ...................... 84
3.3.2. Wirtschaftsstrafrecht (insb. : der Begriff der
Wirtschaftskriminalität) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
4. Wirtscbaftsstrafrecbt: Der optimale aversive
Stimulus . ......................... . 90
4.1. Wirksame Gesetzgebung. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90
4.2. Wirksame Delinquenzermittlung ...... 93
4.2.1. Die gegenwärtige Situation (Beispiel Steuer-
strafrecht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94
6
4.2.1.1. Betriebsprüfungsstatistik .................. 95
4.2.1.2. Steuerstrafsachenstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
4.2.1.3. Interpretation und Wertung der mitgeteilten Daten. 98
4.2.2. Die Bedingungen wirksamer Delinquenzermittlung . 101
4.3. Wirksame Sanktionen: eine empirische Studie .... 104
4.3.1. Die Konkretisierung der Forschungsfrage ....... 104
4.3.2. Die Entwicklung des Fragebogens ............ 108
4.3.3. Die Bildung der Stichprobe ................. 110
4.3.4. Rücklaufquote ......................... 112
4.3.5. Text und statistische Auswertung der Fragen ..... 112
4.3.5.1. Text und Häufigkeitsauszählung ............. 113
1. Einfache Häufigkeitsauszählung ............ 113
2. Überblick über die einfache Häufigkeits-
auszählung .......................... 130
3. Bedingte Häufigkeitsauszählung ............ 131
4.3.5.2. Korrelationenanalyse ..................... 133
4.3.5.3. Faktorenanalyse ........................ 135
4.3.6. Das rechtspolitische Ergebnis der Befragung ...... 142
5. Wirtschaftsstrafrecht: Soziale Verhaltens-
konditionierung ........................ 147
5.1. Spezialprävention .. . .... 147
5.2. Generalprävention ........... . . .... 151
Anmerkungen ...... . . .156
Literaturverzeichnis .,. . . 167
Anhang zum Literaturverzeichnis .................... 174
Sachregister .................................. 175
7
Vorwort: Für ein lernzielorientiertes Strafrecht
Die These dieser Arbeit lautet: Dissoziale (insb. kriminelle) Ver
haltensweisen sind wie die meisten anderen Verhaltensweisen er
lernt und können durch bewußte und gezielte Anwendung der Lern
gesetze verlernt werden. Das klingt einfach und man erwartet durch
führbare Anweisungen zur Verminderung von Kriminalität. Der
artige Vorschläge können auf der hier dargelegten lernpsychologi
schen Grundlage auch tatsächlich in begrenztem Ausmaß entwickelt
werden. Dies geschieht in der vorliegenden Arbeit am Beispiel der
Wirtschaftsstraftaten gegen Gemeineigentum, also z. B. Steuerhinter
ziehung, Subventionsbetrug, Betrug im Zusammenhang mit der Ver
gabe öffentlicher Aufträge. Derartige konkrete Ratschläge dürfen
jedoch nicht den Blick darauf verstellen, daß ihre Verwirklichung
im Rahmen des traditionellen Strafrechtssystems nur zu mehr
Aktionismus führt und nicht den gewünschten Erfolg haben kann.
Wie ist das zu verstehen? Die Entwicklung der Strafrechtstheorie
in den vergangenen 150 Jahren ist vor allem dadurch gekennzeich
net, daß neue und liberale Ansätze, wo sie nicht verhindert werden
konnten, begrifflich integriert wurden ohne daß damit eine wesent
liche Veränderung der alten Strafziele verbunden gewesen wäre.
Das hat im Laufe der Zeit zu einem Sammelsurium von "Straf
zwecken" geführt, deren innere Unvereinbarkeit die Strafrechts
praxis - wie es scheint - ein für allemal verdrängt hat. So heißt es
etwa in einem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom
12. Okt. 1971 (amt!. Sammlung Bd. 32, S. 48): "Die Kriminalstrafe
dient neben der Abschreckung und Besserung der Vergeltung; sie
bemißt sich nach dem normativ festgelegten Wert des verletzten
Rechtsgutes und dem Maß der Schuld". Es gibt keine rationale
Theorie, die alle diese "Zwecke" noch in einen sinnvollen Zusam
menhang bringen könnte. Die psychologische Lerntheorie ist es am
wenigsten; sie kann - wie in dieser Arbeit dargelegt wird - nur
wirksam werden, wenn die Abschreckungs-, Vergeltungs-und
Schuldstrafe der rechtsgeschichtlichen Vergangenheit angehören.
Der hier entwickelte lernpsychologische Ansatz für die Präven
tion dissozialen Verhaltens bricht aber nicht nur mit den tradi
tionellen Strafrechtszielen, sondern steht im Ergebnis auch in be
wußtem Gegensatz zu stagnierenden liberalen Strömungen. Vorab:
9
Es soll nicht geleugnet werden, daß die Strafrechtsreformgesetze
unserer Tage in manchen Deliktsbereichen eine spürbare und not
wendige Liberalisierung gebracht haben. Es geht hier nicht darum,
diese in manchen Bereichen noch erst bruchstückhafte inhaltliche
Liberalisierung des Strafrechts in Frage zu stellen. Gemeint ist viel
mehr die Auffassung, derzufolge die heile Strafrechtswelt hergestellt
ist, wenn die inhaltliche Liberalisierung abgeschlossen ist und das
Strafrecht gegen alle Straftäter unabhängig von ihrer sozialen Stel
lung Anwendung findet. So fordert etwa Jürgen Baumann, ein
liberaler Vertreter des Sühnegedankens im Strafrecht, die Reform
des Wirtschaftsstrafrechts mit dem Argument, das Strafgesetzbuch
dürfe "nicht länger ein Gesetzbuch allein gegen die Armen und
Dummen sein" (Baumann 1972a, S. 2). Es ist das wichtigste Er
gebnis dieser Arbeit, daß für die Prävention dissozialen Verhaltens
nichts gewonnen wird, solange das Strafgesetzbuch ein Gesetzbuch
gegen irgendjemand ist. Eine Chance für dauerhafte Prävention er
öffnet sich erst durch die lernzielorientierte Inpflichtnahme des
Strafrechts. Es geht darum, individuelle und gesellschaftliche Lern
prozesse in Gang zu setzen mit dem Ziel, ein soziales Verhaltens
repertoire zu vermitteln, das in der Mitwelt Bestand hat, von der
Mitwelt verstärkt wird. Dies ist die Bedingung, ohne die Prävention
in einem freiheitlichen Gemeinwesen nicht gelingen kann. Wir haben
diese Bedingung "soziale Verhaltenskonditionierung" genannt. Bei
dem Wort "Konditionierung" sollte man heute nicht mehr nur an
Ratten im Versuchslabor denken. Sicher hat die Verhaltenspsycho
logie einmal mit Rattenexperimenten und den sprichwörtlich ge
wordenen Pawlowschen Hunden begonnen. Spätestens seit den
Forschungsarbeiten Banduras ("Lernen am Modell") ist der Ver
haltenspsychologie jedoch der Durchbruch zu den komplexen
Bedingungen menschlichen Lernens gelungen.
Nur mittelbar soll diese Arbeit ein Beitrag zu der unter Krimino
logen ausgetragenen Auseinandersetzung über die Stichhaltigkeit
soziologischer Kriminalitätstheorien sein. So sind etwa die Be
merkungen über die Labeling-Theorie und über die neuerdings
wieder von Opp ins Gespräch gebrachte Anomie-Theorie (Opp 1975)
knapp geraten. Wir beteiligen uns an diesem Streit zunächst nur,
indem wir darlegen, daß die genannten soziologischen Theorien
über das Präventionsproblem nichts wesentliches sagen können und
indem wir sie mit dem andersartigen System einer auf dem natur
wissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff basierenden psychologischen
Theorie konfrontieren.
10
Offen bleibt auch die Auseinandersetzung mit der verfassungs
rechtlichen Kritik des lernpsychologischen Ansatzes. Mit dieser
Kritik ist im Hinblick auf die vorgeschlagene Umorientierung des
Strafrechts unfehlbar zu rechnen. Zielorieritierte Reformpolitik ist
auch in anderen gesellschaftlichen Problemfeldern dieser häufig
vordergründigen Kritik ausgesetzt. Die Auseinandersetzung mit der
Auffassung, nur eine blind ihre "Strafzwecke" vollziehende Straf
rechtsmaschinerie sei verfassungskonform, wird hier nur befristet
ausgeklammert. Sie bleibt der späteren wissenschaftlichen Diskus
sion vorbehalten.
Diese Arbeit konnte nur dank eines mir von der Friedrich
Ebert-Stiftung gewährten Graduierten-Stipendiums entstehen. Ich
danke meinen Lehrern, Herrn Prof. Klaus Tiedemann und Herrn
Prof. Werner Correll, für Lob und Kritik gleichermaßen. - Die
relativ hohe Rücklaufquote des Fragebogens wäre wohl kaum
erreicht worden, wenn nicht Herr Prof. Tiedemann mit seinem
Namen für die Seriosität der Befragung gebürgt hätte.
Die Auswertung der Befragung erfolgte am Rechenzentrum der
Universität Giessen. Ich danke Herrn Dipl.-Psychologen Frank
}ungebloed, der mich mit großer Geduld in die Benutzung der
Rechenanlage einwies und mir die Anwendung der Statistikpro
gramme des Fachbereichs Psychologie erläuterte. Hinweise auf die
Autoren und auf die Funktion der benutzten Programme sind im
Anhang zum Literaturverzeichnis aufgelistet.
Mein persönlicher Dank gilt Herrn Dipl.-Psychologen Martin
Bingemann, dessen Diskussionsbereitschaft zum Gelingen der
Arbeit beigetragen hat.
Ich danke dem Bundesminister der Finanzen für die mir zur
erstmaligen Veröffentlichung zur Verfügung gestellten absoluten
Zahlen der Steuerstrafsachen-und Betriebsprüfungsstatistik.
Ferner gilt mein Dank der Bremer Kriminalistischen Studienge
meinschaft für die freundliche Anerkennung meiner Arbeit.
Abschließend ein terminologischer Hinweis. Wo in dieser Arbeit
von Prävention die Rede ist, ist zunächst die Generalprävention
gemeint, d. h. delinquentes Verhalten soll von vornherein und
generell bei allen Betroffenen, für die delinquentes Verhalten über
haupt in Betracht kommt, verhindert werden. In der Psychologie
gibt es hierfür den Terminus "primäre Prävention". Nur da, wo
ausdrücklich von Spezialprävention die Rede ist, wird diese auch
angesprochen. Spezialprävention hat das Ziel, delinquentes Ver
halten bei dem überführten und für eine Behandlung verfügbaren
Straftäter zukünftig zu verhindern: bereits aufgetretenes delin-
11