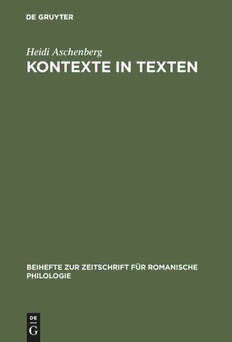Table Of ContentBEIHEFTE ZUR
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER
FORTGEFÜHRT VON
WALTHER VON WARTBURG UND KURT BALDINGER
HERAUSGEGEBEN VON MAX PFISTER
Band 295
HEIDI ASCHENBERG
Kontexte in Texten
Umfeldtheorie und literarischer
Situationsaufbau
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
1999
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
[Zeitschrift für romanische Philologie /Beihefte]
Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie / begr. von Gustav Gröber. - Tübingen:
Niemeyer
Früher Schriftenreihe
Reihe Beihefte zu: Zeitschrift für romanische Philologie
Bd. 295. Aschenberg, Heidi: Kontexte in Texten. - 1999.
Aschenberg, Heidi:
Kontexte in Texten: Umfeldtheorie und literarischer Situationsaufbau / Heidi Aschenberg. -
Tübingen: Niemeyer, 1999
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie; Bd. 295)
ISBN 3-484-52295-X ISSN 0084-5396
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 1999
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover-
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in
Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Satz und Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten
Einband: Industrie- und Handbuchbinderei Norbert Klotz, Jettingen
Fur
Max
Barbara
Rebecca
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist die um einige Kapitel gekürzte, ansonsten je-
doch nur geringfügig geänderte Fassung eines Textes, der, im Frühjahr
1995 abgeschlossen und eingereicht, im Februar 1996 von der Neuphilolo-
gischen Fakultät der Universität Heidelberg als Habilitationsschrift ange-
nommen wurde.
Wer sich auf das Unternehmen <Habilitation> einläßt, begibt sich in der
Regel auf einen langen, einen bisweilen mühsamen Weg. Allen, die mich
begleitet haben, möchte ich danken:
An erster Stelle Prof. Jörn Albrecht (Heidelberg), der mich bewog,
diesen Weg zu beschreiten, indem er Anfang 1990 die Thematik dieser
Untersuchungen vorgeschlagen und es mir durch eine Assistentenstelle
am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg
ermöglicht hat, die Arbeit ohne Zeitdruck in einer Atmosphäre großzügi-
ger Toleranz fertigzustellen.
Für gutachterliche Befürwortung und klärende Gespräche in der An-
fangsphase danke ich Prof. Hans Helmut Christmann (t), dessen uneigen-
nützige Ermutigung mir erlaubte, die Universität als berufliche Perspek-
tive zu verstehen, und Prof. Eugenio Coseriu (Tübingen), in dessen -
wie auch dem vorliegenden Text unschwer anzumerken ist: prägendem -
Wirkungskreis ich als Studentin, Doktorandin und Assistentin viele Jahre
lernen konnte.
Zu erneutem Dank verpflichtet bin ich der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (Bonn), die durch ein Habilitandenstipendium, das mir von
Oktober 1991 bis September 1993 gewährt wurde, das Zustandekommen
der Arbeit entscheidend gefördert und durch einen großzügigen Druck-
kostenzuschuß die Publikation in der vorliegenden Form ermöglicht hat.
Meinen Tübinger und Heidelberger Freunden und Kollegen danke ich
für ihr Interesse am Fortgang der Arbeit, vor allem Dr. Michael Schreiber
(Heidelberg) für Gespräche und wichtige bibliographische Hinweise so-
wie Waltraud und Roland Sickinger, unseren Nachbarn in Nehren, deren
persönliche und technische Hilfestellung der Typoskriptfassung des Tex-
tes sehr zugutegekommen ist.
Den Fakultätsgutachtern, den Professoren Jörn Albrecht, Klaus Heit-
mann und Jens Lüdtke (Heidelberg) danke ich für freundliche Kritik;
VII
soweit ihre Hinweise nicht Grundsätzliches, sondern Einzelheiten betra-
fen, habe ich sie für die Druckfassung berücksichtigt.
Des weiteren danke ich Prof. Max Pfister (Saarbrücken) für die Auf-
nahme der Arbeit in die Reihe Beihefte zur Zeitschrift für Romanische
Philologie sowie dem Max Niemeyer Verlag (Tübingen) für ausgezeich-
nete Kooperation in allen die Publikation betreffenden Fragen.
Schließlich danke ich meiner Familie: Barbara und Rebecca, unseren
Kindern, für Nachsicht; meinem Mann für zahlreiche Gespräche und viel-
fältige Anregungen, für Kritik und Ermutigung, wenn die Energie, das
Gedachte in noch präzisere Formulierungen zu fassen, erlahmen wollte,
ebenso für Hilfe bei der Herstellung des Computerskripts und bei den
Korrekturen.
Wer nach mehrjähriger Arbeit einen Text in die Öffentlichkeit entläßt,
wünscht sich, daß nicht vernichtende Kritik das Echo sei. Dem Leser
dieses Textes gebe ich ein Wort Nebrijas mit auf den Weg: «Lee lo en
buen hora!»
Nehren, im Mai 1997 H. A.
VIII
Inhaltsverzeichnis
Einleitung i
Erster Teil
Zur Theorie der Kontexte
I. Philosophische Kontexte 8
1. Kontext und Redeuniversum (Urban) 9
1.1. Bedeutung und Verstehen (mit einem Exkurs zur
suppositio-Lehre) 9
1.2. Pragmatische Kontexttheorie 13
2. Verstehenskontexte: Positionen der Hermeneutik . . .. 17
2.1. Individualität und Interpretation
(Schleiermacher) 18
2.2. Seinsverstehen (Heidegger) 21
2.3. Sprachlichkeit und Geschichtlichkeit des
Verstehens (Gadamer) 23
3. Dekonstruktive Kontexte (Derrida) 26
3.1. Dekonstruktion 27
3.2. Ecriture 29
3.3. Kontext 30
4. Zeichenphilosophische Kontexte (Simon) 35
4.1. Grundgedanken einer Philosophie des Zeichens 35
4.2. Relativität der Kontexte im Zeit-Kontext 37
5. Übergänge: Sprachphilosophie, Sprachtheorie,
Sprachwissenschaft 40
II. Modelle der Sprachtheorie 44
1. Zeichen und Umfelder (Bühler) 44
1.1. Axiomatik (mit einem Exkurs zur
Situationstheorie Gardiners) 46
1.2. Umfeldtheorie 54
1.3. Zwischenbilanz 60
IX
2. Umfelder und Sinn (Coseriu) 63
2.1. Sprachtheoretische Hintergründe 64
2.2. Umfeldtheorie 66
2.3. Text und Sinn 67
3. Systematisches Fazit: Typologie der Umfelder 73
4. Exkurs: Sprache und Kontext (Slama-Cazacu) 77
5. Semiotik der Kontexte (Eco) 79
5.1. Semiotik 79
5.2. Umfelder 81
5.3. Hermeneutische Öffnung der Semiotik 83
6. Zusammenfassung 87
III. Das Kontextproblem im Spektrum sprachwissenschaftlicher
Semantik und Pragmatik 90
1. Semantische Positionen 91
1.1. Kontextualismus (Malinowski und Firth) 92
1.2. Pragmatische Semantik (Lyons) 99
2. Exkurs: Soziolinguistische und stilistische Kontexte . . . 103
3. Pragmatische Kontexte 106
4. Präsuppositionen 110
5. Prototypen- und /rame-Semantik 113
6. Zusammenfassung 120
IV. Texttheoretische Perspektiven 123
1. Textlinguistische Kontexte 125
2. Text und Textverstehen 133
3. Textlinguistik und Hermeneutik 140
4. Redekontexte 145
4.1. Textimmanente Kontextrelationen 145
4.2. Konnotative und evokative Kontexte (mit einem
Exkurs über verschwiegene Kontexte) 148
4.3. Intertextuelle Kontexte 156
4.4. Suppletive Kontexte 163
Zweiter Teil
Zur suppletiven Konstruktion
situationeller Umfelder in literarischen Texten
I. Kontext als Interpretationskategorie: Die suppletive
Konstruktion von Umfeldern in literarischen Texten 178
X