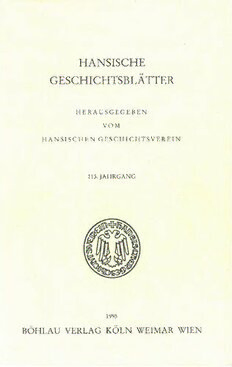Table Of ContentHANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
H E R A U S G E G E B E N
VOM
H A N S I S C H E N G E S C H I C H T S V E R E I N
113. JAHRGANG
1995
BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN
Zuschriften, die den Aufsatzteil betreffen, sind zu richten an Herrn Dr. Rolf
H ammel-Kiesow, Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostsee
raums, Burgkloster, Hinter der Burg 2-4, 23539 Lübeck; Besprechungsexemplare
und sonstige Zuschriften wegen der Hansischen Umschau an Herrn Dr. Volker
HENN, Universität Trier, Fachbereich III, Postfach 3825, 54286 Trier.
Manuskripte werden in Maschinenschrift (und ggf. auf Diskette) erbeten. Korrek
turänderungen, die einen Neusatz von mehr als einem Zehntel des Beitragsumfanges
verursachen, werden dem Verfasser berechnet. Die Verfasser erhalten von Aufsätzen
und Miszellen 20, von Beiträgen zur Hansischen Umschau 2 Sonderdrucke unent
geltlich, weitere gegen Erstattung der Unkosten.
Die Lieferung der Hansischen Geschichtsblätter erfolgt auf Gefahr der Empfänger.
Kostenlose Nachlieferung in Verlust geratener Sendungen erfolgt nicht.
Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Eintritt in den Hansischen Geschichtsverein ist jederzeit möglich. Der Jahresbeitrag
beläuft sich z. Zt. auf DM 40 (für in der Ausbildung Begriffene auf DM 20). Er
berechtigt zum kostenlosen Bezug der Hansischen Geschichtsblätter. - Weitere
Informationen gibt die Geschäftsstelle im Archiv der Hansestadt Lübeck, Mühlen
damm 1-3, 23552 Lübeck.
HANSISCHE
GESCHICHTSBLÄTTER
HERA US GEG EB EN
VOM
H A N S I S C H E N G E S C H I C H T S V E R E I N
113. JAHRGANG
1995
BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN
REDAKTION
Aufsatzteil: Dr. Rolf Hammel-Kiesow, Lübeck
Umschau: Dr. Volker Herrn, Trier
Für besondere Zuwendungen und erhöhte Jahresbeiträge, ohne die dieser Band nicht
hätte erscheinen können, hat der Hansische Geschichtsverein folgenden Stiftungen,
Verbänden und Städten zu danken:
Possehl-Stiftung zu Lübeck
Freie und H ansestadt H amburg
Freie H ansestadt Bremen
H ansestadt Lübeck
Stadt Köln
Stadt Braunschweig
Landschaftsverband W estfalen-L ippe
Landschaftsverband R heinland
ISSN 0073-0327
Inhalt
Nachruf auf Johannes Schildhauer.
Von Walter Stark....................................................................................... 1
Aufsätze
Enno Bünz
Hugo von Hildesheim. Ein frühhansischer Fernhändler im
Ostseeraum und der holsteinische Volksadel um 1200 .............
Jürgen Hartwig Ibs
Judenverfolgungen in den Hansestädten des südwestlichen
Ostseeraums zur Zeit des Schwarzen Todes ................................. 27
Ingo Dierck
Die Brügger Alterleute des 14. Jahrhunderts. Werkstattbericht
über eine hansische Prosopographie ................................................. 49
Dieter Seifert
Der Hollandhandel und seine Träger im 14. und 15. Jahrhundert 71
Milja van Tielhof
Der Getreidehandel der Danziger Kaufleute in Amsterdam um
die Mitte des 16. Jahrhunderts ........................................................... 93
Norbert Angermann
Die livländischen Städte und die Hanse ........................................... 111
Wolfgang Schmid
Kölner Hansekaufleute als Stifter und Mäzene.............................. 127
Miszelle
Stuart Jenks
Die Londoner Zollakten. Anmerkungen zu einer neuen
„Edition“ .................................................................................................... 145
Berichte
Fernhandel und Stadtentwicklung im Nord- und Ostseeraum in
der hansischen Spätzeit. Symposion im Stader Rathaus, 1994.
Von Jürgen Bohmbach .......................................................................... 151
Lebenswege und Stationen. 110. Jahresversammlung des Han
sischen Geschichtsvereins Stralsund 1994.
Von Horst Wernicke............................................................................... 157
IV
Vorschau
Hansekaufleute in Brügge. Kolloquium in Brügge 25. 4.-28. 4.
1996 .............................................................................................................. 161
Wirtschaftliche Wechsellagen im hansischen Wirtschaftsraum
1300-1800 .................................................................................................... 163
Hansische Umschau
In Verbindung mit Norbert Angermann, Roman Czaja, Antjekathrin
Graßmann, Rolf Hammel-Kiesow, Elisabeth Harder-Gersdorff, Stuart
Jenks, Petrus H.J. van der Laan, Ortwin Pelc, Thomas Riis, Herbert
Schwarzwälder, Hugo Weczerka und anderen bearbeitet von Volker
Henn.
Allgemeines................................................................................................. 167
Vorhansische Zeit .................................................................................... 193
Zur Geschichte der niederdeutschen Landschaften und der
benachbarten Regionen.......................................................................... 198
Westeuropa ................................................................................................. 240
Skandinavien...................................................................................... . .. 252
Osteuropa.................................................................................................... 261
Für die Hanseforschung wichtige Zeitschriften............................ 301
Hansischer Geschichtsverein
Jahresbericht 1994 .................................................................................... 305
Liste der Vorstandsmitglieder .............................................................. 307
Johannes Schildhauer
1918 - 1995
Am 1. April 1995 ist Johannes Schildhauer, em. o. Professor für mitt
lere und neuere Geschichte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität zu
Greifswald, den Folgen eines schon überstanden geglaubten Herzinfarkts
erlegen. Am 6. April nahmen aus nah und fern herbeigekommene Kollegen,
Weggefährten und Freunde zusammen mit der Familie in einer Trauerfeier
am Sarge Abschied von dem Verstorbenen.
Johannes Schildhauers Wirken ist bei früheren Anlässen schon mehrfach
in Rede und Schrift gewürdigt worden. Jeder, der Persönlichkeit und Werk
beurteilte, setzte dabei in Abhängigkeit von seinem Standpunkt und den
Zeitverhältnissen eigene, andere Akzente. Auch dies wird nicht die letzte
Wertung bleiben; ein abschließendes Urteil wird es ohnehin nie geben.
Doch angesichts der seit Überwindung der deutschen Zweistaatlichkeit
häufig - und oft wider besseres Wissen - vorgetragenen Versuche, Wissen
schaftlern der ehemaligen DDR Persönlichkeitswert und Lebensleistung
abzusprechen, scheint es nicht allein gestattet, sondern vielmehr geboten,
in einem Nachruf eine Würdigung zu wagen.
Der 20-jährige, in einer Dessauer Beamtenfamilie aufgewachsene Abitu
rient eines humanistischen Gymnasiums begann 1938 an der Universität
Leipzig mit dem Studium der Geschichte, der Germanistik und der Altphi
lologie. Nach einem Jahr aber hatte er schon zur Wehrmacht einzurücken,
aus der der Infanterieleutnant d. R. nach längerem Fronteinsatz und Laza
rettaufenthalten noch 1944 als dienstuntauglich mit von der Tuberkulose
zerfressener Lunge entlassen wurde. Er gehörte zu der Generation, die
die Schrecken des Krieges als prägenden Eindruck zu verarbeiten hatte.
Daher begann er schon 1945, sich für den Aufbau einer neuen und seiner
Überzeugung nach besseren Ordnung einzusetzen. Er tat dies als Neu
lehrer und Mitglied einer Partei, deren Mitglieder sich eine Neuordnung
der Gesellschaft in demokratisch-sozialistischem Sinne als Ziel gesetzt
hatten. An dieser Zielsetzung hat Johannes Schildhauer ungeachtet aller
durch die Zeit und die Umstände wie durch menschliches Versagen in der
Parteiführung bedingten Verwerfungen und Entstellungen bis zu seinem
Tode, zuletzt noch als Mitglied einer um ihre demokratische Erneuerung
ringenden Partei festgehalten.
Im Herbst 1946 konnte Johannes Schildhauer das Studium in Greifswald
wieder aufnehmen. In dem von Adolf Hofmeister geleiteten Historischen
2 Walter Stark
Institut erwarb sich der - wie wir alle damals - äußerlich ziemlich abgeris
sene und dazu noch durch die gerade überstandene Krankheit gezeichnete
junge Mann durch sein Wissen und Können bald die Anerkennung seiner
Kommilitonen und seines akademischen Lehrers. Ausdruck dessen war
die schon 1948 auf Vorschlag Adolf Hofmeisters erfolgte Einstellung als
wissenschaftliche Hilfskraft am Historischen Institut, als dessen „Senior“
er gleichzeitig amtierte. Da mehrere Lehrstühle noch vakant waren, richtete
er auf Anregung Hofmeisters, der sich in seiner Lehrtätigkeit strikt auf sein
mediaevistisches Ordinariat beschränkte, einen studentischen Arbeitszirkel
ein, der sich unter seiner Leitung mit deutscher Verfassungsgeschichte des
19. Jahrhunderts befaßte. Hier hatte der Examinand erstmals Gelegenheit,
seine Befähigung zur akademischen Lehrtätigkeit anzudeuten. Nach dem
Examen promovierte er 1949 bei Adolf Hofmeister mit einer Arbeit über
die Grafen von Dassel. Johannes Schildhauer hat stets mit Achtung von
seinem Lehrer Adolf Hofmeister gesprochen, wenn er auch bald eigene
wissenschaftliche Wege gegangen ist und sich dieser Prozeß des Abnabelns
- wie so häufig im wissenschaftlichen Leben - nicht ohne Irritationen
vollzogen hat. Die Gründlichkeit des Arbeitens, die Gewissenhaftigkeit
in der Handhabung der Werkzeuge und Verfahren des Historikers, die
Beherrschung des hilfs- und sprachwissenschaftlichen Instrumentariums,
vor allem aber die vorsichtige Zurückhaltung bei der Interpretation der
Quellen lassen bei ihm wie bei manchen seiner späteren Mitarbeiter und
Kollegen die Prägung durch die Hofmeisterschule erkennen.
Seit dem WS 1952/53 mit der Wahrnehmung einer Dozentur am Hi
storischen Institut beauftragt, begann Johannes Schildhauer seinen Weg
als Hansehistoriker mit der 1957 abgeschlossenen und 1958 bei Böhlau in
Weimar gedruckt erschienenen Habilitationsschrift über „Soziale, politi
sche und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund,
Rostock und Wismar“. Danach wandte sich der 1958 zum Professor
Berufene sozialstrukturellen und seehandelsgeschichtlichen Problemen des
Ostseebereiches zur Hansezeit zu, während er gleichzeitig bestrebt war, mit
der allmählich unter seiner Leitung heranwachsenden Forschungsgruppe
„Stadt- und Hansegeschichte“ Grundzüge einer Geschichte der deutschen
Hanse zu erarbeiten. Dabei ging es vor allem um die Bestimmung der
Leistungen und des Platzes dieses größten deutschen Städtebundes in der
Geschichte - eine Bestimmung, die frei von überkommenen idealisieren
den und nationalistischen Verzeichnungen angestrebt wurde. Letztendlich
erwuchs aus diesem Versuch dann 1974 das „Dreimännerbuch“, die ge
meinsam mit K. Fritze und W. Stark verfaßte „Geschichte der Hanse“.
Das Buch füllte in der DDR, in der die Hansegeschichte von Ph. Dollin-
ger nur in wissenschaftlichen Bibliotheken einem beschränkten Leserkreis
zugänglich war, eine Lücke und erlebte sieben Auflagen, bevor die Autoren
es als inzwischen überholt anhielten. Es ist dabei fast überflüssig zu sagen,
Nachruf auf Johannes Schildhauer 3
daß die Autoren bei allem berechtigten Trachten nach wissenschaftlicher
Eigenständigkeit sich stets dessen bewußt blieben, immer auf den Schultern
ihrer Vorgänger und deren Leistungen zu stehen.
Aus Schildhauers akademischer Lehrtätigkeit gingen die 1974 und 1984
besorgten Neugestaltungen des Stern/Voigtschen Hochschullehrbuches zur
deutschen Geschichte des Spätmittelalters sowie die Mitarbeit im Autoren
kollektiv des Mittelalterbandes der einem größeren Leserkreis zugänglich
gewordenen „Deutschen Geschichte in zwölf Bänden“ hervor. Selbst
verständlich ließ Johannes Schildhauer es sich nicht nehmen, für Herbert
Ewes „Geschichte der Stadt Stralsund“ das Kapitel über die Stadt im
16. Jahrhundert zu schreiben. Als er schon emeritiert war, erschien in bei
den deutschen Staaten die anspruchsvolle und zugleich allgemeinverständ
liche, hervorragend illustrierte Darstellung „Die Hanse. Geschichte und
Kultur“, in der er hansisches Leben in seiner ganzen Vielfalt nachzu
zeichnen versuchte. Die reichhaltige Sammlung von Bürgertestamenten des
Stralsunder Stadtarchivs bot dann den Rohstoff für seine letzte größere
Arbeit, die 1992 erschienene Monographie „Hansestädtischer Alltag. Un
tersuchungen auf der Grundlage Stralsunder Bürgertestamente vom Anfang
des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts“.
Das Bild von Johannes Schildhauers Lebenswerk bliebe unvollständig,
würde nicht auch auf seine Arbeit als Forschungsgruppenleiter einge
gangen. Unter seiner Leitung entstand in einem ein Vierteljahrhundert
währenden Prozeß des Wachsens und Reifens eine leistungsfähige Ar
beitsgruppe zur Stadt- und Hansegeschichte. Schildhauer und seine Mit
streiter, unter ihnen und allen voran der bald neben ihn tretende und
dann doch noch vor ihm dahingegangene Konrad Fritze, wollten Han
seforschung auf der Grundlage des historischen Materialismus betreiben,
ohne für diesen Weg Ausschließlichkeit zu beanspruchen. Die Arbeiten
aus dieser Gruppe, für die in der Fachliteratur bisweilen schon die von
uns als Epitheton ornans aufgefaßte Bezeichnung „Greifswalder Schule“
auftauchte, bestimmten nicht allein wesentlich das Profil des Greifswalder
Historischen Instituts, sondern fanden auch nationale wie internationale -
natürlich differenziert ausgeprägte - Anerkennung. Man muß die konkre
ten Bedingungen kennen, unter denen sich die Hansegeschichtsforschung
in der DDR durchzusetzen hatte, will man der geleisteten Arbeit gerecht
werden. Nicht allein, daß man sich seitens der etablierten Hanseforschung
anfangs - vornehm gesagt - sehr abwartend gegenüber diesen neuen Tönen
verhielt, die da aus Greifswald herüberschallten. Noch härter, um nicht
zu sagen grobschlächtiger waren anfängliche Ablehnungen aus der DDR
selbst. Gab es doch in der Historikerzunft zahlreiche und z. T. an recht
maßgeblicher Stelle sitzende Kräfte, die jede Hinwendung zur Geschichte
früherer Jahrhunderte als Flucht vor einer Stellungnahme zu Gegenwarts
problemen verketzerten; und nur zu oft wurden diese Kontroversen nicht
4 Walter Stark
sachlich-fachlich ausgetragen, sondern mit raffinierter Demagogie auf die
politisch-ideologische Ebene hinübergezerrt. Solchen mit eindeutiger Dis
ziplinierungsabsicht vorgetragenen Angriffen, selbst aus dem eigenen Insti
tut, sahen sich auch Johannes Schildhauer und seine Mitarbeiter ausgesetzt.
Aber überzeugt von der Berechtigung des eingeschlagenen Weges und im
Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, vor allem aber fasziniert von der
Weite und Vielgestaltigkeit des Forschungsgebietes setzten Schildhauer und
seine Kollegen diesen Angriffen das Streben nach qualifizierter Leistung
entgegen. Rückenstärkung erfuhren sie dabei von der Arbeitsgemeinschaft
des Hansischen Geschichtsvereins in der DDR bzw. später dann von der
Arbeitsgemeinschaft Hansegeschichte beim Historikerverband der DDR.
Die Auswirkungen für die Gestaltung des Historischen Instituts, dessen
Direktorat Johannes Schildhauer von 1957 bis 1977 ausübte, lagen darin,
daß „trotz anhaltender gegenläufiger Bestrebungen ... eine überhöhte Fa-
vorisierung der Zeitgeschichte und Ausdünnung der mittleren und neueren
Geschichte verhindert werden konnte“ (M. Menger).
Johannes Schildhauer war unablässig bestrebt, die Humboldtsche Ein
heit von akademischer Lehre und Forschung vorzuleben. Seine Vorlesun
gen bestachen durch ihre klare, disziplinierte Gedankenführung; in den
Seminaren der verschiedenen Ausbildungsstufen war er fordernder und
fördernder Berater seiner Studenten, seinen Doktoranden ein einfühlsamer,
zur Selbständigkeit anregender Begleiter ihrer Arbeit. Er sah seine Lehr-
und Fürsorgepflicht nicht mit dem Examen als erloschen an, sondern
vermittelte den in der Schulpraxis stehenden Lehrern - vielfach waren
sie ja einmal seine Studenten gewesen - neue, vertiefte und erweiternde
Kenntnisse zur Geschichte und ermunterte sie so zum Durchbrechen der
oft im Dogmatismus erstarrten Lehrpläne.
Es konnte nicht ausbleiben, daß der Instituts- und Sektionsdirektor,
daß der Leiter einer erfolgreich tätigen Forschungsgruppe in Leitungs
gremien wissenschaftlicher Vereinigungen und Organisationen zu wissen
schaftsorganisatorischer Tätigkeit gefordert wurde. Es geschah dies bis
weilen in einem Ausmaß, daß uns, seine Freunde und Mitarbeiter, die
Sorge beschlich, die wissenschaftliche Arbeit könnte darüber zu kurz
kommen. Er hat dies selbst rechtzeitig zu korrigieren gewußt. Immer
aber blieb ihm die Arbeit mit den engeren Fachgenossen unverzichtbar.
An der Mitarbeit im Hansischen Geschichtsverein hat er unbeirrt durch
mancherlei von außen hineingetragene Irritationen und dadurch bedingte
zeitweilige Mißverständnisse festgehalten und als stellvertretender Vorsit
zender der Hansischen Arbeitsgemeinschaft die Arbeit fortführen helfen,
als politisches Gebot 1970 die organisatorische Trennung erzwang. Als
dieser Zwang 1989/90 fortgefallen war, hat er mit innerster Überzeugung
daran mitgewirkt, daß wieder zusammenwuchs, was zusammengehörte.
Die verständnisvolle Großzügigkeit, mit der der Hansische Geschichts