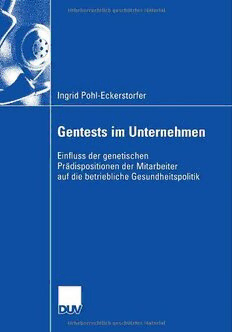Table Of ContentIngrid Pohl-Eckerstorfer
Gentests im Unternehmen
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
Ingrid Pohl-Eckerstorfer
Gentests im Unternehmen
Einfluss der genetischen
Pradispositionen der Mitarbeiter
auf die betriebliche Gesundheitspolitik
Miteinem Geleitwortvon Prof. Dr. Bruno Staffelbach
Deutscher Universitats-Verlag
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet iJber <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Dissertation Universitat Zurich, 2005
Genehmigt auf Antrag von
Prof. Dr. Bruno Staffelbach
Prof. Dr. Egon Franck
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat der Universitat Zurich gestattet hierdurch die
Drucklegung der vorliegenden Dissertation, ohne damit zu den darin ausgesprochenen
Anschauungen Stellung zu nehmen.
Zurich, den 8. Februar 2006 Der Dekan: Prof. Dr. H. R Wehrii
I.Auflage Juli2006
Alle Rechte vorbehalten
© Deutscher Universitats-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006
Lektorat: Ute Wrasmann / Viktoria Steiner
Der Deutsche Universitats-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.duv.de
Das Werk einschlleSlich aller seiner Telle ist urheberrechtlich geschiitzt.
Jede Verwertung auSerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulassig und strafbar. Das gilt insbe-
sondere fur Vervlelfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung In elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und dahervon jedermann benutzt werden diirften.
Umschlaggestaltung: Reglne Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
Druck und Buchbinder: Rosch-Buch, ScheSlitz
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN-10 3-8350-0346-1
ISBN-13 978-3-8350-0346-0
Geleitwort
Der betriebliche Einsatz gendiagnostischer Verfahren mag prima vista Skepsis provozieren.
Medizinische Abklarungen bei der Auswahl kunftiger und beim Einsatz von beschaftigten
Arbeitnehmerinnen und von Arbeitnehmem sind aber nicht neu. Viele mit genetischen Tests
ermittelbare Informationen sind auch iiber Familienanamnesen beschaffbar. Mit Gentests
konnen genetisch bedingte Veranlagungen fiir bestimmte Erkrankungen rascher, praziser und
giinstiger erkannt werden. Gerade mit Gen Chips sinken der technische Aufwand und damit
auch die Kosten fiir die Durchfuhrung von Gentests entscheidend. Solchen Vorteilen stehen
aber auch viele offene Fragen und erhebHche Nachteile gegeniiber.
In der Arbeit von Ingrid Pohl-Eckerstorfer geht es um die Klarung des Stellenwertes der
Genanalyse im Untemehmen im Allgemeinen und im Kontext der betrieblichen Gesundheits-
politik im Speziellen. Dabei geht sie von der Pramisse aus, dass die Genanalyse ein Mittel zur
Aufrechterhaltung und zur Forderung der Gesundheit von Beschaftigten ist. Rechtzeitige
Kenntnis iiber medizinische Veranlagungen ermoglicht preventive Aktivitaten. Drei
Bedingungen werden a priori vorausgesetzt: Gentests erfolgen freiwillig, sie sind valide und
die Informationen daraus bleiben im Privateigentum des Gentragers bzw. der Gentragerin.
Der betriebliche Einsatz von Gentests ist ein praktisches Problem, das sich nicht nach einer
einzelnen wissenschaftlichen Disziplin ausrichtet. Folgerichtig zieht Ingrid Pohl-Eckerstorfer
okonomische und (gesundheits-) psychologische Ansatze und Konzepte heran, um mogliche
relevante Faktoren herauszufiltem. Das entwickelte Modell wird mit einer Befragung von
Personalverantwortlichen gepriift. Die Ergebnisse sind Grundlage zur Formulierung von
Handlungsempfehlungen.
Der Autorin ist es gelungen, die kontroverse Technik „Gentest" fur den betriebswirtschaft-
lichen Kontext theoretisch zu erfassen und zu erschliessen, auf der Basis einer Analyse
verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen ein eigenes Modell zu entwickeln und dieses mit
empirischen Befunden in Verbindung zu bringen. Die Arbeit stellt damit einen eigenstandigen
und neuen Beitrag zum Human Resource Management dar. Sie ist sowohl aus theoretischer
wie auch aus praktischer Sicht bemerkenswert. Ich wtinsche der kenntnisreichen Publikation -
und mit ihr dem Mut, heikle Problemstellungen mit Disziplin zu analysieren und mit
Verantwortung zu beurteilen - eine weite Verbreitung.
Prof. Dr. Bruno Staffelbach
VII
Vorwort
Zum Erfolg dieser Dissertation haben viele Personen auf unterschiedliche Art und Weise
beigetragen, denen ich an dieser Stelle herzlich danken mochte:
Grosser Dank gebuhrt meinem Vorgesetzten und Doktorvater Prof. Dr. Bruno Staffelbach. Er
hat mir die Forschung an diesem interessanten Thema an seinem Lehrstuhl ermoglicht und
mir zudem die Freiheit gelassen, meine eigenen Ideen und Konzepte umzusetzen. Seine
konstruktiven Anregungen haben wesentUch zum erfolgreichen Abschluss dieser Dissertation
beigetragen und dariiber hinaus mein kritisches Denken und wissenschaftliches Arbeiten
nachhaltig gepragt. Besonderer Dank gilt weiter Prof. Dr. Egon Franck fur die Erstellung des
Zweigutachtens sowie far seine Funktion als Koreferent.
Zu Dank verpflichtet bin ich femer alien Befragungsteilnehmem, meinen Interviewpartnem
sowie der Kommission des Forschungskredits der Universitat, die mein Dissertationsprojekt
fiir forderungswiirdig gehalten und somit die Erstellung mitfmanziert hat.
Weiter mochte ich alien gegenwartigen und friiheren Kolleginnen und Kollegen des
Lehrstuhls HRM fiir ihre Mitwirkung meinen Dank aussprechen. Besonders hervorheben
mochte ich dabei die uneingeschrankte Diskussionsbereitschaft und die konstruktive Kritik
unseres Oberassistenten Roger Gfrorer sowie die ,sprachliche' und moralische Unterstutzung
von Stephanie Witschi.
Viel Verstandnis fiir meinen Zeitmangel aufgebracht haben meine Freunde. Sie haben mir zur
Seite gestanden und waren auch in meinen angespannten Phasen fur mich da. Mein innigster
Dank gilt meinen Eltem. Sie haben mir viel Durchhaltungsvermogen, Neugier und Offenheit
mit auf den Lebensweg gegeben.
Den notigen seelischen Riickhalt bei der Uberwindung von den mit dieser Dissertation
verbundenen Hohen und Tiefen gab mir mein Mann. Ich danke ihm fiir sein Vertrauen in
mich, seinen Optimismus, seine Hilfsbereitschaft und seine Liebe. Ihm ist diese Arbeit
gewidmet.
Fur Peter
Ingrid Pohl-Eckerstorfer
IX
Inhaltsubersicht
Inhaltsiibersicht IX
Inhaltsverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis XIX
Tabellenverzeichnis XXI
Formelverzeichnis XXII
Verzeichnis Abkiirzungen XXIII
1 Einfuhrung 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Forschungskonzept 10
1.3 Forschungsansatz 11
1.4 Begriffliche Grundlagen 16
2 Genanalyse: Naturwissenschaftlicher Hintergrund 23
2.1 Grundlagen der Humangenetik 24
2.2 Genetische Merkmale von Erkrankungen 30
2.3 Gentests - Nachweis von Erkrankungen 40
2.4 Fazit des naturwissenschaftlichen Hintergrunds 52
2.5 Zukunftsperspektiven 53
3 Das Human Resource Management 55
3.1 Der Ressourcenbegriff aus der Resource Based View 56
3.2 Kriterien einer Ressource 57
3.3 Humanressourcen 62
3.4 Das Management der Humanressourcen 66
3.5 Aufgaben, Trager und Adressaten des HRM 71
3.6 Fazit des Human Ressource Managements 77
4 Einsatzmoglichkeiten der Genanalyse 81
4.1 Betriebliche Einsatzmoglichkeiten der Genanalyse 82
4.2 Der HRM-Teilbereich Strategic und die Genanalyse 83
4.3 Der HRM-Teilbereich Beschaftigung und die Genanalyse ....93
4.4 Der HRM-Teilbereich Beurteilung und die Genanalyse 100
4.5 Der HRM-Teilbereich Anreizsystem und die Genanalyse 102
4.6 Der HRM-Teilbereich Entwicklung und die Genanalyse 110
4.7 Der HRM-Teilbereich Administration und die Genanalyse 113
4.8 Fazit der betrieblichen Einsatzmoglichkeiten 115
4.9 Zentrale Problembereiche 118
5 Multidisziplinare Analyse 119
5.1 Die Okonomikdes Gesundheits-Informationsdefizits 120
5.2 Wirtschaftlichkeitsbewertung von Gentests 148
5.3 Die Psychologic der freiwilligen Gentest-Teilnahme 169
5.4 Gentest-Entscheidungsmodell 196
6 Empirische Evidenz 201
6.1 Schwierigkeiten bei der Datenerhebung 202
6.2 Empirische Forschungsfrage 202
6.3 Empirische Methode 203
6.4 Analyseverfahren 207
6.5 Erfassung der Variablen 209
6.6 Datenstruktur und deskriptive Befunde 212
6.7 Multivariate Regression 222
6.8 Fazit der empirischen Evidenz 231
7 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick 237
7.1 Zusammenfassung 238
7.2 Schlussfolgerungen 242
7.3 Forschungsdesiderata 251
Literaturverzeichnis 255
Anhang A: Zum Online-Fragebogen 277
Anhang B: Kodierter Fragebogen 279
XI
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsiibersicht IX
Inhaltsverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis XIX
Tabellenverzeichnis XXI
Formelverzeichnis XXII
Verzeichnis Abkiirzungen XXIII
1 Einfiihrung 1
1.1 Problemstellung 1
1.1 J Illustration eines Szenario 3
1.1.2 Stand der Literatur 5
1.1.2.1 Gentests inEuropa 5
1.1.2.2 Gentests in den USA 6
1.1.2.3 Diskussion rund um Gentests 7
1.1.3 Empfehlungen fur die Verwendung von betrieblichen Gentests 8
1.1.4 Gentests zur Reduzierung betrieblicher Krankenkosten 8
1.2 Forschungskonzept 10
1.2.1 Zielsetzung 10
1.2.2 Gegenstand und Abgrenzung 10
1.3 Forschungsansatz 11
1.3.1 Forschungstheoretischer Ansatz 11
1.3.2 Vorgehen 13
1.3.3 Aujbau 14
1.4 Begriffliche Grundlagen 16
1.4.1 Genanalyse versus Genomanalyse 16
1.4.2 Aufrechterhaltung und/oder Forderung der Gesundheit 18
1.4.3 Human Resource Management 20
XII
2 Genanalyse: Naturwissenschaftlicher Hintergrund 23
2.1 Grundlagen der Humangenetik 24
2.1.1 Chromosomen 24
2.1.2 DNAundGene 25
2.1.3 Messenger-RNA und Proteine 26
2.1.4 Bedeutung von Mutationen 29
2.2 Genetische Merkmale von Erkrankungen 30
2.2.1 Chromosomale Storungen 31
2.2.2 Monogene Storungen 32
2.2.2.1 Autosomal-dominante Vererbung 33
2.2.2.2 Autosomal-rezessive Vererbung 34
2.2.2.3 X-chromosomale Vererbung 35
2.2.3 Polygene Storungen 36
2.2.3.1 Polygene Vererbung 38
2.2.3.2 Gene und Erkrankungen 38
2.2.4 Hdufigkeit von Erkrankungen 39
2.3 Gentests - Nachweis von Erkrankungen 40
2.3.1 Molekulargenetische Tests 41
2.3.2 Grenzen der DNA-Analysen 42
2.3.3 Gate von Gentests 44
2.3.4 Einsatzbereiche von Gentests 47
2.3.5 Gentests versus herkommliche Diagnoseverfahren 49
2.3.6 Gentests in der Arbeitswelt 50
2.3.7 Gentests zur betrieblichen Gesundheitsforderung 51
2.4 Fazit des naturwissenschaftlichen Hintergrunds 52
2.5 Zukunftsperspektiven 53
3 Das Human Resource Management 55
3.1 Der Ressourcenbegriff aus der Resource Based View 56
3.2 Kriterien einer Ressource 57
3.2.1 Generierung von Wert 58
3.2.2 Knappheit. 59