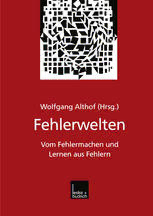Table Of ContentFehlerwelten
Wolfgang Althof (Hrsg.)
Fehlerwelten
Vom Fehlerrnachen und
Lernen aus Fehlern
Beiträge und Nachträge zu einem
interdisziplinären Symposium aus Anlaß
des 60. Geburtstags von Fritz Oser
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Fehlerwelten : vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Beiträge und Nachträge
zu einem interdisziplinären Symposium aus Anlaß des 60. Geburtstags von Fritz
Oser.! Wolfgang Althof (Hrsg.). -Opladen : Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
1999
ISBN 978-3-8100-2343-8 ISBN 978-3-663-07878-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-07878-4
© 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden
UrsprUngIich erschienen bei Leske + Budrich, Opladen 1999
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfliltigungen, Übersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Vorwort des Herausgebers ......................................................................... 7
Hintergrund
Fritz Oser, rina Hascher und Maria Spychiger
Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie des "negativen" Wissens ................. 11
Maria Spychiger, Fritz Oser, Tina Hascher und Fabienne Mahler
Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule ............................................ 43
Vorträge auf dem Symposium "Fehlerwelten"
Brigitte Rollett
Auf dem Weg zu einer Fehlerkultur. Anmerkungen zur
Fehlertheorie von Fritz Oser ..................................................................... 71
Urs Haeberlin
Reflexionen zur Bedeutung des heilpädagogischen Leitsatzes
"Nicht gegen den Fehler, sondern für Fehlendes erziehen" ........................ 89
Franz E. Weinert
Aus Fehlern lernen und Fehler vermeiden lernen ..................................... 101
Wolfgang Edelstein
Aus Fehlern wird man klug. Zur Ontologie der Fehlertypen ..................... 111
Helmut Heid
Autorität -Über die Verwandlung von Fehlern in Verfehlungen ............... 129
Jürgen Oelkers
Perfektion und Ambition. Einige historische Fehler der
pädagogischen Anthropologie .................................................................. 137
Anton A. Bucher
Unfehlbar sein: Dogma oder Teufelswerk?
Anmerkungen zum Fehlermachen in Theologie und Kirche ..................... 153
5
Weitere Beiträge
Gerhard Glack
Zeitgeist und Fehlertheorie (1921 - 1939).
Meister Weimer und sein Schüler Kießling .............................................. 169
RolfDubs
Unsicherheiten bei der Gestaltung der Ausbildung von
Lehrkräften für die Gymnasien. Ein Beitrag zur Vermeidung
möglicher bildungspolitischer Fehler ....................................................... 189
Kurt Reusser
Schülerfehler - die Rückseite des Spiegels ............................................... 203
ritus Guldimann & Michael Zutavern
"Das passiert uns nicht noch einmal!" Schülerinnen und Schüler
lernen gemeinsam den bewußten Umgang mit Fehlern ............................. 233
Zum Ausklang
Lothar Krappmann
Risiko und Krise, Herausforderung und Entwicklung.
Laudatio für Fritz Oser zum 60. Geburtstag ............................................. 259
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren ................................................. 269
6
Vorwort
Fehler haben keinen guten Ruf Wer gefehlt hat, duckt sich besser. Verfehlte
Ziele bedeuten Niederlagen - egal, wie unklug die Ziele gewesen sein mö
gen. Werden Fehler - oder gar Verfehlungen - offensichtlich, ist man gut
beraten, nach einer akzeptablen Rechtfertigung Ausschau zu halten: etwa,
man habe es nicht besser wissen können, es handele sich also um keinen
eigentlichen Fehler, sondern höchstens um einen Irrtum, der Kritiker vergrei
fe sich also in der Kategorie. Woody Allen versucht es mit diesem Notbehelf,
als er in Shadows and Fogs es mit Vertretern einer Bürgerwehr zu tun be
kommt, die ihm vorwerfen, sich bei der Verfolgung eines die Stadt in Angst
und Panik versetzenden Mörders vollkommen inkompetent anzustellen. Allen
(beziehungsweise der von ihm gespielte Nonkonformist) hat aber eigentlich
nur versucht, sich aus der Treibjagd herauszuhalten. So ist es nur logisch, daß
seine Antwort, die selbstredend bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe stößt,
lautet: "Ich weiß zu wenig, um inkompetent zu sein!"
Wird die Rechtfertigung nicht akzeptiert, ist man nach einem Fehler gut
beraten, sich Asche aufs Haupt zu streuen und mit einem "mea culpa, mea
maxima culpa" zu versichern, es beim nächsten Mal besser zu machen. Feh
ler bedeuten Versagen: geistiges oder charakterliches, und zu häufiges Ver
sagen wird bestraft: durch schlechtes Zeugnis, in der Schule wie im Beruf
oder in Beziehungen oder im öffentlichen Leben. Daß es dabei Leute gibt, die
aufgrund von Macht oder Chuzpe mit all ihren Fehlern durchkommen, bes
sert den Ruf des Fehlers durchaus nicht.
Vielleicht jedoch ist damit noch nicht alles gesagt. Vielleicht sollte es -
z.B. in der Erziehung - nicht nur darum gehen, Fehler vermeiden zu lernen.
Zunächst einmal: Fehler gehören zum Leben. Wo immer wir etwas Neues
lernen müssen, und geht es auch nur um die Suche nach den besten Früh
stücksbrötchen am Urlaubsort, sind Fehler gar nicht zu vermeiden. Niemand
verdient, bei jedem Fehler, jedem Versagen ohne Ansehen der genauen Um
stände automatisch Schimpf und Schande erleiden zu müssen.
Zudem: Fehler sind aufschlußreich. Die erste Zuschreibung von Schuld
(bzw. die erste Ursachenattribution) greift oft zu kurz und führt damit in die
Irre. Kleinkinder, die den "Fehler" begehen, in die Steckdose zu greifen,
machen darauf aufmerksam, daß die Wohnung nicht kindersicher ist. Wo im
technischen Bereich zunächst menschliches Versagen vermutet wird, steckt
der Fehler oft im System. Eine "Verfehlung" in den Augen der Öffentlichkeit
mag für die betreffende Person gleichgültig oder gar im Interesse der Auf
rechterhaltung persönlicher Integrität geboten sein: dann nämlich, wenn sie
gegen eine soziale Konvention - die Vorschriften des sogenannten guten
Geschmacks; die Erwartungen bezüglich ehrbarer oder anrüchiger Formen
7
partnerschaftlichen Zusammenlebens - verstößt, die sie als verstaubt oder
repressiv erlebt. Nur Gesellschaften, die - im Sinne von Habermas - ein
Quantum an zivilem Ungehorsam aushalten und zur Überprüfung von Tradi
tionen heranziehen, erweisen sich als entwicklungsfahig.
Es gibt Fehler, die unbedingt vermieden werden müssen, weil sie irrever
sible Schäden nach sich ziehen. Andere Fehler können lernträchtig sein -
nicht nur fiir Systeme, sondern zuerst und vor allem fiir die handelnden Indi
viduen. Sie können eine geradezu unersetzliche Erfahrung darstellen: Der
Nachvollzug des Falschen ermöglicht das Lernen des Richtigen. Das jedoch
bedeutet, daß nur aus Fehlern lernen kann, wer die Chance bekommt, in der
Rückschau nachzuvollziehen, worin eigentlich der Fehler besteht und wie es
zu ihm kam. In diesem Sinne lernen nur diejenigen, Fehler zu vermeiden,
denen erlaubt wird, auch Fehler zu begehen.
Aus Anlaß des 60. Geburtstages von Fritz Oser, Inhaber des Lehrstuhls
für Pädagogik und Pädagogische Psychologie an der Universität Freiburg /
Fribourg (Schweiz), fand im Oktober 1997 ein Symposium statt, das unter
dem programmatischen Titel Fehlerwelten eine Expedition in die Welten des
Fehlermachens und des Lernens aus Fehlern unternahm: in die unterschiedli
chen Urteilssphären, in denen die Beurteilung eines Verhaltens nach "richtig"
und "falsch" sehr unterschiedlichen Kriterien - der Wahrheit, der morali
schen Richtigkeit, der künstlerischen Perfektion - folgt; in die Welten, die
sich eröffnen, wenn man die Bedingungen und Chancen des Fehlerlernes
genauer untersucht.
Die Referentinnen und Referenten waren eingeladen, diesen Fragen aus
der Perspektive ihres jeweiligen Faches nachzugehen und dabei auch mutige,
prononcierte, herausfordernde Standpunkte zu beziehen.
Im Zentrum des vorliegenden Bandes steht eine Auswahl dieser Beiträge.
Während das Symposium bewußt interdisziplinär angelegt war, wird hier das
Thema pädagogisch-psychologisch akzentuiert - mit Ausnahme eines provo
kanten theologischen Artikels, auf den einfach nicht verzichtet werden sollte.
Diese Aufsätze haben nicht mehr die ursprüngliche Vortragsform; sie stellen
aber nach wie vor Essays dar.
Die seit dem Symposium vergangene Zeit wurde genutzt, zusätzliche
pädagogische und psychologische Stellungnahmen zum Fehlermachen und
Fehlerlernen und zur Forschung in diesem Bereich einzuholen.
Nachdem sich viele Symposiumsbeiträge auf eine von Fritz Oser vorge
schlagene Theorie des "Wissens um das Negative" (oder kurz: "negatives
Wissen") und ein von ihm initiiertes und geleitetes Forschungsprojekt (in
dem das Lernen in schulischen Kontexten und in der Lebensgeschichte von
Menschen im Mittelpunkt steht) bezogen, lag es nahe, Fritz Oser und seine
Mitarbeiterinnen in diesem Projekt - Maria Spychiger, Tina Hascher und
8
Fabienne Mahler - zu bitten, Theorie und Forschung ausführlicher vorzu
stellen. Zwei Aufsätze dieser Gruppe legen die Grundlagen und bilden den
ersten Teil dieses Buches.
Der mittlere Teil besteht aus den eigentlichen Symposiumsbeiträgen.
Brigitte Rollett geht den psychologischen Grundlagen des Lernens aus Feh
lern nach und stellt Osers Fehlertheorie in den Kontext von Vorstellungen
über eine fehlerfreundliche Schulumwelt. Urs Haeberlin gibt einen histori
schen Abriß von Ansätzen zur "Heilung von Kinderfehlern", die heutigem
heilpädagogischen Denken diametral widersprechen, und betrachtet aus die
ser Perspektive das von Oser und Mitarbeiterinnen vertretene Konzept einer
"Fehlerkultur".
Die folgenden drei Beiträge verhelfen vor allem zu einer differenzierten
Betrachtung unseres Gegenstands. Franz E. Weinert hebt Fehler genauer von
Irrtümern ab und beleuchtet die Janusköpfigkeit von Fehlern im schulischen
Bereich - als Lernchancen und Lernbarrieren. Wolfgang Edelstein spielt die
Unterschiedlichkeit von Kriteriensätzen zur Beurteilung menschlichen Ver
haltens - der verschiedenen Fehlerwelten - durch und vergleicht insbesonde
re Verstöße gegen Konventionen mit moralischem Versagen. Sein Text ent
hält nebenbei eine psychologisch außerordentlich plausible Argumentation
für die (bzw. eine) Rechtschreibreform der deutschen Sprache. Helmut Heid
beschäftigt sich mit den logischen Implikationen von Normen (gegen die zu
verstoßen eben als Fehler betrachtet wird) und diskutiert Autorität als Defni
tions-und Sanktionsmacht in bezug auf Normen.
Die anschließenden beiden Beiträge thematisieren die Frage, wie Fehler
haftigkeit zu beurteilen sei, auf einer fundamentalen, sozusagen ideologi
schen Ebene. Jürgen Oelkers berichtet und analysiert historische Auseinan
dersetzungen über das pädagogische Ziel der Perfektion, der Fehlerfreiheit,
wie es speziell Rousseau vertreten hat. Anton A. Bucher, selbst Professor an
einer katholisch-theologischen Fakultät, beschäftigt sich kritisch mit dem
päpstlichen Unfehlbarkeitsanspruch und, wie Oelkers, mit dem pädagogi
schen Ideal, Menschen zu erziehen, die ohne Fehl sein sollen.
Die "Nachträge" zum Symposium bieten Vertiefungen in verschiedener
Hinsicht. In einigen der vorstehenden Beiträge war Hermann Weimer er
wähnt worden, in den 20er und 30er Jahren Begründer einer pädagogischen,
wissenschaftlich betriebenen Fehlertheorie. Gerhard Glück analysiert Wei
mers Werk - und mahnt zur Vorsicht: Der "Klassiker" der Fehlertheorie, die
sich heute im reformpädagogischen Sinn "vom Kinde aus" definiert, war
nationalsozialistischem Gedankengut alles andere als abhold. Der Text von
Rolf Dubs hat nicht individuelles Lernen, sondern die Bildungspolitik im
Visier. Dubs' Diskussion über Vor- und Nachteile möglicher Orte und For
men der Ausbildung von gymnasialen Lehrkräften in der Schweiz erlaubt
9
Aufschlüsse auch hinsichtlich angemessener Kriterien bei größeren bildungs
politischen Projekten in anderen Bereichen und anderen Ländern.
Die beiden folgenden Aufsätze sind ebenso forschungsintensiv wie span
nend zu lesen. Kurt Reusser zeigt an vielen Beispielen, wie die übliche schu
lische Sozialisation die Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern als Pro
blemlöser verbiegt. Seine "Folgerungen fur eine lernförderliche Fehlerkultur
im Unterricht" werden von ritus Guldimann und Michael Zutavem in sehr
handfeste (Forschungs-)Praxis umgesetzt: Nachdenken über das eigene Ler
nen (und dabei natürlich über gemachte Fehler) und Lernen im Dialog von
Schulkameraden erweisen sich als hochgradig fruchtbar.
Das Buch wird abgerundet durch die Laudatio, die Lothar Krappmann
fur Fritz Oser an einem in das Symposium integrierten Festakt gehalten hat.
Die Rede gibt einen Einblick in Leben und Werk des Geehrten, der die Lern
trächtigkeit von Schwierigkeiten, Fehlern und auch Scheitern zu einem Le
bensprinzip gemacht hat.
Die Edition des vorliegendes Bandes war meine - freigewählte - Aufga
be. Da es jedoch auch, bei allen Erweiterungen, immer noch das Buch zu
"unserem" Symposium ist, soll nicht versäumt werden, den Kolleginnen und
Kollegen Dank abzustatten, die dieses Symposium, den offiziellen Festakt
und die Geburtstagsfeier fur Fritz Oser gelingen ließen. Stellvertretend fur
alle anderen sei besonders Verena Kovatsch und Franz Baeriswyl herzlich
gedankt.
Wolfg ang Althof Fribourg, im Sommer 1999
10