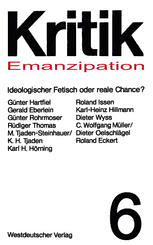Table Of ContentEmanzipation -
Ideologischer Fetisch oder reale Chance?
Kritik Bd. 6
Emanzipation -
Ideologisc.her Fe tisch oder
reale Chance?
Herausgegeben von Prof. Dr. Gunter Hartfiel
Westdeutscher Verlag
© 1975 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1975
Satz: Klaus Griillner, Krefeld
Aile Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Verfielfaltigung des
Werkes (Fotokopie, Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf
der vorherigen Zustimmung des Verlages.
ISBN-13: 978-3-531-11233-6 e-ISBN-13: 978-3-322-88713-9
DOl: 10.1007/978-3-322-88713-9
Inhalt
Einfubrung Gunter Hartfiel 9
Emanzipation als Allerweltsformel . . . . . 9
Emanzipation und Wissenschaft ..... 10
Biirgerlich-liberale und marxistisch-sozialistische
Emanzipation . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Emanzipation und Entfremdung in der Arbeit . 17
Emanzipation und Fortschrittsglaube ..... 21
Emanzipation und menschliche Triebstruktur in
der entwickelten Industriegesellschaft ..... 24
Emanzipation durch "herrschaftsfreie Kommunikation" 30
Emanzipation durch Erziehung . . . . . . . . 33
Emanzipation im spekulativen Meinungsstreit 38
Die Beitrage im Oberblick 43
Anmerkungen ...... 61
Emanzipation - ein Tbema empiriscb-analytiscben
Wissenscbaftsverstli"ndnisses Gerald Eberlein 65
I. "Empirisch-anal ytisches" gegen "Historisch-gesattigtes"
Emanzipationsverhaltnis ............... 65
II. Das Emanzipationsverstandnis des Meta-Pragmatismus 69
III. Emanzipation durch Herrschaftsanalyse ...... 73
IV. Emanzipations-Voraussetzung: "rationaler Diskurs" 77
V. Emanzipation durch "methodische Rationalitat in
asthetisch-kiinstlerische Handlungsbereiche . . . . 79
VI. Die Dimensionen "methodischer Rationalitat" . . 82
VII. Wissenschaftsziel: Informationengewinnung oder
Deutung fundierter Sinngehalte ...... 83
VIII. Interdisziplinare Ideologiekritik ...... 85
IX. Empirisch-analytische Methodenvielfalt und
"Sinnverstehen" .............. 87
X. Probleme sozialwissenschaftlicher Makro-Theorie 90
Xl. SchlulHolgerungen 93
Anmerkungen 94
Ruckblick auf die Emanzipation Gunter Rohrmoser 97
I. Die Dialektik der Emanzipation 97
II. Emanzipation und Demokratieverstandnis 99
5
III. Offene Probleme der marxistischen Perspektive ....... 101
IV. Die Vielfalt der revolutionliren Erwartungen
und Wege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
V. Emanzipation durch Politisierung gesellschaftlicher
Institutionen? ................ 107
VI. Die politische Macht der "kritischen Theorie" . . . 111
VII. Nietzsche gegen Marx . . . . . . . . . . . . . . . . 113
VIII. Nietzsches geschichtsphilosophische Nihilismus-These 117
IX. Der Nihilismus und die Feuerbachsche Religionskritik -
die geistigen Hintergriinde der Emanzipationsbewegung 121
Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Die kalkulierte Emanzipation. Zur Theorie und Praxis
Gesellschaftlicher Transformationsprozesse im
Sozialismus Riidiger Thomas 125
I. Die Theorie der Emanzipation im Werk von
Karl Marx ................. . 125
1. Emanzipation als Strukturproblem: Selbstbe-
stimmung durch strukturelle Gleichheit .... . . . . . . 125
2. Emanzipation als anthropolitisches Problem:
Selbstverwirklichung durch reale Freiheit . ...... . 128
3. Emanzipation als strategisches Problem:
Befreiung von Herrschaft als revolutionlirer
TransformationsprozeB .......... ...... . 130
II. Sozialismus als Praxis. Revolution und Emanzi-
pation in sozialistischen Obergangsgesellschaften . . . . . . . 135
1. Zur Problemgeschichte des Sozialismus in der
Sowjetunion . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2. Die Emanzipation der Alternative als A\1 native
der Emanzipation: Jugoslawiens Weg zum
Sozialismus ....................... . 146
3. Kollektiver Sozialismus: Das chinesische
Konzept als Entwicklungsstrategie . . . 151
III. Die Reformulierung der Marxschen Emanzipationstheorie
im Neomarxismus: Anslitze und Perspektiven einer
Kritik sozialistischer Obergangsgesellschaften 157
Anmerkungen ................... 165
Staatsinterventionismus und Sozialstaatsillusion
M. Tjaden-SteinhauerlK. H. Tjaden 169
I. Staatsintervention und Sozialstaat als politische
Begriffe ..................... . 169
II. Die verfehlte Trennung von bkonomie und Staat 171
6
III. Aufhebung des Klassengegensatzes durch Einkommens-
umverteilung? ................. 174
IV. Staatsfinanzen im Dienste der Krisendli.mpfung 178
V. Die briichige Illusion der Gemeinschaftlichkeit 187
Anmerkungen ............... 189
Emanzipation durch Mitbestimmung? Karl H. Hornig 195
Industriesoziologische Anmerkungen zu einer gesellschafts
politis chen Forderung
I. Technische Entwicklung und Mitbestimmung 196
II. Bewugtsein und Mitbestimmung . 205
III. "Mitbestimmung am Arbeitsplatz" 211
Anmerkungen ......... . 215
Emanzipation durch Eigentum - Die Debatte um Miteigentum
und breit gestreute Vermogensbildung . Roland Issen 223
I. Vermogensverteilung heute . . . . . . . . . 223
II. Stellungnahmen der politischen Parteien . . 231
III. Arbeitnehmer-und Arbeitgeber-Standpunkte 235
IV. Personliches Eigentum oder kollektive Sicherungssysteme? 238
Anmerkungen ....................... 241
Der "kritische" Wirtschaftsmensch in der Leistungs-
und Konsumgesellschaft Karl-Heinz Hillmann 243
I. Die gegenwartige Leistungs-und Konsumgesellschaft 243
II. Die Leistungs-und Konsumgesellschaft und das
Problem der Qualitat des Lebens . . . . . . . . . . 245
III. Die Ablosung des entfremdeten durch den "kritischen" Wirt
schaftsmenschen - Die Umformung der Leistungs-und
Konsumgesellschaft zugunsten von Lebensqualitli.t . . . . 255
IV. Die strategische Position des kritischen Verbrauchers 265
V. Die Emanzipation des Verbrauchers als Aufgabe kritischer
Sozialwissenschaft und politischer Bildungsarbeit 271
Anmerkungen 275
Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Emanzipation und Psychoanalyse Dieter Wyss 279
I. Das Praktische Anliegen . . . . . . 279
II. Die Definition der Emanzipation . . . . 280
III. Emanzipation als Bestandteil der tiefen
psychologisch fundierten Therapie 282
IV. Emanzipation ... Zu was? ... 284
V. Emanzipation und Abhangigkeit . 285
7
VI. Emanzipation und Unbewugtes 287
VII. Emanzipation und Feindbild . 288
Vlll. Liguidieren oder Annehmen? 290
IX. Emanzipation und Selbstandigkeit 292
X. Der Traum yom Tod des grog en Marx 293
XI. Individuelle oder kollektive Emanzipation? 294
XII. "Werde wer Du bist" ......... . 295
XIII. Zum Problem der Frauen-Emanzipation 297
Anmerkungen ............ . 300
Gruppendynamik und Emanzipation
C. Wolfgang Muller/Dieter Oelschliigel 301
V orbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . 301
I. Emanzipation und halbierte Emanzipation . 301
II. Die Entdeckung der Gruppe als Agent indivi-
dueller Veranderung ................. . 305
Ill. Die Vermarktung der Gruppe als Warenhaus der "Liebe" 309
IV. Die Rezeption der Gruppendynamik wider
Bundesrepublik Deutschland ................ . 314
V. Die Rezeption der Gruppendynamik in der
Hochschuldidaktik der BRD 318
Literaturverzeichnis 323
Emanzipation durch Burgerinitiative? Roland Eckert 325
I. Formen der Abhangikeit .... 325
II. Ungleichheit der Einflugchancen 327
Ill. Formen der Einflugnahme .. . 328
IV. Biirgerinitiativen ....... . 332
V. Wirksamkeit der Biirgerinitiativen 335
VI. Grenzen der Wirksamkeit 337
Anmerkungen 339
Sachregister . . . . . . . 341
Personenregister 349
Verzeichnis der Autoren 355
8
Gunter Hartfiel
Einfiihrung
Emanzipation als Allerweltsformel
Uberblickt man die sozialphilosophisch-sozialwissenschaftlichen und
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen etwa der letzten zehn
Jahre
a) urn das Sinnproblem individuellen und gesellschaftlichen Daseins
iiberhaupt,
b) urn den Sinn von Wissenschaft und Bildung in der zukiinftigen
Gesellschaft,
c) urn die zukiinftige Gestaltung der politischen und sozialen
Ordnungsstrukturen,
d) urn die Prinzipien und Methoden, nach denen Menschen fiir ein Leben
in diesen Ordnungen und fiir ein Interesse an solchen Ordnungen
vorbereitet werden sollen,
e) urn die Gliicks-, Humanitats- oder Zufriedenheits-Erwartungen, die
mit solchen Ordnungsvorstellungen verbunden werden, oder
f) urn die handlungspraktischen Notwendigkeiten und Voraussetzungen
fUr solche Ordnungsentwiirfe,
dann ist die Vorherrschaft eines herausragenden' Begriffes nicht zu
iibersehen: "Emanzipation" ist das Schlagwort, mit dem intellektuelle
und politisch-praktische Beitrage zur Veranderung bzw. Uberwindung
bestehender Zustande ihre Bedeutung legitimieren, mit dem samtliche
Hoffnungen und VerheiGungen verbunden werden. "Emanzipqtion" ist
aber auch - und das ist seit der jiingsten "Tendenzwende" zu wieder
mehr Konservatismus und gesellschaftlicher Ruhigstellung immer starker
zu spiiren der Sammelbegriff fUr aile als ordnungs- und
gesellschaftsgefahrdend eingeschatzten Entwicklungen und Aktionen. Fiir
die einen ist Emanzipation der Inbegriff fUr erst wirklich wahr werdende
menschenwiirdige, der menschlichen Natur adaquate Ordnung in den
Sozialbeziehungen und in der Entfaltung individueller Menschlichkeit; fUr
die anderen implizieren die Resultate emanzipatorischer Prozesse
schlimmstensfalls sogar Anarchie, Unsicherheit, Will kiir, Zivilisations
krisen.
Auseinandersetzungen urn Emanzipation haben es immer mit Problemen
der Autoritat, Herrschaft und Macht zu tun, beriihren damit fundamental
die gesellschaftlichen Verhaltnisse der verschiedenen Statuslagen,
EinfluGchancen und Interessen. Das hat zur Folge, daG die Diskussion urn
Nah- und Fernziele, urn Moglichkeiten, Voraussetzungen und Grenzen
9
einer wie auch immer interpretierten Emanzipation nicht im
intellektuellen "Schonraum", gleichsam "in Ruhe" und distanzierter
"Objektivitat", gefUhrt werden kann, sondern sogleich immer Affekte
und Emotionen auslost. Gleichgiiltig, ob als Erlosung verheigende
Vokabel gegen "Unterdriickung", "Verdinglichung", "Entfremdung",
"Abhangikeit", "Manipulation", "Fremdbestimmung" oder "falsches
Bewugtsein" ins Feld gefUhrt oder als Schrecken und Furcht verhejgende
Vokabel ftir "Nivellierung", "gesellschaftlichen Ordnungsverfall", "linke
intellektuelle Arroganz", "VolksverfUhrung", "destruktive Aufsassig
keit", bis hin zu "Revolutionsgefahr", - intellektuelle Anstrengungen
urn das Problem Emanzipation mischen sich fast immer mit
reizauslosender politischer Polemik. Emanzipation ist eben einerseits das
"Prinzip Hoffnung" der Unterdriickten und ihrer "Anwalte" und
anderseits das "Prinzip Argwohn" der Privilegierten und derjenigen, die
versuchen, bestehende Privilegienverhaltnisse theoretisch zu legitimieren.
Emanzipation meinte, ftir Verfechter wie ftir Gegner, zu verschiedenen
Zeiten Verschiedenes. Der jeweilige gesellschaftliche Zustand bestimmte
Zielrichtung und Strategien emanzipatorischer Gedanken und Aktionen.
Oft wird solche historische Einbindung und Begrenzung von Sinn und
Handlungsbezug der Emanzipation tibersehen. Doktrinares Festhalten an
faszinierenden alten Lehren oder stures Zuriickweisen emanzipatorischer
Ideen mit dem Hinweis auf "schlechte Erfahrungen" sind dann die Folge.
Der Hauptgrund fUr Migverstandnisse, scheinbar untiberwindbare
Gegenpositionen und sogar gegenseitige Diffamierungen in der
Emanzipationsdebatte dtirfte jedoch in den spekulativen Annahmen tiber
anthropologische Grundbefindlichkeiten des Menschen und tiber
unabdingbare Funktions- und Strukturbedingungen menschlicher Gesell
schaft liegen. Was im Bereich wissenschaftlich-theoretisch konkurrieren
der Hypothesensysteme relativ folgenlos bleibt, wird - nutzbar gemacht
fUr Positionen in der Emanzipationsdebatte - zum praktisch-politischen
Instrument. Wo subtile Gedanken aus sozialwissenschaftlichen Modellen,
Gegenwartsinterpretationen und perspektivischen Utopien zu Fetzen von
Handlungsanweisungen und zu Schnellschugargumenten werden, degene
rieren Emanzipationsdebatten zu blogen gegenseitigen Vorurteils- und
Ideologie-Verdachtigungen. Aber auch dort, wo Emanzipation, entweder
als Formel oder als Popanz, zu einer Leerformel, zur Wortmarke mit
total em logischen Spielraum wird, ist eine fruchtbare Verstandigung (und
sei es tiber unauflosbare Gegensatze) nicht mehr moglich.
Emanzipation und Wissenscbaft
Die heftigen Dispute urn den erst wieder vor eta 10-15 Jahren popular
gewordenen Emanzipation-Begriff sind vorab, unter esoterisch "Einge
weihten", verstandlich vor allem darum, weil man mit diesem Begriff sich
10
gegenseitig Sinn und Rdevanz der wissenschafdichen Arbeit bestreitet.
Das Thema "Emanzipation" ist bis in die Gegenwart ein Streitpunkt
verschiedener Theorie-Verstiindnisse geblieben. 1m Bereich der Sozial
wissenschaften haben insbesondere zwei Deutsche Soziologentage und
eine Interne Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fUr Soziologie die
Fronten gekliirt (1) und in ihrer nachtriiglichen Aufarbeitung eine Fiille
von erkenntnistheoretisch-methodologischer sowie wissenschafts-politi
scher Literatur ausgdost. (2) Seitdem spricht man von "empirisch-nomo
logischem" bzw. ,,~eopositivistisch-analytischem" Wissenschafts- und
Theorie-Begriff auf der einen Seite und von "emanzipatorischem" bzw.
"kritisch-dialektischem" Ansatz auf der anderen. Vertreter des letzteren
bemiingdn, daB ihre Kontrahenten Wissenschaft nur nach dem Prinzip
einer "halbierten Rationalitiit" (Habermas) betreiben wiirden, weil ihr
sog. "strenger Wissenschaftsbegriff" jegliche Orientierung an realitiits
kritischen Erkenntnisabsichten verwerfe und sich darauf beschriinke,
wissenschaftliche Aussagen zu gewinnen, die beim Vorliegen eindeutig
identifizierbarer Ausgangsbedingungen das Eintreffen gewisser Ereignisse,
Zustiinde und Verhaltensweisen in der Realitiit erkliiren bzw.
vorhersagen. Solche "kritische Rationalitiit" wissenschaftlicher Arbeit sei
darum nur eine "halbe", weil sie wohl (bestenfalls) mit ihren
"Gesetzesaussagen" Aufklarung iiber -gewisse (Einzel-)Zusammenhange
gesellschaftlicher Prozesse verschaffe, aber sich, zugunsten immer
intensiver entwickdter logischer und methodologischer Akribie, gegen
iiber den Problemen der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Arbeit, d.h. der
Genesis ihrer Fragestellungen und der Konsequenzen ihrer Ergebnisse
indifferent verhalte.
An Emanzipation orientierte Wissenschaft miisse demgegniiber sich
dariiber klar sein, daB der von Menschen im gesellschaftlichen System
"Wissenschaft" veranstaltete ArbeitsprozeB dem historisch-gesellschaft
lichen Zusammenhang, den er erkennen will, durch die Akte des
Erkennens hindurch immer schon selbst zugehort, so daB sich das
wissenschafdiche Denken zunachst einmal seiner Angemessenheit an die
objektiven Probleme der spezifisch historischen Realitat vergewissern
miisse. Sozialwissenschaftliche Theorie miisse darum immer eine
reflektiert gegenstandsadaquate, von der "Sache" selbst bestimmte
Methode sein. Theorie sei nicht nur Erkenntnisinstrument, sondern
soziale Wirklichkeit in einer anderen Form. Wissenschaftliche Interessen
und damit Selektion und Aufgabenstellung von Theorien seien eng
verbunden mit den Relationen und Widerspriichen zwischen gesellschaft
lichen Interessenlagen. Allzuoft sei iibersehen worden, daB die
wissenschaftsinternen Konventionen iiber die Standards, nach welchen
Satze und Behauptungen als wissenschaftliche zugelassen werden, immer
schon orientiert seien an den Standards, die gewahlt sind im Hinblick auf
einen bestimmten historisch gebundenen Begriffvon Wissenschaft und im
Hinblick auf einen gesellschaftlichen definierten Leistungserfolg der
11