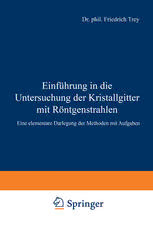Table Of ContentEinfiihrung in die
Untersuchung der Kristallgitter
mit Rontgenstrahlen
Bine elementare Darlegung der Methoden mit Aufgaben
Von
Friedrich Trey Wilhelm Legat
und
Dr. phil., a. o. Professor fllr Physik Dr. phil., Assistent an der Lehrkanzel
an der Montanlstisohen Hochschule fOr Physik der Monlilnlstlschen
Leoben HQchschule Leob"n
Mit 67 Textabbildungen und 1 NomogramI!)'
Wien
Spri ngel'· Verlag
1954
ISBN 978-3-211-80357-8 ISBN 978-3-7091-7838-6 (eBook)
DOI 10_1007/978-3-7091-7838-6
Alle Rechte, insbesondere da..<; der Übersetzung
in fremde Sprachen, vorbehalten_
Softcover reprint ofthe hardcover 1st edition 1954
Vorwort.
Als M. v. LAUE im Jahre 1912 die ersten Rontgenaufnahmen
von Kristallen erhalten hatte, begann ein neuer Absohnitt in
der Gesohiohte unserer Erkenntnis vom' Bau des Stoffes und
vom Wesen der Rontgenstrahlen. Man wuBte ja damals noch
nioht, daB die Rontgenstrahlen wirklioh ihrem Wesen naoh mit
den Lichtstrahlen identisoh seien. Auoh die Abstande der Atome
in den Kristallen waren nooh nioht bekannt. Beide Probleme
fanden duroh den einen Versuch von LAUE die befriedigende,
einfaohe und erschopfende Losung, die von del' damp.Iigen
Generation schon sehnIichst erwartet worden war.
Die seitdem ersohienenen Abhandlungen und Monographieu,
in denen die neuen Erkenntnisse dargestellt sind, wurden von
Physikern fiir Physiker gesohrieben. Nun haben aber die Fein
strukturuntersuchungen mit Rontgenstrahlen eine breite An
wendung in der Technik gefunden, so daB - iiber den Kreis
der Physiker hinaus - das Eindringen in dieses Gebiet flir
eine groBe Anzahl von Technikern zur Notwendigkeit geworden
ist. Dieses Buch soIl den Leser fiir das Studium der Mono
graphien vorbereiten. Mehr alB bisher werden die gedachten ein
und zweidimensionalen Gitter behandelt, und erst im AnschluB
daran wird das dreidimensionale vorgenommen. Die Betrachtung
sowohl der AhnIichkeiten als auch der Unterschiede dieser drei
Gitterarten erleichtert die Aneignung und das Memorieren der
erforderlichen grundlegenden Kenntnisse. Es wird gezeigt, daB
man mit geometrischen Konstruktionen nicht nur iibersichtlicher,
sondern auch schneller als auf rechnerischem Wege zur Angabe
der vorauszusehenden Verteilung von Schwarzungspunkten oder
Linien auf einem Schirm oder auf einem photographischen Film
kommen kann.
Bei den Zeichnungen bedienen wir uns dei EWALDschell
Methode des reziproken Gitters, die hiet IiYlltein8!tisch, yom
IV Vorwort.
eindirnensionalen Fall beginnend, au,sgebaut und angewandt
wird. Diese Methode wird von den Spezialisten auf diesem Ge
biet warm empfohlen, hat aber in den bisher erschienenen Lehr
biichern die ihr zukornrnende Beachtung noch nicht gefunden.
Hier wird der Versuch unternornrnen, das reziproke Gitter zum
Fundament der Darstellung zu rnachen. Bei den raumlichen
Zeichnungen wird auBer einigen Schragrissen auch von einfachen
Verfahren der Darstellenden Geometrie Gebrauch gemacht.
Urn dern Leser die Moglichkeit zu geben, sich zu vergewissern,
daB die durchgenornmenen AusfUhrungen auch richtig erfaBt
sind, haben wir eine Reihe von Aufgaben gebracht: Ubungs
aufgaben und Textaufgaben. Die "Obungsaufgaben im ersten
Kapitel des Buches sind klein gedruckt und konnen ubergangen
werden. Die Textaufgaben, deren LOs1J.ng ebenfalls immer gleich
nachfolgt, sind fUr das Verstandnis des weiteren Textes not
wendig. Durch die Aufnahrne von Aufgaben hat das Buch den
Charakter eines Lernbuches bekommen. In einern solchen Buch
Rind Wiederholungen nicht ganz zu vermeiden; ja, es will uns
sogar scheinen, daB fiir diejenigen, welche erstmalig in dieses
schwierige Gebiet eindringen wollen, solche Rekapitulationen
von besonderem Wert sein durften.
Dem Verlag sind wir zu ganz besonderem Dank verpflichtet
fiir die groBe Muhewaltung wahrend der Drucklegung, fUr die
sorgsame Ausfiihrung der Abbildungen und fur das verstand
nisvolle Eingehen auf unsere Wiinsche. Insbesondere danken
wir fur die sorgfaltige Herstellung des beigefUgten Nomogramms.
Erst dieses befahigt den Leser, die Abbildungen wirklich aus
zunutzen und ihre zahlenmaBige Ubereinstimmung mit den
Textangaben zu uberpriifen.
Leoben, im Februar 1954.
Die Verfasser.
Inhaltsverzeichnis.
Selte
Einieitllllg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Auswahl der Streuzentren fiir die Seklllldarstrahlllllg . . 3
2. Das primare Parallelstrahlenbiindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Die vereinfachte Konstruktion der Wegdifferenz. . . . . . . 4
4. Die scharfe Begrenzung der Verstarkllllgsrichtungen (Se-
klllldarstrahlen) .......................... , . . . . . . . . . 5
I. Das eindimensionale Punktgitter oder Liniengitter . . . . . . . . 8
Die Sekundarstrahlen bei senkrechter Inzidenz der Primar.
strahlen ........ , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Die Seklllldii.rstrahien bei schiefer Inzidenz . . . . . . . . . . . • .. 12
Die geometrische Konstruktion der Seklllldarstrahlen bei
senkrechter Inzidem: ............................... 17
Die Konstruktion der Sekundarstrahlen bei schiefer Inzidenz 20
Die raumliche Verteilung der Sekundarstrahlen . . . . . . . . .. 24
Das eindimensionale Gitter mit Basis .................. 25
ll. Das zweidimensionale Punktgltter oder Kreuzgitter . . . . . .. 28
Die Entstehllllg diskreter Seklllldarstrahlen ............. 29
Die Einfiihrung des Ablenkllllgswinkels .. . . . . . . . . . . . . . .. 31
Der Abstand benachbarter N etzgeraden einer beliebigen
Schar ...... , , .. ' , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34
Die Indizierung der N etzgeraden nach MILLER ...••.•.•• 35
Die Indizierung der Seklllldarstrahien. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
Die Indizierllllg der Seklllldarstrahlen eines llllbekalUlten
Kreuzgitters . ..,.................................. 40
Anwendllllgsbeispiele , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43
Das reziproke Kreuzgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44
Die Anwendung des reziproken Gitters. . . . . . . . . . . . . .. 47
Geometrische Konl'ltruktion der Seklllldarstrahlen . . . . . . .. 48
Ill. Das dreidimensionale Punktgltter oder Raumgitter . . . . . . .. 51
Die Unterteil~ der Raumgitter in Netzebenen , ........ 51
Die Unterteilllllg der Raumgitter in Pllllktreihen ........ 56
Die formale Koordination der Wellenliinge mit der Richtung
der Primarstrahlen ................................. 57
Das reziproke Raumgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58
VI Inhaltsverzeichnis.
Seite
Die Eigenschaften des reziproken Raumgitters .......... 59
Vom reziproken Gitter zum Sekundarstrahl . . . . . . . . . . . .. 60
Die Indizierung der Sekundarstrahlen.......... . . . . . . . .. 61
Das LAuE·Verfahren ........ .... ....... ...... . . ... .... 63
Die PuIvermethode von DEBYE und SCHERRER.......... 70
Das Aussehen der PuIverdiagramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74
Die Anwendung der Pulveraufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74
Die Bestimmung der Art der Elementarzellen im kubischen
Raumgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
Die Drehkristallmethode ............................. " 80
Die asymmetrische Methode von STRAUMANIS ........... 92
Das fokussierende SEEMANN -BOHLIN -Verfahren. . . . . . . . . .. 95
Die Riickstrahlkammern ohne Fokussierung......... .... 97
Die Riickstrahlkammern mit Fokussierung...... ........ 97
Die fokussierende Ringfilmkammer von REGLER . . . . . . . .. 98
Die Kompensationsmethode von KOSSEL. . . . . . . . . . . . . . .. 100
Schlul.3wort .............................................. 104
Anhang ................................................. 105
I. Die giinstigen Richtungen der Primarstrahlen bei gege-
benem 1 .......................................... 105
II. Zur Indizierung von Drehkristallaufnahmen . . . . . . . . . . . .. 108
III. Die Gesamtheit der Sekundarstrahlen einer Drehkristall-
aufnaJune .....•............................. " ....• 110
IV. Nomogramm zu den Abbildungen der reziproken Gitter .. HI
V. Trigonometrische Zahlen ..............................• 112
Literaturverzeichnis ................................ 113
Einleitung.
Kristalle bestehen aus Atomen, deren regelmaBige Anordnung
im Raum als vollkommen angenommen werden kann. Jedes
einzelne Atom hat dann im Kristallverband seinen festgelegten
Platz. Urn zu einer Vorstellung von einer solchen idealen Raum
erfiillung zu gelangen, gehen wir vom Wiirfel als einfachstem
Raumelement aus. Man kann gleich groBe Wiirfel so iibereinander
und umeinander aufbauen, daB an einer jeden Wiirfelecke immer
acht Wiirfel zusammenstoBen. Auch gleiche Quader lassen sich
in dieser Weise im Raum anordnen. Man denke zum Beispiel
an das Eisengeriist von Betonbauten. Die Eckpunkte aufeinander
folgender Wiirfel oder Quader liegen in den drei Koordinaten
richtungen, in jeder gleich weit voneinander entfernt. Man erhalt
so vollkommen regelmaBige periodische Anordnungen von Eck
punkten oder iiberhaupt Punkten im Raum und nennt solche
Gebilde Raum-Punktgitter oder einfacher Raumgitter. Einzelne
Punktreihen, auch Liniengitter oder lineare Punktgitter genannt,
und Punktebenen, auch Flachen-Punktgitter oder Kreuzgitter
genannt, sind untergeordnete Teile des Raumgitters. In den
Gitterpunkten liegen bei den Kristallen die Kerne der Atome,
die von ihren Elektronenhilllen umgeben sind. Die entstandenen
Elektronenanordnungen haben daher stets dieselbe Periode wie
die Kerne, oder, mit anderen Worten, die Abstande gleichwertiger
Raumpunkte (Identitatsabstaml) simI bei den Kernen und bei
den Elektronen dieselben. Die kleinstmogliche Kombination von
Kernen und Elektronen, die sich im Kristall immer wiederholt,
nennt man eine Elementarzelle. Die Raumgitter der Kristalle
sind also Punktgitter im Gegensatz zu den aus der Optik des sicht
baren Lichtes bekannten Strichgittern: Diese bestehen aus aqui
distanten Strichen oder Spalten, jene aus Punkten. In der Be
zeichnung "Raumgitter" ist der Punktcharakter der Kristallgitter
Trey u. Legat, Untersuchung der KristaHgitter.
2 Einleitung.
schon mit inbegriffen. Die regelmiiBige Anordnung der Atome im
Raumgitter wird am zweckmiiBigsten durch die Angabe der Atom
abstande oder genauer der Kernabstande in den drei Koordinaten
richtungen beschrieben (Abb. 1). Man nennt die Abstande benach
barter Atome Gitterkonstanten und bezeichnet sie in der Reihen
folge der Koordinaten x, y und z mit den Buchstaben a, b und c.
Rontgenlicht, das durch einen Kristall hindurchgeht, wird
von den in dessen Raumgitter eingelagerten Elektronen gestreut
und erleidet dabei eine
y
l v / / / ahnliche Veranderung wie
/ V ./ h / ~'i das sichtbare Licht beim
/
/ V~ V~ / ,.ij ~ Durchgangdurch ein Strich
V V /. ./ /. /./ /. gitter: Infolge von Inter
L V Iv /. /. /. // . / /1/ ./~ ~ ferenz verstarkt sich das
./ /. .// V gestreute Rontgenlicht in
L / /. V /. ./ L ~ ganz bestimmten Rich
L V I / 1 V tungen; dazwischen liegen
V L ./ v ./ V ./ dunkle Gebiete, in denen
c L l/ V / die Lichtwellen einander
l,,1 V V V .r
bei der Dberlagerung von
Abb. 1. Dn lIallm~lt.ter der Krl (aUe (mit elnem Wellenberg und Wellental
uge'* '" M'e*'h en). II, blind c - Gltt rkon lnnl n. ausloschen. In der Optik des
II b '*' c - clnfaches rhomlJlsches Gitter.
II - b c - infachCl! t tra~oJlal Itter. sichtbaren Lichtes nennt
a '" b - c - clnf.1ehes kublsches Gitter. man diese Erscheinung
Beugung und spricht von
"abgebeugten" Strahlen. Bei Rontgenlicht werden diese Vorgange
am besten so beschrieben, daB man neb en der einfallenden Primal'
strahlung von einer sekundar auftretenden Streu- oder SekundaI'
strahlung spricht, die von den primal' bestrahlten Atomen bzw.
Elektronen ausgeht, und zwar von jedem einzelnen Streuzentrum
aus nach allen Richtungen des Raumes. Eine unermeBlich groBe
Zahl von Kugelwellen geht dabei in den umgebenden Raum hin
aus, abel' im groBten Teil des Raumes heben sich die von den ver
schiedenen Atomen eintreffenden Wellen der Sekundarstrahlungen
gegenseitig auf, und nur in einigen wenigen ganz bestimmten
Richtungen summieren sich die Lichtimpulse. Diese Richtungell
werden durch die Art des Raumgitters und die Wellenlange des
Rontgenlichteis bestimmt. Urn die Struktur von Kristallen zu
analysierell, muB man die Beziehungen del' RichtungsgroBen
Auswahl der Streuzentren fUr die Sekundarstrahlung. 3
der "Sekundiirstrahlen" zu den Gitterkonstanten (a, b, c) und der
WellenHinge (Ao) des Rontgenlichtes kennenlernen. Diese Aufgabe
I\ird durch folgende vier Annahmen wesentlich erleichtert.
1. Auswahl der Streuzentren filr die Sekundiirstrahlung. Geht
man etwas naher auf den Mechanismus der Streuung von Rontgen
strahlen ein, so ergibt sich folgendes Bild: Schwingungsfahige
Gebilde sind vor allem die Elektronen der Atomhiillen; sie werden
durch die auftreffende Strahlung zum Mitschwingen gebracht.
Diese erzwungenen Schwingungen der Elektronen verursachen
ihrerseits die Ausstrahlung von sekundaren Wellen, und das ist
die Sekundarstrahlung. Die experimentellen Ergebnisse recht
fertigen die Annahme, daB hierbei zwischen der Aufnahme der
Strahlungsenergie und der Ausstrahlung der Sekundarwellen
keine weiteren, die Frequenz oder die Phase der Schwingungen
verandernden V organge eingeschaltet sind. N ur unter diesen
Umstanden ist iiberhaupt eine Interferenz der gestreuten Sekundar
wellen moglich, und nur so kann es zur Verstarkung der Sekundar
strahlung in bestimmten Richtungen bzw. zur Schwachung oder
sogar AuslOschung in anderen Richtungen kommen. In jedem
einzelnen Fall werden aIle diese Richtungen, und speziell die fUr
die Strukturanalyse wichtigen ausgezeichneten Richtungen der
Verstarkung, durch die Verteilung der Elektronen im Kristall
gitter bestimmt. Stellen mit groBerer Elektronendichte wechseln
im Kristall in regelmaBiger periodischer Folge mit Stellen gerin
gerer Elektronendichte und auch mit den von Elektronen freien
Zwischenraumen abo Die Periodizitat der Elektronenverteilung
hangt aber, wie schon erwahnt, von der periodischen Anordnung
cler Atomkerne im Kristall abo Deshalb konnen wir auch die
Kerne der Atome als Reprasentanten der Periodizitat der Streu
zentren annehmen, miissen aber im Auge behalten, daB ihr eigener
Anteil an der Beeinflussung der Strahlung verschwindend klein
ist. Erstens ist ihre Zahl kleiner als die der Elektronen, und
zweitens ist die Beweglichkeit der Kerne ihrer tausendmal groBeren
Masse wegen sehr viel geringer als die Anpassungsfahigkeit der
I ichten Elektronen an die Schwingungen des iiber sie hinweg
streichenden elektromagnetischen Feldes der auftreffenden Strah
lung. Wenn wir trotzdem gerade die Kernabstande oder Gitter
konstanten a, b und c fUr die Angabe der periodischen VerteiIung
der Streuzentren in Anspruch nehmen, so wird diese Wahl durch
4 Einleitung.
die hiermit erzielte Vereinfachung der Beschreibung vollauf
gerechtfertigt. Wir ubergehen also die Elektronen und leiten die
Beziehungen zwischen den Rontgenstrahlen und der Kristall
struktur so ab, als ob die gesamte Sekundarstrahlung von den
Atomkernen ausginge.
2. Das primare Parallelstrahlenbiindel. Bei der Untersuchung
der Feinstruktur der Kristalle blendet man aus der Strahlung der
Rontgenrohre ein ganz schmales Strahlenbundel so heraus, daB
es moglichst von allen Seiten parallel begrenzt ist und daher als
Parallelstrahlenbundel gelten kann. In Wirklichkeit gibt es
weder beim sichtbaren Licht noch bei Rontgenlicht Bundel von
streng parallelen Strahlen. In der Optik, zum Beispiel bei den
FRAUENHOI<'ERSchen Beugungserscheinungen, schafft man sich
annahernd parallele Strahlen, indem man eine moglichst punkt
formige Lichtquelle im Brennpunkt einer Linse anordnet. In
der Rontgenphysik fehlt dieses Mittel; man muB sich, so gut es
geht, damit behelfen, den Abstand des Kristalls von der Rontgen
rohre ausreichend groB zu nehmen und schmale Blenden zu ver
wenden: Dann konnen die Strahlen als Parallelstrahlen betrachtet
werden, und die im Bereich des Streukorpers ankommenden
Wellen als ebene Wellen gelten. Die Berechnung divergierender
Strahlen ware auBerordentlich kompliziert. Die modernen
Feinstrukturanlagen, deren Blendenrohren bei 1 mm Offnung
6 cm lang sind, geniigen den gestellten Anforderungen, so daB
man berechtigt ist, die prim are Strahlung als Parallelstrahlen
bundel zu behandeln.
3. Die vereinfachte Konstruktion der Wegdifferenz. Die
wunderb are RegelmaBigkeit im Aufbau der Kristalle gestattet
es, bei den Betrachtungen aus der uniibersehbaren Menge der
Streuzentren immer nur einige wenige, oft sogar nur zwei oder
drei benachbarte Atome herauszugreifen. Aus ihrer Zusammen
arbeit schlieBt man dann auf die Zusammenarbeit aller iibrigen
Atome. Wahlen wir irgendeinen Auftreffpunkt des Lichtes auf
einem Leuchtschirm (Abb. 2), so fiihren zu diesem Punkt von den
zwei Atomen A und B im Grunde genom men auch zwei Wege
verschiedener Richtung. Da aber aIle unsere experimente llen
Vorrichtungen und auch insbesondere die Entfernung des Auf
fangschirmes vom Kristall sehr groB gegeniiber den Atomab
standen in den Kristallen sind, diirfen wir die beiden Richtungen