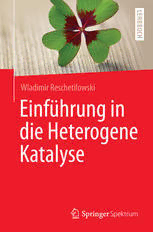Table Of ContentEinführung in die Heterogene Katalyse
Wladimir Reschetilowski
Einführung in die
Heterogene Katalyse
Wladimir Reschetilowski
Institut für Technische Chemie
Technische Universität Dresden
Dresden, Deutschland
ISBN 978-3-662-46983-5 ISBN 978-3-662-46984-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-46984-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Spektrum
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht aus-
drücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk be-
rechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in
diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch
die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des
Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Planung: Rainer Münz
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer-Verlag Berlin Heidelberg ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science + Business Media
(www.springer.com)
Vorwort
In der modernen Chemie und chemischen Technologie nehmen heterogen kataly-
sierte Reaktionen einen immer bedeutenderen Platz ein. So laufen großtechnische
Prozesse in der chemischen Industrie zu mehr als 85 % unter Nutzung von festen
Katalysatoren ab. Auch große Bereiche des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der
nachhaltigen Energieversorgung profitieren seit Ende des zurückliegenden Jahrhun-
derts in einem bis dahin unbekanntem Ausmaß von Katalyseverfahren. Ziel dieser
Verfahren ist es, die ökonomische und ökologische Dimension bei den chemischen
Stoffwandlungsprozessen unter Einsatz von heterogenen Katalysatoren in optima-
ler Weise zusammenzuführen. Demzufolge kommen immer mehr Chemiker und
Chemie-Ingenieure ständig mit der heterogenen Katalyse in Berührung. Einerseits,
weil sie nach Wegen suchen, um die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen und
somit die Produktivität und Energieeffizienz von technisch-chemischen Prozessen
zu erhöhen. Andererseits, weil sie die Maximierung der Ausbeute gewünschter
Produkte bei diesen Prozessen anstreben, um die eingesetzten Rohstoffe möglichst
rückstandsfrei zu Produkten mit hoher Wertschöpfung umzuwandeln. Beides ist
heutzutage weitgehend allgemeingültige Prämisse der modernen Industriegesell-
schaft geworden, und nicht nur die Fachexperten wissen, dass erst Katalysatoren
eine ressourcen- und energieschonende Produktion ermöglichen. Zur Erreichung
dieser Ziele benötigt man jedoch geeignete Mittel, Methoden und Techniken, mit
deren Hilfe eine rationelle Entwicklung von aktiven und hochselektiven Katalysa-
toren erleichtert wird.
Während die heterogene Katalyse in ihrer Frühzeit und darüber hinaus als
„schwarze Kunst“ und „reine Empirie“ verschrien war und noch lange um ihre
Geltung als wissenschaftliche Disziplin zu kämpfen hatte, ist sie heute dank des
immensen Fortschrittes auf den Gebieten der Feststoff- und Oberflächenchemie,
der Oberflächenphysik sowie der chemischen Reaktionstechnik zu einer bedeuten-
den und anerkannten Wissenschaft gereift. Die Aufdeckung von neuen Struktur-
Wirkungs-Beziehungen und die Aufstellung von einprägsamen Theorien führten in
vielen Fällen zum besseren Verständnis der Wirkungsweise heterogener Katalysa-
toren sowie zu einer übersichtlichen Systematisierung der Erkenntnisse und darauf
aufbauend zu praktisch wertvollen Hinweisen oder sogar Vorhersagen für die Ka-
talysatorentwicklung. Heute wird das Design von heterogenen Katalysatoren trotz
ihrer enormen Komplexität und Vielfalt nicht mehr (nur) dem Zufall überlassen,
sondern unterliegt einer gezielten wissenschaftlichen Suche.
V
VI Vorwort
Das vorliegende Buch soll dazu dienen, den Studierenden und jungen Natur-
und Ingenieurwissenschaftlern, die sich in das Gebiet der heterogenen Katalyse
einarbeiten wollen, eine erste Orientierungshilfe zu geben. Diese besteht in der
Vermittlung wesentlicher Grundzüge des Handwerks und der Kompetenzen eines
Katalyseforschers, wie das Wissen über die physikalisch-chemischen Aspekte der
Wirkungsweise fester Katalysatoren, die traditionellen und speziellen Methoden
ihrer Herstellung, die Möglichkeiten der texturellen, strukturellen und oberflächen-
chemischen Charakterisierung sowie der labortechnischen Beurteilung der Akti-
vität, Selektivität und Langzeitstabilität von maßgeschneiderten Katalysatorsyste-
men. Schließlich sollen an ausgewählten Beispielen Ergebnisse eines erfolgreichen
Zusammenwirkens von wissenschaftlicher Grundlagenforschung und praktischer
Erfahrung bei der Entwicklung metallischer, oxidischer und bifunktioneller Kataly-
satoren demonstriert werden. Das wesentliche Anliegen des Buches ist es, das the-
oretische Fundament mit industrieller Anwendung zu verknüpfen, um nicht nur die
Einsteiger, sondern auch die im Beruf stehenden Chemiker und Chemie-Ingenieure
zur intensiven Beschäftigung mit dem fortwährend faszinierenden Gebiet der hete-
rogenen Katalyse anzuspornen.
Im Fokus des Buches steht eine generalisierte inhaltliche Darlegung der hetero-
genen Katalyse. Als Quellen dienten eine Vielzahl an Lehrbüchern, Monografien
und Nachschlagewerken, die am Ende des Buches aufgeführt sind. Manche Bücher
sind etwas älteren Datums, doch viele darin enthaltenen Ausführungen besitzen
auch heute noch ihre Gültigkeit und werden durch Bezüge zu modernen Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Katalyse ergänzt bzw. durch eigene Beiträge erweitert.
Einige Teilaspekte konnten aus Platzgründen nicht erschöpfend behandelt werden
und müssen den Fachbüchern mit thematischen Schwerpunkten vorbehalten blei-
ben. Wer sich einer weiterführenden Beschäftigung mit den einzigartigen Beobach-
tungen bzw. Entdeckungen von herausragenden Katalyseforschern widmen möchte,
dem sei das Studium von Originalpublikationen empfohlen, von denen einige stell-
vertretend ebenfalls genannt sind.
Das Buch beruht auf Erfahrungen, die ich während meiner 40-jährigen Tätigkeit
auf dem Gebiet der Katalyse gesammelt habe, sowie auf eigenen Vorlesungen, die
seit vielen Jahren fester Bestandteil der Ausbildung von Chemikern und Chemie-
Ingenieuren an der Technischen Universität Dresden ist. Bei der Abfassung des Ma-
nuskriptes fanden wertvolle Hinweise und Anregungen vieler Katalytiker-Kollegen
und Freunde aus meiner Merseburger, Leipziger, Frankfurter und Dresdner Zeit Be-
rücksichtigung, denen dafür herzlicher Dank gebührt. In besonderem Maße danke
ich meiner Frau, Dipl.-Chem. Karin Reschetilowski, und meiner Tochter Ina Alex-
andra für das Mitwirken an den Korrekturen sowie für viel Geduld, Verständnis und
Rücksichtnahme in den langen Monaten des Zustandekommens des Manuskriptes.
Ferner danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Doktoranden des
Institutes für Technische Chemie der TU Dresden für hilfreiche Diskussionen, ins-
besondere Frau Dr.-Ing. Ekaterina Borovinskaya, Herrn Dr. Oliver Busse und Herrn
Dipl.-Chem. Axel Thomas für die kritische Durchsicht von Einzelabschnitten sowie
Frau Ina Wittig für die viele Mühe bei der Anfertigung von Abbildungen und For-
Vorwort VII
melschemata. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Rainer Münz, Cheflektor Chemie
des Springer-Verlages, der mich zur Abfassung dieses Buches ermutigte, sowie dem
Springer-Verlag, namentlich Frau Barbara Lühker, für die sachkundige Unterstüt-
zung und hervorragende Zusammenarbeit bei der Erstellung des Buches.
Radebeul, Dezember 2014 Wladimir Reschetilowski
Inhaltsverzeichnis
1 V on kuriosen Phänomenen bis zur wissenschaftlichen Deutung
und industriellen Anwendung der Katalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Anfänge der Katalyseforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Begriffsentwicklung der Katalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 I ndustrielle Anwendung der heterogenen Katalyse . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Modellversuche zu „kuriosen Phänomenen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2 Begriffe und Definitionen in der heterogenen Katalyse . . . . . . . . . . . 11
2.1 Zum Selbstverständnis der Katalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Katalysatorleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.1 Katalysatoraktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.2 Katalysatorselektivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.3 Katalysatorstandzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 K atalysatorbeschaffenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3 Katalysatorklassifizierung, -vorauswahl und -präparation . . . . . . . . 29
3.1 Grundtypen heterogener Katalysatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Methoden der Katalysatorpräparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2.1 Metallkatalysatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2.2 F ällungskatalysatoren und Katalysatorträger . . . . . . . . . . . . 35
3.2.3 Zeolithkatalysatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.4 Trägerkatalysatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.5 K atalysatorformkörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3 Modellversuche zur Katalysatorpräparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 Grundlagen der heterogenen Katalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.1 Ablauf heterogen katalysierter Reaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2 Physisorption und Chemisorption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.3 A dsorptionsgleichgewichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.4 Modellversuche zur Adsorption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5 Methoden zur Bestimmung der Katalysatorparameter . . . . . . . . . . . 67
5.1 Kennzeichnung der Textur, Porosität und Oberflächengröße . . . . . 67
5.2 Festkörper- und oberflächenanalytische Charakterisierung . . . . . . . 75
IX
X Inhaltsverzeichnis
5.2.1 V olumenmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.2.2 O berflächenmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6 Methoden zur Bestimmung der Katalysatorleistung . . . . . . . . . . . . . . 91
6.1 Auswahl von Versuchsreaktoren für kinetische Messungen . . . . . . 91
6.2 Analyse kinetischer Messdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.3 V ersuchsplanung und Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.4 M odellversuche zur Katalysatoraustestung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7 K inetik heterogen katalysierter Reaktionen und
Reaktionsmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.1 Mikrokinetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.1.1 O berflächenreaktion als geschwindigkeitsbestimmender
Schritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.1.2 K inetische Ansätze nach Hougen-Watson . . . . . . . . . . . . . . 117
7.2 Makrokinetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7.2.1 Filmdiffusion und Reaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7.2.2 P orendiffusion und Reaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7.2.3 E influss der Diffusion auf die Reaktionsselektivität . . . . . . 133
8 Theoretische Konzepte in der heterogenen Katalyse . . . . . . . . . . . . . . 137
8.1 G eometrische und energetische Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.2 E lektronische Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
8.2.1 E lektronentheorie der Katalyse an Metallen . . . . . . . . . . . . 151
8.2.2 E lektronentheorie der Katalyse an Halbleitern . . . . . . . . . . 156
8.3 D as Prinzip der lokalen Wechselwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
9 Katalyse an Metallen und Metalloxiden in Hydrierreaktionen . . . . . 165
9.1 A ktivierung des Wasserstoffs und der Kohlenwasserstoffe . . . . . . . 165
9.2 H ydrierkatalysatoren und ihre Wirkungsweise . . . . . . . . . . . . . . . . 171
9.2.1 H ydrierung von Olefinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9.2.2 H ydrierung von Kohlenstoffmonoxid . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.2.3 Asymmetrische Hydrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
9.3 R eaktionsbeispiele industrieller Hydrierkatalyse . . . . . . . . . . . . . . 181
10 Katalyse an Metallen und Metalloxiden in Oxidationsreaktionen . . . 189
10.1 A ktivierung des Sauerstoffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
10.2 Oxidationskatalysatoren und ihre Wirkungsweise . . . . . . . . . . . . . . 191
10.2.1 S elektivoxidation von Olefinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.2.2 O xidation von Kohlenstoffmonoxid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
10.2.3 T otaloxidation von Kohlenwasserstoffen . . . . . . . . . . . . . . . 199
10.3 R eaktionsbeispiele industrieller Oxidationskatalyse . . . . . . . . . . . . 201
Inhaltsverzeichnis XI
11 Säure-Base-Katalyse � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 207
11�1 A llgemeine Prinzipien der Säure-Base-Katalyse � � � � � � � � � � � � � � � 207
11�2 Saure und basische Katalysatoren und ihre Wirkungsweise � � � � � � 213
11.2.1 Bestimmung der Oberflächenacidität und -basizität � � � � � � 213
11�2�2 A ktive Zentren in sauren und basischen Katalysatoren � � � � 217
11�2�3 Effekt der Porengröße und sterischen Restriktionen � � � � � � 224
11�3 Katalytische Wirkung acider Alumosilicate unter dem
Blickwinkel des HSAB-Konzeptes � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 227
11�4 R eaktionsbeispiele industrieller Säure-Base-Katalyse � � � � � � � � � � 229
12 Bifunktionelle Katalyse � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 235
12�1 A llgemeine Prinzipien der bifunktionellen Katalyse � � � � � � � � � � � � 235
12�2 W irkungsweise bifunktioneller Katalysatoren � � � � � � � � � � � � � � � � � 238
12�2�1 S chlüsselstellung der Carbokationen als Intermediate � � � � 240
12�2�2 K atalytische Wirkung bifunktioneller Katalysatoren unter
dem Blickwinkel des HSAB-Konzeptes � � � � � � � � � � � � � � � 243
12�3 Elektronische Metall-Träger-Wechselwirkung und ihre
Konsequenzen für katalytische Reaktionen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 246
12.3.1 Einfluss auf die katalytische Wirksamkeit der
d10-Metalle � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 250
12�3�2 Effekt der Zusatzkomponenten mit
Elektronenakzeptoreigenschaften � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 252
12.3.3 Einfluss auf die Schwefelbeständigkeit � � � � � � � � � � � � � � � � 253
12�4 Wechselwirkung bifunktioneller Katalysatoren mit
Kohlenstoffmonoxid � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 255
12�5 Reaktionsbeispiele industrieller bifunktioneller Katalyse � � � � � � � � 257
Bildnachweis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263
Verwendete und weiterführende Literatur � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 265
Sachverzeichnis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 273