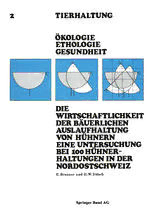Table Of ContentWissenschaftlicher Beirat
Scientific Board
W. Angst, Basel, CH
H. Bach, Linz, A
H. Bartussek. Irdning, A
M.A.S. Bates, Stamford, GB
W. Bianca, Zürich, CH
G. C. Brantas, Beekbergen, NL
H. Bruhin, Basel. CH
O. Buess, Sissach. CH
M. Cena, Wroclaw. PL
G. Claerr, Strassburg. F
O.J. Coffey. Claygate. GB
M.A. Crawford, London, GB
Bereich und Zielsetzung J. Czak6, GÖdöllö. H
W. Dietl. Zürich, CH
Jede Tierart. auch die der Haustiere. befindet sich in ihrer Entste I. Ekesbo, Skara, S
hungsgeschichte in einer sie formenden Wechselbeziehung zu ih Y. Espmark, Trondheim, N
rer näheren und weiteren. belebten und unbelebten Umgebung. R. Ewbank. Liverpool, GB
Dieser Prozess der Anpassung verläuft so langsam. dass er uns in M.W. Fox, Washington, O.C., USA
der Zeitspanne unseres Lebens als statisch vorkommen muss. Die A. Gigon. Zürich, CH
einzelnen Tiere haben vielfältige Verhaltensformen zu ihren Art G. Graefe, Donnerskirchen, A
genossen und zu den tierischen und pflanzlichen Lebewesen der A. Grauvogl, Günzburg, 0
Umgebung ausgebildet. Diese ständige. mit den natürlichen Um W. Groth, Freising, 0
gebungsbedingungen wechselnde Bereitschaft und Fähigkeit des P. Gutknecht, Mülhausen, F
Organismus. sich auf die fliessenden Veränderungen der Bio J. C. Guyomarc'h, Rennes, F
sphäre einzustellen. also die engeren und weiteren Grenzen des W. Herre, Kie.l, 0
physiologischen und ethologischen Anpassungsbereiches. lassen J. Hess, Basel, CH
Haltungsformen zu. die ökolog'isch sinnvoll und tiergerecht sind. J. K. Hinrichsen, Stuttgart, 0
Diese weh über die ausschliesslichen Nutzungs-und Produktions R.J. Holmes, Palmerston North, NZ
eigenschaften hinausgehenden Aspekte wollen wir umfassender B. O. Hughes, Edinburgh, GB
und vertieft kennenlernen. J. F. Hurnik, Guelph, CON
M. Kiley-Worthington, Brighton, GB
Auch die vom Menschen in Abhängigkeit stehenden Tiere sind F. Koväcs, Budapest, H
eigenständige Lebewesen. Die Verantwortung des Menschen be W. Kühnelt, Wien A
gründet sich aus der Tatsache. mit dem Tier in derselben Bio P. Leloup, Aesch, CH
sphäre zu leben und wie das Tier von ihr abhängig zu sein. Aus J. B. Ludvigsen, Kopenhagen, OK
diesem lebendigen. veränderlichen Verhältnis des Menschen zum H. Mommsen, Frankfurt, 0
Tier ergibt sich notwendig eine Basis der Respektierung und Ach J. F. Obermaier, Weckelweiler, 0
tung unserer tierischen Partner. G. Preuschen, Bad Kreuznach, 0
H. Rehm, Mayen, 0
Es besteht ein Bedürfnis für Forschungsergebnisse auf dem öko J. CI. Ruwet, Liege, B
logisch-ethologischen und gesundheitlichen Gebiet. Diese sollen H. H. Sam braus, München, 0
gesammelt als breite Informationsbasis dienen und die Vorausset H. Schaefer, Heidelberg, 0
zung zum Aufbau und zur Realisierung von ökologisch sinnvollen M. W. Schein, Morgantown, W.VA., USA
und tierentsprechenden Haltungsformen bilden. P. M. Schenk, Rhenen, NL
E. Scheurmann, Giessen, 0
Diese Reihe hat als Informationsquelle Brückenfunktion zwischen W.M. Schleit, College Park, M.O., USA
den verschiedenen an der gesunden Tierhaltung beteiligten Diszi U. Schnitzer, Karlsruhe, 0
plinen und Berufsgruppen. G. H. Schwabe, Plön, 0
O. Senn, Basel, CH
Die Reihe bietet Raum für fundierte Versuchs- und Untersu P. B. Siegel, Blacksburg, VA., USA
chungsergebnisse und darauf fussenden kritisch diskutierten E. Stephan, Hannover, 0
Überlegungen. G. Tembrock, Berlin, DDR
E. Trumler, Bad Königshofen, 0
H. Vogtmann, Oberwil, CH
H. Wackernagel, Basel, CH
R. G. Warner, Ithaca, N. Y., USA
U. Weidmann, Leicester, GB
W. H. Weihe, Zürich, CH
E. Wolff, Stutensee-Blankenloch, 0
K. Zeeb, Freiburg, 0
E. Zimen, Waldhäuser, 0
V. Ziswiler, Zürich, CH
Herausgeber / Editor:
O.W. Fölsch
E. Brunner und D. W. Fölsch
1977. Springer Basel AG
ISBN 978-3-7643-0925-1 ISBN 978-3-0348-6467-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-0348-6467-1
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Brunner, Edwin
Die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen Auslauf
haltung von Hühnern: e. Unters. bei 100 Hühner
haltungen in d. Nordostschweiz/E. Brunner u.
D. W. Fölsch. - l.Auft. - Basel, Stuttgart:
Birkhäuser, 1977.
(Tierhaltung; 2)
ISBN 978-3-7643-0925-1
NE: Fölsch, DetlefW.:
Nachdruck verboten. Alle Rechte, insbesondere das der über
setzung in fremde Sprachen und der Reproduktion auf photostati
sehem Wege oder durch Mikrofilm,vorbehalten.
© Springer Basel AG 1977
Ursprünglich erschienen bei Springer Verlag Basel1977
INHALTSVERZEICHNIS
1. Problemstellung 5
2. Die Umfrage 7
2. 1. Methode 7
2.2. Adressmaterial 7
2.3. Fragebogen 8
2.4. Ablauf des Interviews 8
2.5. Erfassungsprobleme 9
3. Der Aufbau der Wirtschaftlichkeitsberechnung 10
3.1. Der Auswertungsbogen 10
3.2. Kosten und Ertrag 10
3.3. Erfolgsmassstäbe 11
3. 3. 1. Direktkostenfreier Ertrag 11
3. 3.2. Arbeitsverdienst 12
3.3.3. Verdienst pro Arbeitsstunde 12
4. Die Produktionsgrundlagen 14
4.1. Allgemeine Beschreibung der Haltungen 14
4. 2. Hühnerbestand und Haltungsdauer 15
4.3. Legeleistung 19
4.4. Futterverbrauch 21
4.5. Arbeitszeit 23
4.6. Eierpreis 26
5. Die Kostenrechnung 27
5.1. Ertrag 27
5.2. Direktkosten 30
5.3. Strukturkosten 34
5.4. Direktkostenfreier Ertrag 37
5. 5. Arbeitsverdienst 38
5.6. Verdienst pro Arbeitsstunde 39
5. 7. Zusammenfassung 40
6. Kalkulationsgrundlagen 42
6. 1. Ertragsbestimmende Faktoren 42
6.2. Kostenbestimmende Faktoren 43
6.3. Empfehlungen bezüglich der Haltungsgrösse 46
6.4. Produktionskosten je Ei 48
6. 5. Kalkulationsbeispiel 49
6.6. Vergleich Freiland-/Batteriehaltung als Nebenerwerb 50
7. Gesamtbeurteilung 54
8. Anhang mit Listen und Tabellen 55
9. Anmerkungen, Literaturverzeichnis und ergänzende Unterlagen 61
Diese Arbeit wurde in dankenswerter Weise durch die
Julius Bär-Stiftung, Zürich, finanziert.
Die Durchsicht des Manuskriptes nahm Herr P.D. Dr. P. Rieder,
Wirtschaftslehre des Landbaues der ETH-Zürich, vor.
1. PROBLEMSTELLUNG
Die Haltung von Hühnern zur Erzeugung von Eiern und/ oder Fleisch erfolgt
vom ökologischen und ethologischen Standpunkt aus auf zwei grundsätzlich von
einander verschiedene Arten:
1. Die bäuerliche Auslaufhaltung, mit Auslauf im Freien; ein Teil des Futters
und der Einstreu ist betriebseigen.
2. Die intensive Haltung in Hallen, d.h. ohne Auslauf; das· Futter wird vor
fabriziert, fertig gemischt, bezogen.
a. Boden-Haltung
b. Käfig-Haltung
Ueber die Kosten und Ertragsverhältnisse in den intensiven Geflügelhaltungen
werden von den interessierten Organisationen regelmässig erscheinende Be
richte verfasst. Entsprechende Berechnungen für die bäuerliche Auslaufhaltung
liegen nicht vor.
1973 wurden in der Schweiz noch 35% aller Legehennen in Beständen bis zu
150 Tieren gehalten. Von den damals insgesamt 85'791 Haltern von Legehennen
besassen 84'842, also 98,9% (!), Kleinbestände von maximal 150 Hühnern
(siehe Anmerkung 1).
Die aktive Förderung und Entwicklung der bäuerlichen Hühnerhaltung ist jedoch
seit dem 2. Weltkrieg in jeder Hinsicht vernachlässigt worden. Keinerlei An
strengungen erfolgten zur Verbesserung der althergebrachten Haltungsmetho
den, der Vermarktung, des Unterrichtes in bäuerlicher Geflügelhaltung. Es
verwundert daher auch nicht, dass über die Wirtschaftlichkeit praktisch keine
brauchbaren Unterlagen mehr zu finden sind.
AUFGABENSTELLUNG
Im Rahmen einer breit angelegten, ökologisch-ethologisch ausgerichteten Un
tersuchung zur Haltung von Legehennen (Fölsch et al., 1976) ist es das Ziel
der vorliegenden Arbeit, die wirtschaftliche Bedeutung der bäuerlichen Aus
lauf-Haltung darzulegen. Wirtschaftlichkeit soll hier im engeren, betriebs
wirtschaftlichen Sinne aufgefasst werden. Auf eine umfassende Darstellung des
gesamten Problemkreises unter Einbezug von gesamtwirtschaftlichen und öko
logischen Gesichtspunkten kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen
werden; einige grundsätzliche Aspekte beleuchtet die umfangreiche Bearbei
tung von Bartussek (1974).
5
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung basieren auf einer Umfrage bei
100 Hühnerhaltern, die im Raum Nordostschweiz im März/April 1976 durch
geführt wurde. Die genaue, ausführliche Darstellung der Berechnungsweise
der zu bestimmenden Werte nimmt auf den folgenden Seiten sehr viel Platz in
Anspruch, wobei auf die Grenzen des Aussagewertes immer wieder hingewie
sen wird. Wir erachten diese Akribie aber als notwendig, nicht zuletzt, um
die Ueberprüfbarkeit der vorgelegten Zahlen zu gewährleisten.
6
2. UMFRAGE
2.1. METHODE
Die Anzahl der zu befragenden Hühnerhalter wurde auf mindestens 100 festge
legt. Es war vorauszusehen, dass nur wenige Halter über exakte Angaben aus
einer Buchführung verfügen würden. Deshalb ergab sich die Notwendigkeit einer
relativ grossen Stichprobe, um brauchbare Durchschnittswerte zu erhalten.
Die briefliche Erhebung wurde für ungeeignet befunden, da viele Fragen nur im
Rahmen eines Gespräches abzuklären waren und oft durch eigene Messungen
ergänzt werden mussten. Auch wäre wahrscheinlich ein grosser Teil der Fra
gen unbeantwortet geblieben, weil die entsprechenden Angaben nicht immer un
mittelbar zur Verfügung standen.
Eine mit entsprechendem Zeitaufwand verbundene persönliche Befragung war
daher unumgänglich. An alle im voraus bekannten Adressen wurde ein einfüh
rendes Schreiben verschickt. Einige weitere Haltungen kamen im Verlauf der
Umfrage durch Hinweise von Nachbarn etc. noch hinzu. Die eigentliche Um
frage fand im März/April 1976 statt.
2. 2. ADRESSMATERIAL
Die "Konsumentenarbeitsgruppe zur Förderung tier gerechter Nutzung von
Haustieren in der Schweiz" (KAG) *, eine Organisation, welche sich speziell
für die Förderung der Freilandhaltung von Hühnern einsetzt, stellte uns ihre
Adressensammlung zur Verfügung. Die Auswahl der zu befragenden Halter er
folgte nach rein geographischen Gesichtspunkten mit der Absicht, die Distan
zen in Grenzen zu halten. Ueber die Haltungen war nebst den Adressen nichts
bekannt.
Es wurden 150 Anschriften ausgewählt, da mit einem Ausfall von rund einem
Drittel zu rechnen war; eine Schätzung, welche sich als recht zutreffend er
wies.
Die Anzahl der Adressen ermöglichte eine Beschränkung der Umfrage auf die
Kantone Zürich, Thurgau und Schaffhausen. Haltungen in grösseren Städten
*) Sekretariat KAG: Gutstr. 130, 8055 Zürich
7
wurden ausgeschlossen, in der Annahme, dass es sich dabei in erster Linie
um Hobby-Haltungen handle.
Wie bei jeder Stichprobenerhebung stellt sich das Problem, ob die Bedingung
der Zufallsauswahl in hinreichendem Masse erfüllt sei. Soweit es sich um die
Auswahl der Adressen aus dem zur Verfügung stehenden Material handelt,
darf unseres Erachtens die Zufälligkeit der Auswahl als gegeben betrachtet
werden.
Ein gewisser Einfluss anderer Art entsteht jedoch dadurch, dass ein Teil der
befragten Halter - etwa die Hälfte, wie sich herausstellte - sich der KAG an
geschlossen haben und daher einen eher überdurchschnittlichen Ertrag erzie
len. Auf diesen Einfluss wird bei der Diskussion der Resultate nochmals zu
rückzukommen sein.
Schliesslich ist noch zu bemerken, dass ein Teil der angetroffenen Kleinst
Haltungen (weniger als 20 Hühner) nicht in die Befragung einbezogen wurde
(siehe Abschnitt 4.2.).
2.3. DER FRAGEBOGEN
Der Fragebogen wurde auf Haltungen ohne Buchführung, d. h. mit sehr einfa
chen oder gar keinen schriftlichen Unterlagen, ausgerichtet. Ein Musterexem
plar findet sich im Anhang.
Die Fragen lassen sich wie folgt gruppieren:
- Allgemeine Angaben über den Halter, insbesondere ob Landwirt/nicht Land
wirt
- Hühnerbestand, Bestandesveränderungen
- Fütterung, Einstreu und diverse Ausgaben
- Hühnerstall und Einrichtung, Auslauf
- Arbeitsarten und Arbeitszeit
- Eierertrag und Verkaufspreise, zusätzlich Verkaufsarti Schlachthennen
Sämtliche Fragen beziehen sich auf das Jahr 1975. Zweck der Fragen ist in er
ster Linie die Erfassung von Daten im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeitsbe
rechnung. Gewissermassen als positiver Nebeneffekt kam eine Fülle von Anga
ben ohne direkten Bezug zur Wirtschaftlichkeit hinzu. Diese werden es nach
entsprechender Auswertung ermöglichen, gewisse Aussagen über die gebräuch
lichen Haltungsmethoden zu machen und daraus die anzustrebenden Verbesse
rungen abzuleiten.
2.4. ABLAUF DER INTERVIEWS
Die Umfrage verlief über Erwarten problemlos. Fast alle der Befragten brach
ten unserem Anliegen sehr viel Interesse entgegen und hatten oft schon die
Unterlagen vorbereitet oder eigene Messungen, z. B. über den Futterverbrauch,
angestellt. Das Interview gliederte sich meist in zwei Teile:
a) ein einführendes Gespräch über die allgemeine Situation der Haltung, wie
Motive zur Hühnerhaltung, Erfahrungen, Zukunftsaussichten, und
b} das Ausfüllen des Fragebogens, ergänzt durch eine Besichtigung und allfäl
lige Messungen.
Wo nötig, wurde der Fragebogen durch handschriftliche Notizen ergänzt.
8