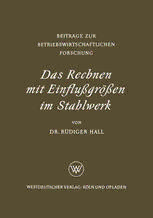Table Of ContentBeiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
herausgegeben von
Prof. Dr. E. Gutenberg, Prof. Dr. W. Hasenack, Prof. Dr. K. Hax
und Prof. Dr. E. Schäfer
Band 5
Dr. Rüdiger Hall
Das Rechnen mit Einflußgrößen
im Stahlwerk
WESTDEUTSCHER VERLAG· KÖLN UND OPLADEN
1959
ISBN 978-3-322-98376-3 ISBN 978-3-322-99122-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-99122-5
Alle Rechte vorbehalten
© 1959 Westdeutscher Verlag, Köln und Opladcll
Umschlaggestaltung: Heinrich Wehmeier
Vorwort
Eines der Hauptanliegen der klassischen Kostentheorie bestand darin, zu klä
ren, in welcher Weise die Kosten eines Betriebes oder Teilbetriebes variieren,
wenn seine Anlagen unterschiedlich genutzt werden. Man stellte die durchaus be
rechtigte Frage nach der Abhängigkeit zwischen dem Beschäftigungsgrad und der
Kostenhöhe.
Die Frage, von welchen Ursachen im einzelnen die Kosten bzw. Verbrauchs
mengen abhängen, blieb demgegenüber im Hintergrund, streng genommen inter
essierte sie auch gar nicht. Gerade diese Frage ist nun aber von größter theore
tischer und praktischer Bedeutung. Jeder Fertigung liegen physikalische sowie che
mische Gesetze zugrunde und der Fertigungsablauf selbst wird durch organisa
torische Maßnahmen bestimmten Regeln unterworfen. Aus dieser Tatsache folgt,
daß sich auch für die Kostenentstehung bestimmte Gesetzmäßigkeiten angeben
lassen. Das Wissen um diese Gesetzmäßigkeiten, um die in einem konkreten Falle
relevanten Kosteneinflußgrößen und ihre Wirkung auf die Kostenhöhe ist nun
zweifelsohne außerordentlich wertvoll und stellt eine der wesentlichsten Voraus
setzungen für eine erfolgreiche Kostenpolitik dar.
Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den Gesetzmäßigkeiten in der Kosten
entstehung eines Elektrostahlwerks. Mit Hilfe mathematischer Gleichungen wer
den diese Gesetzmäßigkeiten dargestellt. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die
Höhe der wichtigsten Kostenarten als Funktion der sie bestimmenden Einfluß
größen zu errechnen. Dieses Verfahren bietet, wie der Verfasser nachweist, gegen
über der in Stahlwerken üblichen Divisionskalkulation erhebliche Vorteile. So
gestattet z. B. die Verwendung mathematischer Gleichungen in der betrieblichen
Abrechnung eine Kostenanalyse und Kostenkritik, wie sie die üblichen Zuschlags
und Divisionsrechnungen nicht zulassen; denn aus den Gleichungen können nicht
nur die jeweils wesentlichen Einflußgrößen ersehen werden, sondern sie geben
darüber hinaus auch über die Wirkung bewußter, gewollter Änderungen dieser
Einflußgrößen Aufschluß.
Nicht immer wird es leicht sein, die genannten Gesetzmäßigkeiten aufzuspüren
und formelmäßig zu erfassen. Wie groß aber auch immer die theoretischen und
praktischen Schwierigkeiten einer solchen Kostenanalyse sein mögen: es steht
ganz außer Frage, daß sich hier ein weites Feld für kostentheoretische und ko
stenpraktische Untersuchungen eröffnet. Die moderne Kostentheorie hat ihren
alten klassischen Rahmen gesprengt. Von vielen Seiten her empfängt sie neue
VI Vorwort
Impulse, auch von den Untersuchungen, die Hall in jahrelanger Arbeit an Ort
und Stelle in Stahlwerken vorgenommen hat. Die "VerbrauchsfunktionenH und
ihre Analyse rücken immer mehr in den Vordergrund des wissenschaftlichen In
teresses. So bedeutsam die Entdeckung der "fixen" Kosten für die Entwicklung
der betriebs wirtschaftlichen Kostentheorie gewesen ist, so sehr drängt die neuere
Forschung auf die wissenschaftliche Durchdringung des Bereiches der variablen
Kosten und damit auf die Aufhellung jener Beziehungen zwischen Aggregat
leistungen und Kosten, die in Form der Verbraucherfunktionen das Kosten
niveau der Betriebe primär bestimmen.
Zu diesem Problem leisten die Untersuchungen von Hall einen wertvollen
Beitrag.
Brich Gutenberg
Inhaltsverzeichnis
1. Die Hauptkostendeterminanten ................................ . 1
1. Der Einfluß des Beschäftigungsgrads ........................... . 1
2. Der Einfluß der Faktorpreise ................................. . 2
3. Die Betriebsgröße bzw. Verfahrenswahl oder Betriebsweise
als Kostendeterminante ...................................... . 2
4. Die Kostendeterminante Faktorqualität ........................ . 4
5. Der Kostenbestimmungsgrund Produktionsprogramm ........... . 4
II. Die Quantifizierung des Kosten verursachenden Gewichts
der wirksamen Einflüsse .•...................................... 7
1. Die Problematik der Einflußgrößen-Rechnung 7
2. Das Erkennen der Einflüsse ............................... . 9
a) Die möglichen Schmelzverfahren im Stahlwerk ............... . 11
b) Die beim Ofenbetrieb wirksamen Einflußgrößen .............. . 12
3. Das Quantifizieren der Einflüsse 14
4. Die Bestimmung des Kosten verursachenden Gewichts der einzelnen
Einflußgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
a) Die Ermittlung der tatsächlichen Verursachung - Die Methode
Stevens - ................................................ 15
1) Lineare Abhängigkeit von nur einer Veränderlichen ......... 15
2) Abhängigkeit höherer Ordnung von einer Veränderlichen .... 17
3) Abhängigkeit der Kosten von zwei oder mehreren Variablen .. 17
aa ) Vorliegen einer multiplikativen Verknüpfung .......... 18
bb) Vorliegen einer additiven Verknüpfung ................ 19
b) Die Beurteilung der Methode Stevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1) Die Kenntnis der bestehenden Abhängigkeit ............... 20
2) Die Kenntnis der wirksamen Einflußgrößen . . . . . . . . . . .. 27
aa) Vernachlässigung einer oder auch mehrerer Einfluß-
größen ........................................... 28
bb) Die Auswirkung fälschlich berücksichtigter
Einflußgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3) Die Genauigkeit der Einflußgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33
VIII I nbaltwerzeicbnis
c) Die Ermittlung der durchschnittlichen Verursachung einer
Einflußgröße ............................................ 35
1) Die Abhängigkeit von nur einer Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
2) Die durchschnittliche Abhängigkeit von mehreren
Variablen ............................................. 38
3) Die proportionale Annäherung Rummels .................. 39
4) Das Maß für die Genauigkeit der angesetzten Näherungs-
gleichungen ........................................... 39
5. Die Grenzen der Einflußgrößen-Rechnung ..................... 40
6. Die funktionale Darstellung der Gemeinkosten-Anteile ...........• 41
a) Die Verrechnung der festen Gemeinkosten .................... 41
b) Die Bestimmung der Anteile an veränderlichen Gemeinkosten. . . .. 42
1) Additive Verknüpfung .................................. 42
2) Multiplikative Verknüpfung .............................. 43
3) Die Bestimmung der Gemeinkosten-Anteile beim Auftreten
einer Exponentialgleichung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
c) Der Unterschied zwischen der Einflußgrößen-Rechnung und den
üblichen Divisions-bzw. Zuschlagsrechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
III. Die rechnerische Ermittlung des Schmelzstromverbrauchs mit Hilfe von
Einflußgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54
1. Die Bilanzgleichung der Wärmeeinnahmen und Wärmeausgaben .... 54
a) Die Reaktionswärmen bei der Stahlerzeugung .................. 55
b) Die Nutzleistung des Elektroofens ........................... 57
c) Die Verlustleistung des Elektroofens ......................... 60
1) Die elektrischen Verluste ................................ 60
aa) Verluste durch Ohm'schen Widerstand .............. 60
bb) Verluste durch Hysteresisarbeit .................... ' 61
2) Die thermischen Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
aa) Verluste durch Wärmestrahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
bb) Verluste durch Wärmeleitung ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63
cc) Verluste durch Kühlwasser und Abgase ................ 63
2. Die Problematik der rechnerischen Ermittlung des Schmelzstromver
brauchs in der praktischen Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66
a) Die Verlust-und die Nutzleistung als Funktion der Strom-
bzw. Schmelzzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71
1) Die Verlustleistung als Funktion der Schmelzzeit ............ 74
2) Die Schmelzzeit als Funktion der Nutzleistung .............. 75
b) Die Verlusdeistung als Funktion der Nutzleistung .............. 77
c) Der Wirkungsgrad des Elektroofens .......................... 78
d) Die Zusammenstellung der gefundenen Beziehungen ............ 78
Inhaltsverzeichnis IX
3. Die Anwendung der gefundenen Zusammenhänge bei 84 Vorschmelzen 79
a) Die Abrechnung der 84 Vorschmelzen nach der
Divisionskalkulation ...................................... 86
b) Die Ermittlung des Schmelzstromverbrauchs mit Hilfe der
Einflußgrößen-Rechnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1) Die Schmelzzeiten sind gegeben .......................... 88
2) Die Schmelzzeiten sind funktional zu errechnen ............. 90
3) Die Berücksichtigung des eingeblasenen Sauerstoffs als
weitere Einflußgröße ................................... 93
c) Der Schmelzstrombedarfje Tonne als Funktion des Einsatz-
gewichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4. Die rechnerische Bestimmung des Schmelzstrombedarfs von Stahl-
schmelzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100
5. Die Zusammenfassung der rechnerischen Ergebnisse. . . . . . . . . . . .. 102
6. Die nomographische Darstellung der gefundenen Zusammenhänge .. 103
IV. Die funktionale Darstellung der Personalkosten .................... 105
1. Die Zurechenbarkeit der Löhne und Gehälter .................... 105
a) Die Ermittlung der anteiligen Lohn-und Gehaltskosten in der
Schmelzenabrechnung ..................................... 106
b) Die Ermittlung der anteiligen Lohn-und Gehaltskosten in der
Tonnenabrechnung ....................................... 108
V. Die rechnerische Ermittlung des Anteils einer Schmelze an den
Deckelkosten ...............•............•..............•..... 109
1. Die Bestimmungsgründe der Deckelhaltbarkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 109
2. Die Deckelhaltbarkeit als Funktion der Schmelzzeit ............... 112
3. Die Deckelhaltbarkeit als Funktion des kWh-und Sauerstoff-
verbrauchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114
4. Die anteiligen Deckelkosten je Schmelze als Funktion des kWh-
Verbrauchs ................................................. 116
5. Die rechnerische Bestimmung der zum Deckelwechsel
günstigsten Schmelze ............................. . . . . . . . . . . .. 120
VI. Das Ergebnis der quantitativen Untersuchungen .......... . . . . . . . . .. 126
1. Die möglichen Methoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126
2. Die Verwendungsmöglichkeit der Betriebsaufschreibung . . . . . . . . . .. 127
3. Die Anwendungsmöglichkeit der Rechnung mit Einflußgrößen . . . . .. 128
Anlagen
I. Die Verbrauchswerte bei 84 Vorschmelzen ....•................... 131
x
I nha/tsverzeichnis
II. Lineare Näherungsgleichung zur Beschreibung der Gesamtverluste
eines 17-t-Lichtbogenofens als Funktion der Schmelzzeit ............. 133
III. Lineare Näherungsgleichung zur Beschreibung der Wärmeverluste
eines 17-t-Lichtbogenofens als Funktion der Schmelzzeit bei einem
Einsatzgewicht von 16 Tonnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
IV. Standardabweichung der nach Gleichung ~ ~:h . hg errechneten Ver-
brauchswerte ................................................. 139
V. Standardabweichung der nach Gleichung ~ ~:h . ~ errechneten
Verbrauchswerte ............................................. 141
VI. Funktionale Darstellung der Wärmeverluste eines 17-t-Lichtbogen-
ofens mit Hilfe der Gleichung Wvg = 40,24' hg - 2918 kWh ......... 142
VII. Standardabweichung der mit den spezifischen Verbrauchsgleichungen
(116, 117 und 118) errechneten Verlustwerte von den tatsächlich
gemessenen bei den Einsätzen von 16, 17 und 18 t. . ............... . 144
VIII. Ermittlung der Wärmeverluste mit Hilfe der allgemeinen Verbrauchs
gleichung und den spezifischen Verbrauchsgleichungenfür die Einsätze
von 16, 17 und 18 Tonnen ..................................... , 145
IX. Standardabweichung der mit Hilfe der Gleichung
hg = kkWW . _ h cpt h = 42W,6lg8 7 mt. n errechneten Soll-Gesamtschmelzze•t ten 147
X. Standardabweichung der mit Hilfe der funktional errechneten Schmelz-
zeiten ermittelten Verbrauchswerte an Schmelzstrom -A - ........... 148
XI. Standardabweichung der mit Hilfe der funktional errechneten Schmelz-
zeiten ermittelten Verbrauchswerte an Schmelzstrom - B - .......... 150
XII. Die Wärmeverluste des Schmelzofens bei einem Einsatzgewicht von
16 Tonnen als Funktion der Stromzeit h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152
XIII. Zusammenstellung der in den Gleichungen benutzten Abkürzungen .. 153
Literaturverzeichnis ............................................... 155
I. Die Hauptkostendeterminanten
Wie aus jeder Kostenstatistik hervorgeht, schwanken die Gesamtkosten eines
Betriebes mehr oder minder stark. Die Ursachen, die diese Veränderungen der
Kosten herbeiführen, sind mannigfacher Art und wirken unabhängig voneinander
auf die Kostenhöhe ein. Um nun deren Änderungen auf die sie bestimmenden Ein
flüsse zurückführen zu können, müssen wir diese zunächst qualitativ, d. h. art
mäßig herausarbeiten.
1. Der Einfluß des Beschäftigungsgrads
Ohne Zweifel ist wohl der Beschäftigungsgrad, d. h. die Produktmenge, die in
einem bestimmten Zeitabschnitt ausgebracht wird, eine der wichtigsten Kosten
determinanten eines Betriebes. Schon früh hat man erkannt, daß Gesetzmäßigkei
ten zwischen Beschäftigungsgrad und Kostenhöhe vorhanden sind, und in der
volks- und betriebswirtschaftlichen Literatur ist immer wieder auf diese Zu
sammenhänge eingegangen worden. Gleichfalls wurde festgestellt, daß die zwi
schen der Größe der Ausbringung und der Kostenhöhe bestehenden Beziehungen
erst dann durch Auswerten empirischen Materials sichtbar gemacht werden kön
nen, wenn die übrigen Kostendeterminanten aus der Rechnung eliminiert oder
aber konstant gehalten werden können, so daß eine unterschiedliche Kostenhöhe
allein nur durch eine Veränderung der ausgebrachten Menge bewirkt wird. Mit
Ausnahme der Untersuchungen Rummels, Stevens und Eulers beschränken sich
die betriebswirtschaftlichen Autoren jedoch allein nur auf den Hinweis, daß auch
noch andere Kostenbestimmungsgründe für die Höhe der Kosten von Bedeu
tung sind. Wenn sie diese jedoch in ihren rechnerischen Ausführungen vernach
lässigen, so mag dies vor allem darauf zurückzuführen sein, daß Veränderungen
des Beschäftigungsgrads ohne weiteres quantitativerfaßbar sind, während es
schwer oder gar unmöglich erschien, die Veränderungen der anderen Determinan
ten mit Ausnahme der Faktorpreise in ihrer Wirkung auf die Kostenhöhe rech
nerisch zu erfassen.
In unserer Behandlung müssen wir deshalb zunächst die Frage aufwerfen,
welche weiteren Kostendeterminanten in ihrer Wirkung auf die Kostenhöhe zu
beachten sind. Dann ist zu prüfen, wie die gefundenen Kostendeterminanten
zur rechnerischen Ermittlung der Kosten verwertet werden können.