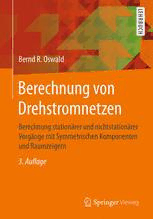Table Of ContentBernd R. Oswald
Berechnung von
Drehstromnetzen
Berechnung stationärer und nichtstationärer
Vorgänge mit Symmetrischen Komponenten
und Raumzeigern
3. Auflage
Berechnung von Drehstromnetzen
Bernd R. Oswald
Berechnung von
Drehstromnetzen
Berechnung stationärer und
nichtstationärer Vorgänge mit
Symmetrischen Komponenten und
Raumzeigern
3., korrigierte und erweiterte Auflage
Mit 107 Abbildungen, 65 Tabellen und 34
durchgerechneten Beispielen
BerndR.Oswald
InstitutfürElektrischeEnergiesysteme
LeibnizUniversitätHannover
Hannover,Deutschland
ISBN978-3-658-14404-3 ISBN978-3-658-14405-0(eBook)
DOI10.1007/978-3-658-14405-0
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschenNationalbibliografie;detaillier-
tebibliografischeDatensindimInternetüberhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
SpringerVieweg
©SpringerFachmedienWiesbadenGmbH2009,2013,2017
DasWerkeinschließlichallerseinerTeileisturheberrechtlichgeschützt.JedeVerwertung,dienichtausdrücklich
vomUrheberrechtsgesetzzugelassenist,bedarfdervorherigenZustimmungdesVerlags.Dasgiltinsbesondere
fürVervielfältigungen,Bearbeitungen,Übersetzungen,MikroverfilmungenunddieEinspeicherungundVerar-
beitunginelektronischenSystemen.
DieWiedergabevonGebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungenusw.indiesemWerkberechtigt
auchohnebesondereKennzeichnungnichtzuderAnnahme,dasssolcheNamenimSinnederWarenzeichen-
undMarkenschutz-Gesetzgebungalsfreizubetrachtenwärenunddahervonjedermannbenutztwerdendürften.
DerVerlag,dieAutorenunddieHerausgebergehendavonaus,dassdieAngabenundInformationenindiesem
WerkzumZeitpunktderVeröffentlichungvollständigundkorrektsind.WederderVerlagnochdieAutorenoder
dieHerausgeberübernehmen,ausdrücklichoderimplizit,GewährfürdenInhaltdesWerkes,etwaigeFehler
oderÄußerungen.
GedrucktaufsäurefreiemundchlorfreigebleichtemPapier
SpringerViewegistTeilvonSpringerNature
DieeingetrageneGesellschaftistSpringerFachmedienWiesbadenGmbH
DieAnschriftderGesellschaftist:Abraham-Lincoln-Strasse46,65189Wiesbaden,Germany
Vorwort zur dritten Auflage
DiedritteAuflageisterweitertumAusführungenzurBerechnungunsymmetrischerLeis-
tungsflüsse und zum zyklischen Auskreuzen der Schirme bei Einleiterkabeln, dem sog.
Cross-Bonding.
Unsymmetrien im Drehstromnetz entstehen durch unsymmetrische Einspeisungen
und oder unsymmetrische Abnahmen, sowie durch unsymmetrische Betriebsmittel.
Unsymmetrische Einspeisungen und oder Abnahmen kommen insbesondere im Nie-
derspannungsnetz z.B. durch die einpolige Einspeisung von Photovoltaikanlagen oder
die ungleichmäßige Aufteilung der Leiter eines Drehstromsystems auf die einpolig
angeschlossenenAbnehmervor.UnsymmetrischeBetriebsmittelsindunverdrillteFreilei-
tungenundEinleiterkabelinebenerLegung.SieweisenunterschiedlicheImpedanzenund
Admittanzen in dendreiLeitern auf. Durchden zunehmendenAnteilvon Kabeln in der
HochspannungsebenemachtsichauchderenUnsymmetrieimLeistungsflussbemerkbar.
DurchzyklischesAuskreuzenderLeiterschirmewerdenbeiderenbeidseitigerErdungdie
SchirmströmeunddiedamitverbundenenStromwärmeverlustereduziert.
DieAusführungenwerdenwieschonindenvorherigenAuflagendurchBeispieleund
dieAuflistungvollständigerMATLAB-FilesfürdiedreipoligeLeistungsflussberechnung
nach dem Knotenpunkt- und Newton-Verfahren, mit denen auch die Beispiele durchge-
rechnetwurden,ergänzt.
Hannover,Mai2017 B.R.Oswald
V
Vorwort zur zweiten Auflage
MitdemzunehmendenAusbauvonErzeugernaufderGrundlageregenerativerEnergien
einerseitsundderStilllegungvonkonventionellenKraftwerkenandererseitsisteineAn-
passungderNetzeandieverändertenKraftwerksstandorteundLeistungsflüssedringend
erforderlich. Allein für das deutsche Übertragungsnetz werden notwendige Leitungszu-
bauten von mehreren tausend Kilometer Länge prognostiziert. Daneben bedarf es eines
umfangreichen Ausbaus und einer grundlegenden Rekonstruktion der Verteilnetze, bis
hin zu den sogenannten Smart Grids, die durch informationstechnische Vernetzung der
dezentralenErzeugerundAbnehmerinderLageseinsollen,einenmöglichstregionalen
Leistungsausgleich herzustellen. Gleichzeitig steigen durch die schwankende Einspei-
sungausWind-undSolarenergieanlagendieAnforderungenandieNetzbetriebsführung
zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Energiequalität. Da Speicher der
erforderlichen Kapazität nicht zur Verfügung stehen, sind besondere unter dem Begriff
EnergiemanagementzusammengefassteMaßnahmenwiez.B.dieVorhaltungvonschnel-
lerRegelleistung,RedispatchundEngpassmanagementnotwendig.
Vor diesem Hintergrundsind Fragen der Netzberechnungnach wievor aktuell. Auch
wennheutedafürleistungsfähigekommerzielleComputerprogrammezurVerfügungste-
hen,istesdennochwichtig,diezuGrundeliegendenmathematischenModellemitihren
AbstraktionenundVereinfachungenzukennen,umdieEingabedatenrichtigaufzuberei-
ten und die Ergebnisse kritisch bewerten zu können. Andererseits eröffnet die Kenntnis
dermathematischenModelledenStudierendenoderinderPraxistätigenIngenieurendie
Möglichkeit, das ein oder andere spezielle Problem unter Nutzung beispielsweise von
MATLABselbstzulösen,ohneaufwändigereComputerprogrammebemühenzumüssen.
Als Beispiel hierfür sind im Anhang MATLAB-Files für die Leistungsfluss- und Kurz-
schlussstromberechnungangegeben.
DasvorliegendeBuchenthältdiewichtigsten Grundlagender BerechnungvonDreh-
stromnetzeninsystematischerknotenorientierterForm(siehedasVorwortzurerstenAuf-
lage). Die Ausführungen sind durch zahlreiche durchgerechnete Beispiele ergänzt. Die
zweite Auflage wurde um zwei Abschnitte zur Fehlerberechnung mit dem Überlage-
rungsverfahrensowieumeinKapitelzurNetzzustandsschätzungerweitert.Damitwurde
ein Bezug zu der insbesondere im Planungsstadium unentbehrlichen Kurzschlussstrom-
berechnungnachdenNormenIECundDINEN60909-0hergestellt,währenddieKennt-
VII
VIII VorwortzurzweitenAuflage
nisdesNetzzustandesVoraussetzungistfürdieÜberwachungdesBetriebszustandesso-
wiefürpräventiveAusfall-undKurzschlusssimulationenzurGewährleistungeinessiche-
renNetzbetriebesauchbeiunvorhersehbarenStörungen.
DerVerfasserdanktdenaufmerksamenLesern,diezurBeseitigungvonDruckfehlern
indererstenAuflagebeigetragenhaben.
Hannover,imOktober2012 B.R.Oswald
Vorwort zur ersten Auflage
Die Netze der elektrischen Energieversorgung sind mit Ausnahme der Bahnstromver-
sorgungundeinigerwenigerHochspannungsgleichstrom-ÜbertragungenDrehstromnetze
verschiedenerSpannungsebenen.
Drehstromnetzeweisen dieBesonderheitauf, dassihreLeiter induktiv,kapazitivund
resistivgekoppeltsind,wodurchdasRechneninLeiterkoordinatenerschwertwird.
Für symmetrisch aufgebaute Betriebsmittel kann durch eine parameterunabhängige
ModaltransformationeineEntkopplungdersoeingeführtenmodalenGrößenoderKom-
ponentenerzieltwerden,dieeinewesentlicheVereinfachungimBerechnungsablaufdar-
stellt.
DermathematischeHintergrundfürdiemodalenKomponentenwirdinKap.1darge-
legtundeswirdgezeigt,dasssichsämtlichegebräuchlichemodaleKomponentenaufeine
einzigeTransformationsmatrixzurückführenlassen.
DieamweitestenverbreitendenmodalenKomponentensinddieSymmetrischenKom-
ponenten. Sie stellen Zeigergrößen dar und werden in den Kap. 4, 5, 6 und 7 für die
Berechnung stationärer und quasistationärer Vorgänge mit Grundschwingungsfrequenz
verwendet.
Das Pendant zu den Symmetrischen Komponentenim Frequenzbereich sind im Zeit-
bereichdieRaumzeigerkomponenten.SiewerdenindenKap.8,9und10überdiebisher
bevorzugte Anwendung auf die Modelle der rotierenden elektrischen Maschinen hinaus
vorteilhaftfürdieBerechnungvontransientenVorgängenimDrehstromnetzangewendet.
Während sich für die Berechnungstationärer und quasistationärer Vorgängemit Zei-
gergrößenimFrequenzbereichdasimKap.3beschriebeneKnotenpunktverfahren(KPV)
bestensbewährthat,fehltebishereinähnlicheinfachzuhandhabendesRechenverfahren
fürdieBerechnungvontransientenVorgängenimZeitbereich.
MitdeminKap.9vorgestelltenErweitertenKnotenpunktverfahren(EKPV)wirddiese
Lückegeschlossen.DasEKPVermöglichtdieAufstellungeinesNetzgleichungssystems
in Form eines Algebro-Differentialgleichungssystems ausschließlich unter Verwendung
der Knotenpunktsätze analog zum gewöhnlichen KPV. Das Algebro-Differentialglei-
chungssystemkannineinreinesDifferentialgleichungs-Systemüberführtwerden,anhand
dessen auch die Berechnung der Netzeigenwerte möglich ist, ohne das mühselige
IX
X VorwortzurerstenAuflage
Aufstellen des vollständigen Zustandsdifferential-Gleichungssystems mit Hilfe von
Knotenpunkt-undMaschensätzenvornehmenzumüssen.
Im Hinblick auf das KPV und das EKPV werden die mathematischen Modelle der
Betriebsmittel(Generatoren,Transformatoren,Leitungen(KabelundFreileitungen),Mo-
toren und sonstige Abnehmer) in einheitlicher systematischer Darstellung durch Strom-
gleichungen für die Berechnung sowohl im Frequenz- als auch im Zeitbereich in den
Kap.2und8hergeleitet.
FürdieBerechnungvonFehlern(KurzschlüsseundUnterbrechungen)wirdimKap.6
mitdemFehlermatrizenverfahren(FMV)einäußersteinfachereinheitlicherAlgorithmus
für alle Fehlerkonstellationen (Einfach- und Mehrfachfehler in beliebiger Kombination)
vorgestellt, der sowohl auf das Knotenspannungs-Gleichungssystem des KPV als auch
dasAlgebro-DifferentialgleichungssystemdesEKPV angewendetwerdenkann.Auf die
Beschreibung der speziellen Verfahren zur Kurzschlussstromberechnung nach den Nor-
menDINVDE0102undIEC60909wurdedagegenbewusstverzichtet,dadieseimBuch
Oeding/Oswald„ElektrischeKraftwerkeundNetze“[3]ausführlichdargelegtsind.
DasBuchistentstandenausVorlesungenzurNetzberechnung,dieichanderTUDres-
den,derTHLeipzig,derUniversitätRostockundderUniversitätHannovergehaltenund
im Laufe der Zeit inhaltlich immer stärker auf eine systematische knotenorientierteBe-
trachtungsweiseausgerichtethabe.DabeisindfastselbstverständlichdasEKPVunddas
FMV entstanden. Für das Studium des Buches werden die Grundlagen der Elektrotech-
nik,insbesonderediekomplexeRechnungunddieGrundzügederMatrizenrechnung,die
sich in ihrer kompakten Form für die verkürzte Beschreibung von Drehstromnetzen be-
sonders anbietet, vorausgesetzt. Um die Beispielrechnungen nachvollziehen zu können,
sindGrundkenntnissevonMATLABnützlich.
Abschließend ist es mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle allen meinen früheren Assis-
tentenundDoktoranden,denenichnichtnurBetreuerseindurfte,sondernvondenenich
aucheineVielzahlvonAnregungenerhaltenhabe,herzlichfürdieBereicherungmeines
Berufslebens,indemichmichglücklicherweisezumgrößtenTeilderForschungundLeh-
rewidmenkonnte,zudanken.
Hannover,2008 B.R.Oswald
Inhaltsverzeichnis
1 SymmetrischeKomponentenundRaumzeiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Modaltransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 SymmetrischeKomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Raumzeiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.1 RaumzeigerkomponenteninruhendenKoordinaten . . . . . . . . . 10
1.3.2 RaumzeigerkomponenteninrotierendenKoordinaten. . . . . . . . 13
1.4 ZusammenhangzwischenRaumzeigerundZeiger . . . . . . . . . . . . . . 16
2 BetriebsmittelgleichungeninSymmetrischenKomponenten . . . . . . . . . 19
2.1 Leitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2 Transformatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.1 BeziehungenzwischendenWicklungsgrößen . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2 BeziehungenzwischendenWicklungs-undKlemmengrößen. . . 30
2.2.3 ErsatzschaltungenfürdieSymmetrischenKomponenten . . . . . . 35
2.2.4 Stromgleichungen für die Symmetrischen Komponentenohne
Übertrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2.5 BestimmungderErsatzschaltungsparameter . . . . . . . . . . . . . 49
2.3 Generatoren,MotorenundErsatznetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.4 NichtmotorischeLasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3 NetzgleichungssystemeinSymmetrischenKomponenten . . . . . . . . . . . 57
3.1 ZusammengefassteDarstellungderBetriebsmittelgleichungen . . . . . . 58
3.2 Knotenspannungs-Gleichungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.1 Gleichungssystem für die Berechnung von Fehlern und der
Netzdynamik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.2 GleichungssystemfürdieLeistungsflussberechnung . . . . . . . . 65
4 Leistungsflussberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1 Knotenspezifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2 Knotenpunktverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.3 Newtonverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
XI