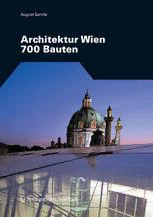Table Of ContentW
August Sarnitz
Architektur Wien
700 Bauten
SpringerWienNewYork
Konzept und Redaktion
August Sarnitz
Redaktionelle Mitarbeit
Eva Santo
Alexander Stampfer
Attila Santo
Auswahl der Objekte (Beirat im Jahr 2007)
August Sarnitz
Matthias Boeckl
Marta Schreieck
Isabella Marboe
Kurt Puchinger
Auswahl der Objekte (Beirat im Jahr 2003 „Wien – Neue Architektur 1975-2005“)
August Sarnitz
Matthias Boeckl
Rainer Schimka
Silja Tillner
Auswahl der Objekte (Beirat im Jahr 1998 „Architektur Wien – 500 Bauten“)
August Sarnitz
Friedrich Achleitner
Otto Kapfinger
Harald Niebauer
Dieter Pal
Dietmar Steiner
Textbeiträge
Vorwort: August Sarnitz
Essay: Renate Banik-Schweitzer: Wien – Stadtentwicklung
Essay: August Sarnitz: Work in Progress – die neuen Projekte
Essay: Matthias Boeckl: Die Stadt als Bühne. Kunst und Entertainment im Stadtleben
Die Textbeiträge geben die persönliche Meinung der Autoren wieder und müssen nicht mit der Meinung der Stadt Wien, der Redaktion
oder des Herausgebers übereinstimmen.
Texte und Daten der Objekte
August Sarnitz und Redaktionsteam
Die Gebäudedaten wurden nach bestem Wissen und aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen erhoben. Informationsquel-
len: Angaben der Architekturbüros, Archiv des Autors, Fachzeitschriften, Nextroom Az W .
Die Namen der Architekten und Architektinnen wurden wunschgemäß laut den Architekturbüros übernommen bzw. entsprechen auch
den zeitlich unterschiedlichen Bezeichnungen. Für allfällige Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Für Hinweise, Ergän-
zungen und Korrekturen danken wir im Vorhinein.
Fotos: Fotonachweis im Anhang
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksen-
dung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch
bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
© 2008 Springer-Verlag/Wien
Printed in Austria
Springer WienNewYork ist ein Unternehmen von Springer Science +Business Media
springer.at
Lektorat Springer-Verlag: David Marold
Grafische Gestaltung: Ing. Martin Gaal/Springer-Verlag
Kartografie Bezirkskarten: Ing. Martin Gaal/Springer-Verlag
Korrektorat: Mag. Sabine Wiesmühler; Mag. Angelika Heller/Springer-Verlag
Druck: Holzhausen Druck & Medien GmbH, Holzhausenplatz 1, A – 1140 Wien
Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier – TCF
SPIN: 12030941
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Dieses Buch ist auch in englischer Sprache erhältlich: ISBN 978-3-211-71578-9.
ISBN 978-3-211-71535-2 SpringerWienNewYork
Inhalt
Einleitung – Hinweise zum Gebrauch............................... 7
Renate Banik-Schweitzer: Wien – Stadtentwicklung .................. 9
August Sarnitz: Work in Progress – die neuen Projekte ................ 28
Boeckl: Die Stadt als Bühne. Kunst und Entertainment im Stadtleben..... 31
1. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 37
Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bauwerke .................................................... 40
2. und 3. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 123
Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Bauwerke .................................................... 126
4. bis 9. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 177
Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Bauwerke .................................................... 180
10. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 239
Karte ........................................................ 240
Bauwerke .................................................... 242
11. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 279
Karte ........................................................ 280
Bauwerke .................................................... 282
12. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 299
Karte ........................................................ 300
Bauwerke .................................................... 302
13. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 315
Karte ........................................................ 316
Bauwerke .................................................... 318
5
Inhalt
14. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 345
Karte ........................................................ 346
Bauwerke .................................................... 348
15. bis 17. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 363
Karte ........................................................ 364
Bauwerke .................................................... 366
18. und 19. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 395
Karte ........................................................ 396
Bauwerke .................................................... 398
20. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 429
Karte ........................................................ 430
Bauwerke .................................................... 432
21. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 443
Karte ........................................................ 444
Bauwerke .................................................... 446
22. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 471
Karte ........................................................ 472
Bauwerke .................................................... 474
23. Bezirk
Übersichtskarte ............................................... 519
Karte ........................................................ 520
Bauwerke .................................................... 522
Wien Umgebung
Übersichtskarte ............................................... 541
Bauwerke .................................................... 542
Chronologie................................................... 556
Register...................................................... 582
Bibliografie ................................................... 589
Abbildungsverzeichnis und Fotonachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
6
Einleitung – Hinweise zum Gebrauch
Architektur Wien: 700 Bauten
Der vorliegende Architekturführer ist ein „Work in Progress“ – ein Führer durch das „Kunstwerk
Stadt“, wie es sich dem heutigen Besucher darstellt. Der Architekturführer ist aber auch das Re-
sultat einer Beschäftigung von über zwanzig Jahren mit der gebauten Umwelt der Stadt Wien.
Seit 2001 ist das Zentrum der Stadt Wien durch eine Entscheidung der UNESCO als Welt-
kulturerbe ausgezeichnet. Damit ist die Wiener Innenstadt in die große Reihe der gebauten
städtebaulichen Monumente aufgenommen, vergleichbar mit dem historischen Zentrum von
Rom, dem historischen Zentrum von Florenz, dem historischen Zentrum von Prag oder der
Altstadt von Krakau.
Die Faszination einer Stadt – die wie keine andere – über Jahrhunderte sowohl das „Zen-
trum“ als auch die „Randlage“ darstellte, reflektiert eine kulturelle, historische und bauliche
Verdichtung, die der berühmte Karl Kraus mit der Aussage umschrieb: „Alt Wien war auch
einmal neu.“
700 Bauwerke (Gebäude, Plätze, Brücken, Denkmäler und Parks) wurden als repräsentative Se-
henswürdigkeiten ausgewählt, die der Stadt ihre Identität verleihen. 2000 Jahre Stadtgeschich-
te wurden erfasst, ungefähr ein Drittel der beschriebenen Objekte fällt in die Zeit vom Mittelal-
ter bis zum Jahr 1918, dem Ende des Habsburger Reiches und dem Zerfall des Vielvölkerstaates
der Donaumonarchie, die anderen zwei Drittel befassen sich mit der Architektur der Zwischen-
kriegszeit bis zur Gegenwart. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Architekturen der bei-
den letzten Jahrzehnte gelegt. Die Aktualität und die neue geopolitische Funktion der Stadt im
Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung soll dadurch besonders dokumentiert werden.
Am Wendepunkt zur neuen „Gründerzeit“ im späten Zwanzigsten Jahrhundert stand sym-
bolisch das neue Haas-Haus (1.-2 ) von Hans Hollein (1985), welches damals als innovativer
urbaner Luxus-Einkaufstempel mit fünfgeschossigem Atrium eine neue, metropole Qualität
des Shopping in das historische Zentrum der Stadt brachte, gegenüber dem jahrhunderteal-
ten Wahrzeichen der Stadt, dem Stephansdom (1.-1). Das mehrgeschossige Atrium und das
ursprüngliche interior design sind heute leider nicht mehr vorhanden.
Die topografische Lage ist wesentliches Merkmal jeder Stadt, aus der sich deren Struktur
und Charakter entwickelt. Bei der Präsentation der Bauwerke wurde daher eine topografische
Reihung vorgenommen, weil sich am jeweiligen Ort die historische, politische, ökonomische
und soziale Struktur durch spezifische Überlagerungen am sichtbarsten verdichtet: die Stadt
als Event der „dichten Packung“.
Die Diskussionen mit Kollegen und Kolleginnen zur Auswahl der Objekte waren vielfältig, um-
fangreich und komplex; die Objekte in der Stadt könnten nicht unterschiedlicher sein: eine Bar,
ein Dom, eine Brücke, ein Palast, ein Wohnhaus, ein Park. Mein besonderer Dank gilt hier im
Laufe der Jahre Friedrich Achleitner, Mattias Boeckl, Elke Delugan, Otto Kapfinger, Isabella
Marboe, David Marold, Harald Niebauer, Dieter Pal, Kurt Puchinger, Rainer Schimka, Marta
Schreieck, Dietmar Steiner und Silja Tillner.
7
Einleitung
Auf 15 Plänen wurden die Bauwerke mit den entsprechenden topografischen Index-Nummern
verortet: Da die Stadt Wien in 23 Bezirke eingeteilt ist, bezeichnet die erste Zahl den jewei-
ligen Bezirk, in dem sich das Bauwerk befindet, die zweite Zahl das Objekt selbst. (Beispiele:
1.-1 Stephansdom = 1. Bezirk, Bauwerk Nummer 1; 13.-1 Schloss Schönbrunn = 13. Bezirk,
Bauwerk Nummer 1). Als Architekten und Architektinnen werden diejenigen Personen ge-
nannt, welche einen wesentlichen Beitrag zur Gestalt und Form des Bauwerkes beigetragen
haben. Historische Architekturen haben daher vielfältige „Schichtungen“ durch Architekten
erfahren, auf die nach Möglichkeit im Kontext verwiesen wird. Bauwerke mit übergeordneter
Bedeutung werden auf einer ganzen oder auf mehreren Seiten vorgestellt: mit Kurztext, Fotos,
Plänen sowie genauer Adresse des Bauwerkes und Hinweisen über Erreichbarkeit mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln sowie Informationen über eine mögliche Besichtigung.
Der Anhang enthält eine chronologische Reihung sämtlicher angeführter Bauwerke sowie ei-
nen Register aller Architekten und Planer.
August Sarnitz, Wien, im Juni 2008
8
Renate Banik-Schweitzer
Wien
Stadtentwicklung
Wien ist mehr als zweitausend Jahre alt. Dieses Alter verdankt die Stadt ihrer strategischen
Lage; dass eine Baugeschichte Wiens bis zur zweiten Türkenbelagerung 1683 immer nur
eine Geschichte des 1. Bezirks ist, ebenfalls. Wien liegt im Schnittpunkt verschiedener Räu-
me und Kulturen und war daher bis zum Ende des 17. Jahrhunderts eine stets umkämpfte
Grenzfestung. Die baulich dokumentierbare Geschichte begann aber erst um 100 n. Chr., als
das römische Legionslager Vindobona als Teil der Limesbefestigung gegen die Barbaren aus
dem Norden angelegt wurde. Nach dem Ende des weströmischen Reiches um 500 n. Chr.
eroberten Hunnen, Awaren und Slawen den Platz. Im 10. Jahrhundert war Wien Teil des sich
nach Westen ausdehnenden ungarischen Reiches, kurz danach wurde es nach Verdrängung
der Ungarn zum südöstlichen Vorposten des deutschen Reiches. Mit der neuen Grenzmark
wurde das fränkische Geschlecht der Babenberger belehnt, und als diese 1137 ihren Sitz von
Klosterneuburg nach Wien verlegten, wurde Wien Residenz. Fast sechshundert Jahre lang
war Wien Grenz- und Residenzstadt.
Die Bürgerstadt Wien konnte sich in dieser Konstellation nur mühsam behaupten. Es fehlten
Sicherheit und Selbstständigkeit, um eine lokal fundierte Entwicklung von überregionaler Aus-
strahlung einzuleiten, wie dies etwa reichsunmittelbaren Städten wie Augsburg und Nürnberg
gelang, die Wien im Mittelalter an Produktivität, Finanzkraft und Bevölkerungszahl überflügel-
ten. Die Auslöser dieses Überholprozesses waren dort einheimische unternehmerisch tätige
Fernhandelskaufleute, die Verlagsproduktionen unter lokalen Handwerkern organisierten und
gleichzeitig einen Kreditapparat aufbauten. Eine solche Gruppierung konnte sich in Wien nie
entwickeln, zum Einen, weil der Einfluss des Landesfürsten zu stark war, zum Anderen, weil
das Wiener Patriziat hauptsächlich von (Grund-)Renten lebte – das einzige Wiener Export-
produkt war der in der Umgebung der Stadt angebaute Wein – und davon so gut lebte, dass
es sich nicht im riskanten Fernhandel engagieren musste. Als Wien 1221 vom Landesfürsten
das Stapelrecht erhielt, letztlich eine weitere Rente in Form einer Handelsspanne auf fremde
Waren, war jeder Anreiz zum größeren Risiko für die Wiener Kaufleute endgültig dahin. So
gelangten zwar immer wieder Wiener Kaufmannsfamilien zu enormem Reichtum, doch kam
es nicht zur Begründung einer eigenständigen Wiener Handelstradition. Die ganze Schwäche
dieses auf dem Stapelrecht begründeten Wiener Handels zeigte sich schließlich zu Beginn des
16. Jahrhunderts, als der Habsburger Kaiser Maximilian l., bei oberdeutschen Handelshäusern,
wie den Fuggern aus Augsburg, schwer verschuldet, diesen den freien Zugang nach Wien ge-
währen und das Stapelrecht aufheben musste. Damit war das Schicksal eines eigenständigen
Wiener Großhandels besiegelt. Von da an waren Großhändler in Wien immer „Fremde“. Ähn-
lich war die Lage im Geldgeschäft. Zwar hatte ein Wiener Bürgergremium vom Landesfürsten
das Recht der Münzprägung erhalten, doch im Kreditwesen dominierten die Juden. Selbst als
diese 1420/21 zum ersten Mal aus Wien vertrieben und die Verbliebenen verbrannt wurden,
gelang es den Wiener Bürgern weder den Steuerausfall wettzumachen noch im Kreditgeschäft
Fuß zu fassen. So wurden die Rentiersmentalität des Wiener Patriziats und die Lokalbezogen-
heit des Wiener Handwerks sehr wirkungsvoll durch die an Vermehrung der eigenen Macht
orientierten Aktivitäten des Landesfürsten gefördert. Die andauernde Grenzlage trug das Ihre
zur Selbstbezogenheit und geringen Außenorientierung des Wiener Bürgertums bei.
9
Kirchliches Gebäude
Hofburg
Adelshaus
Bürgerhaus
Universität
Städtisches Gebäude
Landesfürstliches Gebäude
Ständisches Gebäude
Historischer Stadtstrukturplan Wien,
Innere Stadt, auf Grundlage des Plans von
M. Bonfacius Wolmuet, 1547.
Entwurf: R. Banik-Schweitzer
10