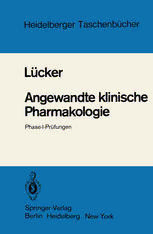Table Of ContentHeidelberger Taschenbiicher Band 214
Peter Wolfgang Lucker
Angewandte klinische
Pharmakologie
Phase-I -Priifungen
Mit Beitragen von W. Rindt und M. Eldon
Mit 19 Abbildungen
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York 1982
Professor Dr. med. PETER WOLFGANG LUCKER
Institut flir klinische Pharmakologie
Rebstockel13
6719 Bobenheim am Berg
ISBN-13:978-3-540-11353-9 e-ISBN-13:978-3-642-68496-8
DOl: 10.1007/978-3-642-68496-8
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
LUcker, Peter Wolfgang:
Angewandte klinische Pharmakologie : Phase I-Priifungen /
Peter Wolfgang Liicker. Mit Beitr. von W. Rindt u. M. Eldon. -
Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1982.
(Heidelberger Taschenbiicher ; Bd. 214)
ISBN- 13: 978-3-540-11353-9
NE:GT
Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbeson
dere die der Ubersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der
Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem Wege und der Speicherung
in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung
vorbehalten.
Die Vergiitungsanspriiche des § 54, Abs. 2 UrhG werden durch die "Verwertungs
gesellschaft Wort", Miinchen, wahrgenommen.
© by Springer-Verlag Berlin'Heidelberg 1982
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1982
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw.
in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annah
me, daB solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung
als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden diirften.
212713130-543210
Vorwort
Unsere Arzneimittel werden immer differenzierter und spezifischer in ihrer
Wirkung.
Die griindliche, vertiefte Priifung neuer Substanzen vor der ersten therapeu
tischen Anwendung ist ein dringendes Erfordernis, urn ScMden von spateren
Patienten abzuwenden.
Die relativ junge Disziplin "klinische Pharmakologie" hat sich dieser
Aufgabe in verstarktem MaBe angenommen.
Den Grundstein legte bereits Paul Martini im Jahre 1947 mit seiner
"Methodenlehre der therapeutisch-klinischen Forschung".
In der Einfuhrung ist zu lesen "Nur einer Therapieform, die einer zureichen
den klinischen Priifung unterzogen worden ist, und die diese bestanden hat,
kann zuerkannt werden, daB sie eine rationale und reale Therapie im engeren
Sinne sei, d. h. daB sie in vo11em Umfang den Anforderungen entspricht, die die
menschliche Vernunft und Ethik in Situationen ste11en miissen, in denen es urn
Gesundheit und Lehre geht".
Dieser Satz ist 35 Jahre alt und hat bis heute an Bedeutung nichts verloren.
Seinen Niederschlag fand er in der Deklaration von Helsinki sowie schluBend
lich im neuen Arzneimittelgesetz yom 24. August 1976.
Weltweit wird die Arzneimittelpriifung in vier Phasen unterteilt. In der
Phase I werden Untersuchungen an gesunden Versuchspersonen durchgefuhrt.
In Phase II wird die Substanz sodann an ein kleines ausgewahltes Ko11ektiv von
Kranken verabfolgt. Die Phase III umfaBt die eigentliche "klinische Priifung" an
groBeren Ko11ektiven. In der Phase IV wird das Arzneimittel, welches aus der
durch die Phasen I bis III durchgelaufenen Substanz geworden ist, nach der
Freigabe zur breiten therapeutischen Anwendung mehrere Jahre weiter ver
folgt, urn nunmehr am groBen statistischen Material Wirkungen und Nebenwir
kungen sauber beurteilen zu konnen. Die Einteilung in Phasen ist heute weltweit
verbreitet und geht auf zwei Publikationen der WHO zuriick.
Das vorliegende Biichlein befaBt sich ausschlieBlich mit der Phase lund sol1
dem praktizierenden klinischen Pharmakologen Anregungen und Erfahrungen
vermitteln.
Mein Dank gehOrt meinen Freunden W. Rindt und M. Eldon, die jeder mit
einem Kapitel zu diesem Buch beigetragen haben, sowie Frau R. Schneider und
Frau M. Kohler fur die sorgfaltige Anlage des Manuskriptes.
Bobenheim am Berg, Januar 1982 P. W. LDcKER
v
Geleitwort
Die Proliferation von Arzneimittelinformationen der letzten Jahrzehnte folgt
wahrscheinlich einer exponentiellen Kurve. Die zahlreichen Studien uber
therapeutische Indikationen, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Arznei
mittelinteraktionen, Nebenwirkungen etc. haben zu weiteren Fachgebieten der
medizinischen Wissenschaften und Hilfswissenschaften gefiihrt. Diese Flut von
Informationen muB ausgewertet werden und solI schlieBlich die Grundlage fiir
eine "rationale und optimale Arzneitherapie" bilden. Das Fachgebiet der
klinischen Pharmakologie hat sich dieser Aufgabe angenommen. In zahlreichen
Landem (namentlich in den USA) wurden und werden nicht nur Wahl- und
Spezialvorlesungen dariiber abgehalten, sondem Abteilungen und Lehrkanzeln
errichtet.
In den letzten 20 Jahren wurden in den meisten Uindem strikte Richtlinien
zur Arzneimittelpriifung von den GesundheitsbehOrden der einzelnen Lander
erlassen, die vielfach den Richtlinien der amerikanischen FDA angepaBt sind.
Damit hat aber die klinische Pharmakologie als Fachgebiet eine neue Aufgabe,
namlich die der Arzneimittelpriifung, erhalten. Es ist dies die erste Verabrei
chung eines neuen Medikamentes am Menschen und dient der ersten Absiche
rung, ehe ein neues Arzneimittel in die breitere klinische Priifung geht.
Mit der Entwicklung der Pharmakokinetik und den kolossalen Fortschritten
auf dem Gebiet der Arzneistoffanalytik (HPLC, RIA, EMIT etc.) bot sich die
Moglichkeit an, durch "drug monitoring" eine wesentliche Verbesserung in der
Rationalisierung und Optimierung der Arzneitherapie zu erzielen. In den USA
gibt es heute zumindest an jedem groBeren Medical Center ein klinisch
pharmakokinetisches Service, welches mit der klinischen Pharmakologie eng
stens zusammenarbeitet. Diese drei Arbeitsgebiete umfassen Forschung, Lehre
und Praxis (Service).
Das vorliegende Buch stellt einen wertvollen Beitrag zur Literatur auf dem
Gebiet der klinischen Pharmakologie dar, indem es sich vor allem an jenen Kreis
wendet, der mit der Arzneimittelpriifung befaBt ist. Das Buch basiert im
wesentlichen auf der Vorlesungstatigkeit von Herm Prof. Dr. Lucker am
University of Cincinnati Medical Center. Die dargestellten Beispiele demon
strieren die zunehmende Bedeutung von nichtinvasiven Methoden in der
Arzn,~imittelforschung.
W. A. RrrSCHEL
Professor of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics,
College of Pharmacy
Professor of Pharmacology and Cell Biophysics,
College of Medicine
Co· Director of Clinical Pharmacokinetics Service,
University of Cincinnati Medical Center VI I
Inhaltsverzeichnis
AUgemeinerTeil. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Standortbestimmung .............. 3
Aufgabenstellung der klinischen Pharmakologie . 7
Rechtliche Grundlagen 11
Ethische Komitees. . 13
Ethische Grenzen . . 17
Versuchsoptimierung 20
Modellcharakter. . . 24
Randbedingungen . . 26
Voraussetzungen fUr eine Priifung in Phase I . 28
Berichterstattung . . . . . . . . . 31
Die Priifung nach GLP-Richtlinien 35
SpezieUerTeil . . . . . . . . . . . 37
Die "dose tolerance"-Studie . . . . 38
Modell zur Priifung einer Substanz mit p-adrenolytischer Wirkung . 43
Modell zur Priifung von Antacida, HrBlockem sowie Substanzen mit
schieimhautprotektiver Wirkung .................... 48
Modell zur Priifung von Arzneimitteln mit Wirkung an der glatten
Muskulatur (Pupillometrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Die psychometrische Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
Modell zur Priifung eines Arzneimittels mit antiphlogistischer Wirkung. 64
Die Priifung von Substanzen, die auf das Endokrinium wirken (W. Rindt) 67
Pharmakokinetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
Die Planung einer pharmakokinetischen Studie . . . . . . . . . . . .. 86
1. Versuch zur Aufklarung des pharmakokinetischen Modells einer
neuen Substanz sowie deren BioverfUgbarkeit . . . . . . . . . . . 88
2. Versuch zur Aufklarung des Kumulationsverhaltens einer Substanz 89
Pharmakokinetik aus Urin. . . . . 92
Pharmakokinetische Nomenklatur . 95
Statistik (M. Eldon) . . . . . . . . 97
IX
Anbang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115
1 "intensive care unit" einer Probandenstation fiir Phase-I-Untersu-
chungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116
2 Einverstiindniserkliirung fiir die Teilnahme an klinischen Priifungen
und Protokoll zur Probandenaufkliirung (Muster) 117
3 GroBer und kleiner Laborstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119
4 Checkliste (Muster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120
5 Gesetz iiber den Verkehr mit Arzneimitteln sowie 4. Richtlinie iiber
die Priifung von Arzneimitteln . . . . . . . 122
6 Deklaration von Helsinki vom 30. Juli 1976 . 125
7 Aufbau eines Priifplans (Muster) . 126
8 Probandenvertrag (Muster) . . . . . . . . 129
9 Kinetikdatentriiger (Muster). . . . . . . . 130
10 American College of Clinical Pharmacology 131
Weiterfiihrende Literatnr 141
Sachverzeichnis . . . . . 145
x
AUgemeiner Tell
Standortbestimmung
Die ldinische Pharmakologie ist eine interdisziplinare Wissenschaft, die
von Arzten betrieben wird und betrieben werden muS, welche jedoch
im ldassischen Sinne des latros bei Betrachtung zumindest einiger
Tatigkeitsmerkmale keine Arzte sind.
1m Gesamtkomplex Medizin ist die ldinische Pharmakologie nur
mittelbar anzusiedeln, da alles Trachten und Wirken in der medizini
schen Diagnostik und Therapie auf das Heilen im weitesten Sinne
ausgerichtet ist, unmittelbar deshalb, da die klinische Pharmakologie
sich die Aufgabe gestellt hat, den Effekt von Substanzen im auSerst
komplexen Organsystem des Menschen besser zu verstehen und somit
dem therapeutisch tatigen Arzt eine rationale Urteilsbildung bei der
Behandlung mit Arzneimitteln zu ermoglichen.
Die klinische Pharmakologie ist im eigentlichen Sinne keine Thera
pieforschung, auch wenn sie damit haufig verwechselt wird.
Die Zielsetzung ist wesentlich enger gesteckt, denn zur Therapiefor
schung geMrt die Erprobung aller denkbaren physikalischen und
physikochemischen Verfahren, wohingegen sich die klinische Pharma
kologie streng an die.Erforschung der Pharmakodynamik und Pharma
kokinetik von Substanzen halt, also das am Menschen nachvollzieht,
was der Tierpharmakologe im Tierexperiment erarbeitet hat.
Die klinische Pharmakologie ist im besten Sinne Pharmakologie am
Menschen, Humanpharmakologie.
So laBt sich die klinische Pharmakologie unschwer als Bindeglied
zwischen das pharmakologische Tierexperiment und die eigentliche
Therapie einordnen, denn wissenschaftlich fundierte Arzneimittelthe
rapie ist erst dann moglich, wenn alle gewiinschten und unerwiinschten
Eigenschaften einer Substanz im klinisch-pharmakologischen Experi
ment erarbeitet worden sind.
Die Ubertragbarkeit tierexperimenteller Daten ist nur in sehr
eingeschranktem MaBe moglich, da die fast immer von Spezies zu
Spezies genetisch fixierten Variationen der Antwort auf die Inkorpora-
3
tion einer Substanz zu vollig anderen pharmakodynamischen Effekten
oder anderer pharmakokinetischer Phanomenologie fiihren, als man sie
auf der Basis intelligenter Oberlegungen erwartet, so daB schluBendlich
das Experiment am Menschen unvermeidlich bleibt.
Dem Experiment am Menschen sind enge ethische Grenzen gesetzt.
Auch hier gilt das "nil nocere" , und zwar in verstarktem MaBe. Dies urn
so mehr, wenn es sich urn Untersuchungen an freiwilligen, gesunden
Versuchspersonen handelt.
Der Patient, der sich dem Arzt seines Vertrauens fiir eine klinisch
pharmakologische Untersuchung zur Verfugung stellt, hat zumindest
die Hoffnung, eine verbesserte Therapie im Vergleich zu den bisher
vorhandenen zu bekommen. Der Proband hingegen muB die Mentalitat
eines Testpiloten mitbringen. AuBer einem materiellen Ausgleich, der
in keinem Falle risikodeckend sein kann, erbalt er nichts und geht
zudem im allgemeinen das hahere Risiko ein, da beim ersten Versuch
am Patienten die Substanz bereits am gesunden Probanden erprobt
worden ist.
Die engen, dem Fachgebiet auferlegten Grenzen machen einen
hohen Einsatz von physikalischen, physikochemischen, chemischen und
mathematischen Mitteln notwendig. Das Tierexperiment laBt sich in
den meisten Fallen am Menschen nicht nachvollziehen, so daB SchluB
folgerungen baufig oder fast immer aus indirekt gewonnenen Daten
gezogen werden miissen. Eine Tatsache, die, als Herausforderung von
der klinischen Pharmakologie angenommen, in den letzten drei Jahr
zehnten zu bis dahin unvorstellbaren Moglichkeiten des Messens
gefiihrt hat, nicht zuletzt auch durch die Nutzbarmachung von in der
Raumfahrt gewonnenen Methoden.
Unter Beachtung des "nil nocere", d. h. ohne Gefahrdung, ja sogar,
wenn moglich, ohne subjektive Belastigung, kann heute sehr vieles am
Menschen gemessen werden. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang
nur auf die telemetrische Erfassung ganzer Datenpakete zur Messung
des physischen sowie emotionellen Stresses bei Testpiloten, welche
schnelle Kampfflugzeuge fiihren.
Die klinische Pharmakologie ist ein interdisziplinares Arbeitsgebiet,
welches seine Aufgaben nur im Team mit Arzten, Psychologen, Physi
kern, Chemikern und nicht zuletzt Elektronikern zu losen vermag,
wobei arztliche Erfahrung und Intuition immer die entscheidende Rolle
zu spielen haben.
4