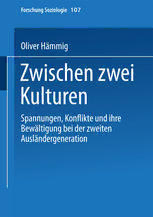Table Of Content107
Forschung Soziologie
Oliver Hämmig
Zwischen zwei
Kulturen
Spannungen, Konflikte und ihre
Bewältigung bei der zweiten
Ausländergeneration
Oliver Hämmig
Zwischen zwei Kulturen
Forschung
Soziologie
Band 107
Oliver Hämmig
Zwischen zwei Kulturen
Spannungen, Konflikte
und ihre Bewältigung bei der
zweiten Ausländergeneration
mit einem Vorwort von
Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2000
Gedruckt auf säurefreiem und alterungs beständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
ISBN 978-3-8100-2950-8 ISBN 978-3-663-11932-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-11932-6
© 2000 Springer Fachmedien Wiesbaden
Ursprünglich erschienen bei Leske + Budrich, Opladen 2000
Die vorliegende Arbeit wurde von der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich im
Wintersemester 199912000 auf Antrag von Prof. Dr. H.-J. Hoffmann-Nowotny als Disser
tation angenommen.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtJich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verla
ges unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
vorwort ................................................................. 9
1. Einleitung: Die "verlorene Generation"? .....•...•.......... 12
2. Erkenntnisinteresse und Fragestellungen .•................... 18
3. Forschungsstand und Untersuchungsgegenstand ............. 22
3.1. Forschungsüberblick zur Zweiten Generation ............................. 22
3.2. Definition und numerische Situation der Zweiten Generation in der
Schweiz 27
3.3. Zur spezifischen Problematik der Zweiten Generation .................. 33
3.3.l. Das Dilemma der Zweiten Generation ............................... 36
3.3.2. Zwischen Tradition und Moderne ..................................... 37
3.3.3. Türkische und schweizerische Werte und Erziehungsziele ...... 39
3.3.4. Zum Zusammenhang von Migration und Gesundheit.. ......... 41
3.4. Zur Sozialisation und Assimilation der Zweiten Generation .......... 48
3.4.1. Sozialisationskonflikt und Identitätsentwicklung ................ 49
3.4.2. Zum Zusammenhang von Kultur und Sprache .................... 53
3.4.3. Das "Drei-Generationen-Assimilations-Modell" .................. 54
4. Theoretische Konzepte ........................................... 60
4.1. Das Marginal Man-Konzept.. .................................................. 61
4.1.1. Zur Unterscheidung von struktureller und kultureller
Marginalität ............................................................ 64
4.l.2. Kritik am Konzept des Marginal Man ............................... 65
4.2. Das KulturkonJlikt-Konzept ................................................... 67
4.2.1. Zum Kulturbegriff.. ...................................................... 67
4.2.2. Zur Kulturkonfliktthese ................................................. 74
4.2.3. Kulturkonflikt und psychosoziale Befindlichkeit.. ............... 77
4.2.4. Kritik am Konzept des Kulturkonflikts ............................. 80
4.3. Das Anomie-Konzept ........................................................... 88
4.3.1. Das Theorem von Durkheim ........................................... 88
4.3.2. Das Anomie- und Devianzmodell von Merton .................... 91
4.3.3. Der Ansatz von Hoffmann-Nowotny ................................ 98
4.3.4. Das sozialpsychologische Konzept der "Anomia" .............. 101
4.3.4.1. "Anomia" bei Merton ......................................... 101
4.3.4.2. "Anomia" bei Srole ............................................ 103
4.3.4.3. "Anomia" bei McClosky und Schaar. ..................... 104
4.3.5. Anomie bei der Zweiten Generation ............................... 106
4.3.6. Kritik am Anomie-Konzept.. ........................................ 109
5
4.4. Das Coping-Konzept. .......................................................... 116
4.4.1. Definition von Coping ................................................ 116
4.4.2. Der stresstheoretische Ansatz von Lazarus ....................... 1 18
4.4.3. Stress bei der Zweiten Generation .................................. 121
4.4.4. Coping bei der Zweiten Generation ................................ 125
4.4.4.1. Drei Grundmuster kultureller Adaption ................... 128
4.4.4.2. Exkurs zu zwei spezifischen Strategien ................... 129
4.4.5. Das Problem der funktionalen Äquivalenz und empirischen
Latenz .................................................................. 134
5. Annahmen und Hypothesen ................................... 137
5.1. Grundpostulat von der Zweiten Generation als den "Marginal
Men" ............................................................................... 138
5.2. These von der kulturellen Distanz .......................................... 140
5.3. These vom intrafamilialen Generationenkonflikt. ...................... 147
5.4. These von der Pendelmigration .............................................. 149
5.5. Modifizierte Modernitätsdifferenzthese .................................... 153
5.6. These von der strukturellen Distanz ........................................ ISS
5.7. These von der intergenerationellen Reproduktion der
Aufstiegsaspiration ............................................................ 162
5.8. These von der externalen Attribution der Statusfrustration .......... 164
5.9. Frustrations-Aggressions-These ............................................. 168
5.10. These vom psychosozialen Identitätskonflikt. ......................... 172
5.11. These vom emotionalen, sozialen und mentalen" Rückzug" ...... 177
5.12. These von der" Rückkehrillusion " ........................................ 183
5. 13. These von der Sphärentrennung ........................................... 189
5.14. Adaptierte Binnenintegrationsthese ....................................... 192
5.15. These von der kompensatorischen Leistungsorientierung .......... 196
6. Daten und Methode .......•..................................... 199
6.1. Untersuchungsdesign und Erhebungsinstrument ........................ 199
6.2. Stichprobenziehung und Auswahlveifahren .............................. 202
6.3. Ausschöpfung und Ausfallstatistik. ........................................ 207
6.4. Zur Repräsentativität der Stichprobe ....................................... 211
6.4.1. Geschlecht ................................................................ 213
6.4.2. Alter ........................................................................ 215
7. Operationalisierung ............................................ 217
7.1. Trichtermodell und theoretisches Pfadmodell ............................ 217
7.2. Skalen und Indizes .............................................................. 219
7.2.1. Indikatoren zur Marginal Man-Spannung und zum
Kulturkonflikt. ...................................................... 223
6
7.2.2. Indikatoren zur Anomie ............................................... 228
7.2.2.1. Operationalisierung der Orientierungsanomie ........... 229
7.2.2.2. Operationalisierung der Deprivationsanomie ............ 233
7.2.2.3. Anomie-Index als Kombination von Orientierungs- und
Deprivationsanomie ....................................................... 243
7.2.3. Indikatoren und Prädiktoren von "Stress" ......................... 247
7.2.3.1. Kulturelle und strukturelle Spannungen ................. 248
7.2.3.2. Life Events ...................................................... 252
8. Präsentation und Interpretation der empirischen Befunde 256
8./. Grundpostulat von der Zweiten Generation als den "Marginal
Men" ............................................................................... 259
8.2. These von der kulturellen Distanz .......................................... 26/
8.3. These vom intrafamilialen Generationenkonflikt. ...................... 271
8.4. These von der Pendelmigration .............................................. 279
8.5. Modifizierte Modernitätsdifferenzthese .................................... 287
8.6. These von der strukturellen Distanz ........................................ 293
8.7. These von der intergenerationellen Reproduktion der
Aufstiegsaspiration ............................................................ 303
8.8. These von der externalen Attribution der Statusfrustration .......... 312
8.9. Frustrations-Aggressions-These ............................................. 317
8.10. These vom psychosozialen Identitätskonflikt. ......................... 327
8.11. These vom emotionalen, sozialen und mentalen" Rückzug" ...... 341
8.12. These von der "Rückkehrillusion " ........................................ 350
8.13. These von der Sphärentrennung ........................................... 360
8.14. Adaptierte Binnenintegrationsthese ....................................... 364
8./5. These von der kompensatorischen Leistungsorientierung .......... 370
9. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse. ....... 373
10. Schlusswort .................................................... 389
Literaturverzeichnis. ............................................... 393
7
Danksagung
Nicht etwa persönliche Betroffenheit - ich bin selbst kein Angehöriger der
zweiten Ausländergeneration -, auch nicht eine besondere soziale ,,Nähe" oder
kulturelle Affinität zur Zweitgenerationspopulation und schon gar nicht die
Aussicht auf akademische Meriten, sondern allein wissenschaftliche Neugier
und professionelles Interesse an der Zweitgenerationsthematik oder vielmehr
-problematik haben mich dazu bewogen, die vorliegende Doktorarbeit zu ver
fassen. Gerade diese emotionale (und gewissermassen auch soziale) "Distanz"
zum Forschungsobjekt und Untersuchungsgegenstand hat der Arbeit, wie ich
meine, erst zur nötigen Objektivität und Unvoreingenommenheit verholfen.
Dass sich mir überhaupt Gelegenheit zum Verfassen dieses Buches bot, ist in
erster Linie das Verdienst meines Doktorvaters Prof. Dr. Hans-Joachim Hoff
mann-Nowotny, dem damit mein besonderer Dank gilt. Er setzte vollstes Ver
trauen in mich, indem er mir noch als Student kurz vor Studienabschluss eine
Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologischen Institut anbot und
mich im Rahmen seines Forschungsprojekts "Das Fremde in der Schweiz"
mit der Durchführung und Auswertung einer Untersuchung betraute, die mir
die Datenbasis für die vorliegende empiriegestützte Studie liefern sollte. Dank
gebührt aber auch meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen, namentlich Jörg
Stolz, Anne Juhasz, Eva Mey und Andreas Gisler, die mich in meiner Arbeit
ermutigten und die mir mit ihren fachkundigen Tips und kritischen Anregun
gen immer wieder ein konstruktives Feedback über den jeweiligen Stand der
Arbeit lieferten und damit viel zum Gelingen dieses Buches beigetragen ha
ben. Nicht unerwähnt bleiben darf mein Studienkamerad Felix Fischer, der
sich die Mühe zur sorgfältigen Lektüre einer der letzten, mittlerweile sehr um
fangreichen Fassungen meiner Dissertation nahm und diese mit wissenschaft
licher Fachkenntnis und journalistischem Sachverstand auf etwaige inhaltliche
Ungereimtheiten und sprachliche Unschönheiten hin durchschaute. Einen
nicht unbeträchtlichen Anteil an der Arbeit hat schliesslich auch meine Frau
Margreth Hämmig-Gräser, die mich in vielerlei Hinsicht in meinem Vorha
ben, diese Abhandlung zu schreiben, unterstützte und mich bei den üblichen
Frustrationserfahrungen und auftretenden Ermüdungserscheinungen stets zum
Weitermachen ermunterte.
8
Vorwort
Internationale Migration, insbesondere die oft problematisierte Immigration
und Integration von Ausländerinnen und Ausländern aus fremden Kulturen, ist
ein gerne und wiederkehrend politisiertes und dabei polarisierendes sowie in
der Öffentlichkeit häufig allzu plakativ diskutiertes Thema. Unbestritten ist,
dass besagte (Massen-)Einwanderung und Eingliederung von ausländischen
Personen unterschiedlichster nationaler und kultureller Herkunft für jede Auf
nahmegesellschaft wie auch für die Einwanderer selbst eine grosse Herausfor
derung darstellt. Die Schweiz ist diesbezüglich keine Ausnahme, stellt sie
doch seit langem ein Ziel von Arbeitsmigranten dar und ist trotz des Fehlens
einer eigentlichen Zuwanderungspolitik und selbst angesichts einer ver
gleichsweise restriktiven Ausländerregelung und Einbürgerungspolitik ein be
gehrtes Einwanderungsland geworden. Lange Zeit standen die ausländischen
Gastarbeiter und deren Integration und Assimilation im Untersuchungs fokus
sozialwissenschaftlicher Minderheiten- und Migrationsforschung in der
Schweiz. Die Auswirkungen der (Arbeits-)Migration sind jedoch nachhaltig
und betreffen nicht nur die eigentlichen Einwanderer, sondern auch nachfol
gende Generationen, namentlich die direkten Nachkommen besagter Arbeits
migranten, die zweite Ausländergeneration. Die Studie von Oliver Hämmig
rückt nun gen au diese "Gastarbeiterkinder", die hierzulande geboren und mitt
lerweile herangewachsen sind, und deren Lebenssituation ins Zentrum des Er
kenntnisinteresses und macht dabei insbesondere die türkische und italienische
Zweite Generation zum Forschungsgegenstand.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsprojekts ,,Das
Fremde in der Schweiz", womit eine von mir begründete und seit Ende der
sechziger Jahre am Soziologischen Institut der Universität Zürich gepflegte
Forschungstradition weitergeführt wird, die mit der soziologischen Erklärung
der "Fremdarbeiterproblematik" ihren Anfang nahm und nun in einer fundier
ten und beispielhaften Analyse der "Zweitgenerationsproblematik" eine konse
quente und längst fällige Fortsetzung findet. Damit wird nicht nur ein in der
Schweiz noch nahezu brachliegendes Forschungsfeld "beackert" und eine be
stehende Forschungslücke geschlossen. Auch wird dadurch der zunehmenden
sozialen Relevanz und gesellschaftspolitischen Bedeutung der ausländischen
Zweitgenerationspopulation in der Schweiz Rechnung getragen. Diese offen
bart sich mitunter in der wachsenden Zahl und im gestiegenen Anteil der
Zweitgenerationsangehörigen innerhalb der hiesigen Ausländerpopulation -
bereits zählen weit über 300'000 Personen in der Schweiz zur zweiten Auslän
dergeneration. was einem knappen Viertel der ständigen ausländischen Wohn
bevölkerung entspricht.
9