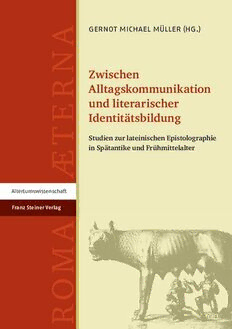Table Of ContentDie Epistolographie gehört zu den pro- A gernot michael müller (hg.)
duktivsten literarischen Gattungen der
lateinischen Spätantike. Dennoch datiert
ihre intensivere Erforschung erst in die g
letzten Jahrzehnte. Diese konzentriert n n N
u
sich dabei in der Regel entweder auf ein- o d
i
zelne Autoren und ihre Netzwerke oder t l
a i
sie bildet bestimmte regionale Schwer- k b Zwischen
s
i
punkte aus. Überregionale oder trans- n t R
ä
historische Ansätze stellen indes immer u t Alltagskommunikation
m i
noch die Ausnahme dar. Hier setzen die t
n
m
Beiträge dieses Bandes an: Neben der e und literarischer
Diskussion grundlegender sammlungs- o d E
k I
und gattungstheoretischer Fragen eröff- s r
hr g e Identitätsbildung
U nen sie in exemplarischen Fallstudien
9 a h
020 um 20:1 eppirenak xtbeernoe lisotpegsäi stPacahnnetoinkr eaurmn udan fadun na iknntshiaoatnzltawllieechnise eAn s,- n Allt arisc T Studien zur lateinischen Epistolographie
02.2 auch frühmittelalterlicher lateinischer e er in Spätantike und Frühmittelalter
m 14. Epistolographie. In diachroner Perspek- ch lit Æ
B a tive werden außerdem Kontinuitäten is d
n, U und Transformationen sichtbar, welche w n
erli die Epistolographie in der Spätantike Z u
B
ät und darüber hinaus ausgebildet hat.
ersit Damit leistet dieser Band einen Beitrag
niv zu einer kulturgeschichtlich orientierten www.steiner-verlag.de RA 7 Altertumswissenschaft
U
eie Gattungsgeschichte des komplexen Phä-
Fr
ür nomens spätantiker Briefliteratur – und Franz Steiner Verlag Franz Steiner Verlag
ert f dies über eine Zeitspanne, die selten als
nzi Ganzes in den Blick genommen wird.
e
z A
Li
)
.
G
H
(
R M
E
L
L
Ü
M
.
M
O
ISBN 978-3-515-12099-9
T
O
N
R
E
9 7835 1 5 1 20999 G R
Franz Steiner Verlag
Gernot Michael Müller (Hg.)
Zwischen Alltagskommunikation
und literarischer Identitätsbildung
hr
U
9
1
0:
2
m
u
0
2
0
2
2.
0
4.
1
m
a
B
U
n,
erli
B
ät
sit
er
v
ni
U
e
ei
Fr
ür
ert f
zi
n
e
z
Li
Franz Steiner Verlag
R O M A Æ T E R N A
RO M A Æ T E R N A
Beiträge zu Spätantike und Frühmittelalter
Herausgegeben von Volker Henning Drecoll, Irmgard Männlein-Robert,
Mischa Meier und Steffen Patzold
Uhr Band 7
9
1
0:
2
m
u
0
2
0
2
2.
0
4.
1
m
a
B
U
n,
erli
B
ät
sit
er
v
ni
U
e
ei
Fr
ür
ert f
zi
n
e
z
Li
Franz Steiner Verlag
GERNOT MICHAEL MÜLLER (HG.)
Zwischen
Alltags kommunikation
und literarischer
hr Identitätsbildung
U
9
1
0:
2
m
u
20 Studien zur lateinischen Epistolographie
0
2
2.
4.0 in Spätantike und Frühmittelalter
1
m
a
B
U
n,
erli
B
ät
sit
er
v
ni
U
e
ei
Fr
ür
ert f
zi
n
e
z
Li
Franz Steiner Verlag
Franz Steiner Verlag
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
hr
U
9
1
0:
2
m
u
0
2
0
2
2.
0
4.
1
m
a
B
U
n,
Berli Umschlagabbildung: Bronzestatue der Kapitolinischen Wölfin,
sität Kapitolinische Museen, Rom
ver © akg / De Agostini Picture Library
ni
U
e
Frei Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
ür Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
ziert f Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
n
ze <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Li
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist unzulässig und strafbar.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018
Umschlaggestaltung: r2 Röger & Röttenbacher, Leonberg
Druck: Hubert & Co., Göttingen
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier.
Printed in Germany.
ISBN 978-3-515-12099-9 (Print)
ISBN 978-3-515-12101-9 (E-Book)
Franz Steiner Verlag
INHALTSVERZEICHNIS
hr
U
9
0:1 Einleitung.................................................................................................................7
2
m
u
0
2
20 I. GRUNDLEGENDE FRAGEN ZU SAMMLUNG, PUBLIKATION
2.
0 UND KLASSIFIZIERUNG SPÄTANTIKER BRIEFE
4.
1
m
B a Ian Wood
U Why collect letters?................................................................................................45
n,
erli
B Ralph W. Mathisen
ät
sit The ‘Publication’ of Latin Letter Collections in Late Antiquity............................63
ver
ni
U Raphael Schwitter
e
ei Gebrauchstext oder Literatur? Methodenkritische Überlegungen
Fr
ür zur literarischen Stellung des Privatbriefs in der Spätantike.................................85
ert f
zi
n
e
z II. EPISTOLOGRAPHIE BEI DEN KIRCHENVÄTERN UND
Li
IN IHREM UMFELD
Sigrid Mratschek
Geben und Nehmen in den Briefen des Paulinus von Nola.
Der himmlische Bankier und der Wohltäter der Armen......................................109
Katharina Semmlinger
Ambrosius von Mailand: Plinius christianus oder christianus perfectus?
Selbstdarstellung eines Christen anhand ausgewählter Beispiele
aus dem zehnten Briefbuch..................................................................................131
Danuta R. Shanzer
Beheading at Vercellae: What is Jerome, epist. 1 and why does it matter?.........145
Benoît Jeanjean
„Que fait Horace à côté du psautier? Virgile à côté des Evangiles?“
(Hieron. epist. 22,29). Les citations poétiques profanes
dans les Lettres de saint Jérôme...........................................................................169
Franz Steiner Verlag
6 Inhaltsverzeichnis
III. EPISTOLOGRAPHIE IN ITALIEN IM SPÄTEN 5. UND 6. JH.
Bianca-Jeanette Schröder
Freundschaftsdiskurs bei Ennodius.
Briefe als Zeichen von Freundschaft oder Verachtung........................................203
Ida Gilda Mastrorosa
hr
U Illa virtutum omnium latissimum templum.
9
0:1 Values and Cult of Republican Rome in Cassiodorus’ Variae............................221
2
m
u
0
2
20 IV. EPISTOLOGRAPHIE IM SPÄTANTIKEN GALLIEN (4.–6. JH.)
2.
0
4.
m 1 Meinolf Vielberg
B a Ego enim Tolosae positus, tu Treveris constituta.
U Gallien im Briefwerk des Sulpicius Severus und des Paulinus von Nola............239
n,
erli
B Ulrike Egelhaaf-Gaiser
ät
sit Vom Epulonenschmaus zum Fest der Worte.
ver Konviviale Gelegenheiten im Briefcorpus des Sidonius.....................................255
ni
U
e
ei Johanna Schenk
Fr
ür Claret gloriosior sub principatu vestro noster triumphus.
ert f Die Selbstdarstellung des Avitus von Vienne in den Briefen
zi an Gundobad und Sigismund...............................................................................287
n
e
z
Li
Gernot Michael Müller
Briefkultur im merowingischen Gallien.
Zu Konzeption und Funktion der Epistulae Austrasicae.....................................301
V. EPISTOLOGRAPHIE IM FRÜHEN MITTELALTER
Sebastian Scholz
Der Codex Carolinus. Eine fränkische Sammlung päpstlicher Ansprüche
oder Ergebnis einer fränkischen Legitimationsstrategie?................................... 353
Volker Scior
Hinkmar von Reims und sein Bote Egilo von Sens oder: Wer spricht?
Substitution und Verkörperung durch Boten
in der brieflichen Kommunikation des Mittelalters.............................................367
Orts- und Namenregister......................................................................................381
Stellenregister.......................................................................................................389
Franz Steiner Verlag
EINLEITUNG
I.
hr
U
9
0:1 Seit alters her dient der Brief zur Informationsvermittlung zwischen räumlich ge-
2
m trennten Kommunikationspartnern.1 Und also ist es nicht erstaunlich, dass Cicero
u
0 in einem Schreiben an C. Curio, in dem er sich theoretisch über die Funktion von
2
20 Briefen äußert, diesen Zweck an die erste Stelle setzt und in ihm auch den Grund
02. für ihre Erfindung überhaupt erkennen will.2 Indes lässt er im gleichen Atemzug
4.
m 1 durchblicken, dass damit zwar die zentrale, aber bei weitem nicht die einzige
B a Verwendungsweise von Briefen benannt ist. Deren seien vielmehr viele, von de-
U nen zwei sein besonderes Gefallen fänden: eine freundschaftliche und scherzhafte
n,
erli sowie eine ernste und sich auf gewichtige Inhalte beziehende.3
B Ciceros im scherzhaften Ton formulierte Belehrung über die verschiedenen
ät
sit Arten brieflichen Austauschs weist auf das weite Möglichkeitsspektrum, in dem
ver sich Briefkommunikation über die Weitergabe von Informationen hinaus in der
ni
U Antike vollziehen konnte und von dem nicht zuletzt seine umfangreiche Korres-
e
ei pondenz selbst ein eindrückliches Beispiel abgibt.4 Auf der Grundlage der von
Fr
ür Cicero im Verlauf seines Briefs an Curio erstellten Zweiteilung von Briefanlässen
ert f
zi
n
e
z
Li 1 Die nachstehenden Ausführungen verstehen sich als einleitende Skizze zu Geschichte und
Ausprägung der antiken lateinischen Epistolographie sowie zu deren Erforschung in den Al-
tertumswissenschaften. Dementsprechend beschränken sich die Hinweise in den Anmerkun-
gen auch nur auf eine Auswahl der einschlägigen Forschungsliteratur zum Gegenstand. – Zur
Epistolographie in den vorderorientalischen Literaturen s. beispielshalber die Beiträge in
Grob (2008), für einen informativen Überblick über aramäische Epistolographie s. Alexander
(1978) sowie Fales (1987) mit zusätzlichen Ausblicken auf assyrische Briefe; allgemein zur
jüdischen Epistolographie bis auf Flavius Josephus s. Doering (2012) 1–95, 170–376; für ei-
nen diachronischen Überblick über Verwaltungsbriefe von den altorientalischen Kulturen bis
in die Spätantike und den frühen Islam s. die Beiträge in Procházka/Reinfandt/Tost (2015).
2 Cic. fam. 2,4,1 (53 v. Chr.): Epistularum genera multa esse non ignoras, sed unum illud cer-
tissimum, cuius causa inventa res ipsa est, ut certiores faceremus absentis, si quid esset, quod
eos scire aut nostra aut ipsorum interesset.
3 Ebd.: Reliqua sunt epistularum genera duo, quae me magno opere delectant, unum familiare
et iocosum, alterum severum et grave.
4 Einen allgemeinen Überblick über Geschichte und Möglichkeiten antiker Briefkommunikati-
on bietet Stowers (1986); speziell zum Brief in der lateinischen Literatur s. Peter (1901),
Cugusi (1983) und Corbinelli (2008); neuere Sammelbände zur antiken Briefliteratur sind et-
wa Morrello/Morrison (2007), Desmoulliez/Hoet-van Cauwenberghe/Jolivet (2010) sowie die
aus Tagungen an der Universität François Rabelais in Tours hervorgegangenen Bände der
Reihe Epistulae Antiquae (Bde. 1–5: Löwen 2000–2009; ab Bd. 6 unter dem jeweiligen Ta-
gungstitel: Tours 2010ff.).
Franz Steiner Verlag
8 Gernot Michael Müller
ist hier vorderhand seine vielgestaltige politische Korrespondenz zu nennen, die
vom vertraulichen Meinungsaustausch über das sensible Austarieren von Positio-
nen und Beziehungen im politischen Tagesgeschäft bis hin zum politischen Lehr-
brief reicht.5 Im Bereich jenes von ihm als zweite Abteilung genannten genus fa-
miliare ist neben dem breiten Feld privater Korrespondenz sodann vor allem auf
zahlreiche Beispiele epistolarer Freundschafts- und Beziehungspflege hinzuwei-
sen, in welcher sich Cicero in der ihm eigentümlichen reflektierenden Art geübt
hr
U hat.6
9
0:1 Vor dem Hintergrund der in Ciceros Briefœuvre idealtypisch greifbaren Ver-
2
m wendungsbreite des antiken Briefs ist es nur konsequent, dass sich auch die rheto-
u
0 rischen Lehrschriften der Kaiserzeit seiner angenommen und Elemente einer The-
2
20 orie brieflicher Kommunikation formuliert haben.7 Neben Bemerkungen über
2.
0 Aufbau, Umfang und Stil legt diese dabei auf jene Aspekte besonderes Augen-
4.
m 1 merk, die sich auf den kommunikativen und gemeinschaftsstiftenden Charakter
B a eines Briefs beziehen. Hierzu gehört ebenso, dass dieser als Hälfte eines Dialogs
U und auf diese Weise als für sich genommen unvollständig und einer Entgegnung
n,
erli bedürfend beschrieben wird, wie auch seine Bewertung als Geschenk, woraus sich
B das Gebot ableitet, seiner sprachlichen Gestaltung besondere Aufmerksamkeit
sität angedeihen zu lassen.8
ver Gerade letzterer Aspekt weist komplementär zur Beziehungsfunktion auf das
ni
U literarische Potential, das einem Brief nach antiker Vorstellung zukam und dem-
e
ei entsprechend auch zu nutzen war. So bediente sich Cicero in seiner Korrespon-
Fr
ür denz einer weiten Skala unterschiedlicher Stile, die er nicht nur auf Anlass und
ert f Adressaten abstimmte, sondern auch rhetorisch geschickt zum eigenen self
zi fashioning gegenüber letzteren zu nutzen wusste.9 Daneben impliziert die Vorstel-
n
e
z lung vom Geschenk, dass Briefe über den kommunikativen Akt hinaus, für den sie
Li
verfasst wurden, auf Bewahrung angelegt waren, und dies nicht nur mit Blick auf
den Empfänger.10 Cicero etwa scheint an die Veröffentlichung einer Auswahl sei-
ner Korrespondenz gedacht zu haben, ein Plan, den er auf Grund seines vorzeiti-
5 Allgemein zur Korrespondenz Ciceros vgl. Hooper/Schwartz (1991) 17–50, Hutchinson
(1998), White (2010), De Giorgio (2015); speziell zur politischen Briefkommunikation s.
Hall (2009), zu ad Q. fr. 1 als Beispiel des politischen Lehrbriefs vgl. u.a. Flemming (1953),
Justynski (1968) und Prost (2014) sowie für eine Einordnung in die Fürstenspiegelliteratur
der Antike Schulte (2001) 173.
6 Vgl. Garcea (2003), De Giorgio (2008) und Bernard (2013); vgl. auch Citroni Marchetti
(2000) und Wilcox (2012); zu Ciceros Exilbriefen in diesem Zusammenhang vgl. Prost
(2015).
7 Einen Überblick über die brieftheoretische Literatur der Antike gewährt Malherbe (1998);
vgl. auch Trapp (2003) 42–46.
8 S. beispielsweise Demetr. Eloc. 223–235.
9 Vgl. nochmals Hall (2009) sowie Roesch (2004).
10 S. grundsätzlich Gibson (2012).
Franz Steiner Verlag
Einleitung 9
gen gewaltsamen Todes nicht mehr selbst realisieren konnte.11 Seine Bemerkung
gegenüber Atticus, dass es nicht nur einer passenden Auswahl, sondern sodann
auch einer Überarbeitung der ausgewählten Briefe bedürfe, bevor diese veröffent-
licht werden können – ein Zeitaufwand, den er zum Zeitpunkt des Schreibens of-
fensichtlich nicht aufbringen zu können meinte –,12 deutet darauf hin, dass die
Herausgabe der eigenen Korrespondenz einen Prozess weiterer Literarisierung
bedingte, der neben der Komposition der Sammlung auch auf Inhalt und Stil der
hr
U Einzelbriefe zielte. Mehr noch als der Briefverkehr selbst, den etwa ein Cicero
9
0:1 bereits souverän für eine adressaten- und anlassadäquate Selbstmodellierung zu
2
m nutzen wusste, war eine spätere Herausgabe von Teilen der persönlichen Korres-
u
0 pondenz auf ein minutiös berechnetes self fashioning ausgerichtet, das selbstre-
2
20 dend die postume memoria mit im Blick hatte.13
2.
0 Ein solcher gestalterischer Anspruch kam in solchen Briefsammlungen noch-
4.
m 1 mals stärker zum Tragen, deren einzelne Schreiben allein zu dem Zweck verfasst
B a worden sind, ein bestimmtes Bild ihres Autors zu vermitteln und für die Nachwelt
U festzuschreiben. Prominenter Fall hierfür sind die neun Bücher Privatkorrespon-
n,
erli denz des jüngeren Plinius, die wohl von vorneherein als literarisches Werk ge-
B plant und angelegt worden sind und gerade deswegen den über die bloße Informa-
ät
sit tionsvermittlung hinausgehenden Spielraum antiker Briefkommunikation deutlich
ver vor Augen führt.14 Dabei gibt Plinius’ Briefœuvre neben einer markanteren In-
ni
U dienstnahme der in Ciceros Korrespondenz bereits grundgelegten Möglichkeiten
e
ei der Selbstdarstellung und der Gemeinschaftsbildung weitere charakteristische
Fr
ür Merkmale von dieser zu erkennen. Hierzu gehört einmal die in seiner ersten Epis-
ert f tel programmatisch angedeutete varietas des Korpus, die sich aus der grundsätzli-
zi chen Vielgestaltigkeit brieflicher Korrespondenzanlässe herleitet und sich im Fal-
n
e
z le einer darauf abgestimmten stilistischen Gestaltung auch auf formaler Ebene
Li
niederschlagen kann.15 Zwar mögen Briefsammlungen durchaus detaillierten Ein-
blick in eine Vita oder sogar in eine ganze Epoche geben, wie Cornelius Nepos im
Hinblick auf Ciceros Briefwerk bewundernd hervorgehoben hat,16 konstitutiv für
diesen ist trotzdem, und dies unabhängig vom Grad seiner bewussten Gestaltung,
dass jene biographischen oder gar historischen Informationen im Licht ganz un-
terschiedlicher Kommunikationszusammenhänge und -kontexte und infolgedessen
11 S. Cic. Att. 16,5,5: Mearum epistularum nulla est συναγωγή; sed habet Tiro instar septuagin-
ta, et quidem sunt a te quaedam sumendae. Eas ego oportet perspiciam, corrigam; tum deni-
que edentur; vgl. hierzu etwa Steel (2005) 43–47 und Wulfram (2008) 23–36.
12 Der Brief datiert auf den 9. Juli 44 v. Chr. und liegt damit in der Zeit von Ciceros Wiederein-
tritt in die Politik nach der Ermordung Caesars.
13 Grundlegend zur kulturellen Bedeutung der Selbstrepräsentation in der Antike s. die Beiträge
in Gavrielatos (2017).
14 S. aus der Fülle der Literatur z.B. Hooper/Schwartz (1991) 71–94, Krasser (1993), Ludolph
(1997), Radicke (1997) und (2003), Hoffer (1999), Henderson (2002), Méthy (2007), Gauly
(2008), Marchesi (2008) und Lefèvre (2009) 302–310.
15 S. Plin. epist. 1,1,1; vgl. Gibson (2012) 64 sowie Bodel (2015) 42–51.
16 Nep. Att. 16,3.
Franz Steiner Verlag