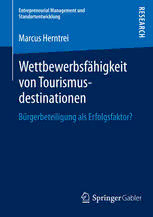Table Of ContentEntrepreneurial Management
und Standortentwicklung –
Perspektiven für Unternehmen
und Destinationen
Herausgegeben von
E. Kreilkamp, Lüneburg, Deutschland
Ch. Laesser, St. Gallen, Schweiz
H. Pechlaner, Eichstätt-Ingolstadt, Deutschland
K. Wöber, Wien, Österreich
Die Publikationen der Reihe behandeln die unternehmerische Orientierung des
Managements von Unternehmen und Standorten. Regionen, Destinationen und
Standorte stellen hierbei sowohl Wettbewerbseinheiten als auch den räumlichen
Kontext für die Gestaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen dar.
Herausgegeben von
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp Prof. Dr. Harald Pechlaner
Leuphana Universität Lüneburg Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt
Prof. Dr. Christian Laesser
Universität St. Gallen Prof. Dr. Karl Wöber
MODUL University Vienna
Marcus Herntrei
Wettbewerbsfähigkeit
von Tourismus-
destinationen
Bürgerbeteiligung als Erfolgsfaktor?
Mit einem Geleitwort von
Prof. Dr. Dr. h. c. (BSU) Albrecht Steinecke
Marcus Herntrei
IUBH Duales Studium
Deutschland
Dissertation Universität Paderborn, 2013
D 466
ISBN 978-3-658-07675-7 ISBN 978-3-658-07676-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-07676-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi-
bliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)
V
Geleitwort
Innerhalb der Tourismuswissenschaft, aber auch der touristischen Praxis hat das
wirtschaftswissenschaftliche Konzept der „Tourismusdestination“ seit den
1990er-Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangt. Im Kern geht es dabei da-
rum, geographische Räume (Orte, Regionen, Nationen) als strategische Wettbe-
werbseinheiten zu begreifen, die mit Hilfe klassischer Instrumente des Marketings
und Managements geführt werden.
Diese ausschließlich ökonomische Sichtweise vernachlässigt aber die Tatsache,
dass touristische Zielgebiete immer auch Arbeits-, Wohn- und Lebensräume der
einheimischen Bevölkerung sind. Aktuelle Protestbewegungen gegen Infrastruk-
tur- und Bauvorhaben (sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern) ma-
chen aber deutlich, dass eine nachhaltige und harmonische Entwicklung von Re-
gionen nur möglich ist, wenn die Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen be-
rücksichtigt werden.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Studie an: Im Mittelpunkt steht die Frage,
welche Rolle die Bürgerbeteiligung bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
von Tourismusdestinationen spielt bzw. spielen kann. Um diese Frage umfassend
zu beantworten, setzt sich der Autor zunächst kritisch mit vorliegenden Theorie-
ansätzen zur Wettbewerbsfähigkeit generell und speziell zu den touristischen
Wettbewerbsfaktoren auseinander. Dabei zeigt er inhaltliche und methodische
Widersprüche sowie Defizite auf – nicht zuletzt die bislang weitgehend vernach-
lässigte Einbindung der Bevölkerung in Planungs- und Entscheidungsprozesse.
Diese Analyse bildet die konzeptionelle Basis für die umfangreichen empirischen
Erhebungen, die in vier Beispielregionen durchgeführt wurden. Dabei handelt es
sich um Destinationen, die jeweils über langjährige Erfahrungen in der Bürgerbe-
teiligung verfügen (Biosphärenreservat Rhön, Vulkaneifel sowie die Gemeinden
Naturns/Italien und Werfenweng/Österreich). Welches Partizipationsverständnis
haben die zentralen Akteure? Was waren die Auslöser, die Erwartungen und die
Zielsetzungen bei der Einführung der Bürgerbeteiligung? Welche Erfahrungen
haben die Verantwortlichen mit einer stärkeren Partizipation der Bevölkerung
gemacht? Wo liegen die Chancen und Grenzen der Bürgerbeteiligung im Touris-
VI Geleitwort
mus? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der zahlreichen qualitativen Inter-
views, die der Autor vor Ort mit Experten aus Politik, Planung, Tourismusbran-
che, Umweltschutz etc. geführt hat. Die Auswertung der Gespräche wird mit Hil-
fe der GABEK-Methode vorgenommen; sie weist den Vorteil auf, inhaltliche
Aussagen miteinander in Beziehung setzen zu können und sie in Form von
Netzwerkgrafiken darzustellen.
Abschließend werden die Ergebnisse in einen breiteren Forschungs- und Praxis-
zusammenhang eingeordnet: Zum einen erweitert der Autor das DWYER/KIM-
Modell der Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusdestinationen um mehrere Di-
mensionen (Lernende Regionen, Rolle der einheimischen Bevölkerung etc.). Zum
anderen zeigt er die Bedeutung seiner Überlegungen für die touristische Praxis
auf; schließlich gibt er Hinweise auf den weiteren Forschungsbedarf.
Insgesamt handelt es sich bei der Studie um einen innovativen Beitrag zu einem
erweiterten und zukunftsorientierten Verständnis der Wettbewerbsfähigkeit von
Tourismusdestinationen.
Albrecht Steinecke
VII
Danksagung
Das Verfassen einer Dissertation ist eine Herausforderung, deren Bestehen von
vielen Faktoren abhängig ist. Neben dem oft benannten Durchhaltevermögen
sind nach meiner Erfahrung die Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeu-
tung.
Einen idealen Rahmen für meine Arbeit habe ich am Lehrstuhl für Wirtschafts-
und Fremdenverkehrsgeographie der Universität Paderborn vorgefunden. Mei-
nem Erstgutachter, Herrn Univ.-Prof. Dr. Albrecht Steinecke, gebührt daher
mein größter Dank. Die Gespräche mit ihm sowie seine Expertise haben wesent-
lich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.
Bei Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas Kagermeier möchte ich mich recht herzlich
für die Zweitbegutachtung meiner Arbeit bedanken. Herr Univ.-Prof. Dr. Frank
Göttmann hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Vorsitz der Promotions-
kommission zu übernehmen. Hierfür möchte ich ihm meinen Dank aussprechen,
ebenso wie Herrn Dr. Viachaslau Nikitsin für seine Mitwirkung in der Kommis-
sion. Die hohe Qualität der Abbildungen ist der professionellen Bearbeitung
durch Herrn Peter Blank zu verdanken.
Des Weiteren danke ich Herrn Univ.-Prof. Dr. Harald Pechlaner für die langjäh-
rige und für mich sehr lehrreiche Zusammenarbeit, die mir stets in bester Erinne-
rung bleiben wird und welche mir die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Lauf-
bahn eröffnet hat.
Ein besonderer Dank gebührt meiner Familie, allen voran meinen Eltern, für
ihr grenzenloses Vertrauen in mich sowie für ihren Rückhalt und ihre
Unterstützung, die ich über alle Jahre hinweg von ihnen erhalten habe.
Meine Freundin Tanja hat in den vergangenen Monaten alle Höhen und Täler,
die Dissertationsvorhaben mit sich bringen, zusammen mit mir durchlebt.
Die Täler konnte ich dank ihres fortwährenden Rückhalts zügig durchqueren.
Dafür danke ich ihr von ganzem Herzen.
Die Arbeit möchte ich meinem Großvater widmen. Ihm habe ich viel zu verdan-
ken, so auch mein Interesse für die Wissenschaft.
Marcus Herntrei
IX
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ............................................................................ XIII(cid:1)
Tabellenverzeichnis ............................................................................... XVII(cid:1)
1(cid:1) Einleitung und Zielsetzung .................................................................... 1(cid:1)
1.1(cid:1)Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise...........................................................5(cid:1)
2(cid:1) Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsfaktoren ................................... 7(cid:1)
2.1(cid:1)Die Ursprünge des Begriffs der Wettbewerbsfähigkeit................................11(cid:1)
2.2(cid:1)Die Quellen der Wettbewerbsfähigkeit...........................................................12(cid:1)
2.2.1(cid:1) Komparative & kompetitive Wettbewerbsvorteile ......................... 12(cid:1)
2.2.2(cid:1) Der Market-based View ....................................................................... 15(cid:1)
2.2.3(cid:1) Der Resource-based View ................................................................... 18(cid:1)
2.2.3.1(cid:1) Der klassische Resource-based View ........................................ 19(cid:1)
2.2.3.2(cid:1) Der Competence-based View .................................................... 21(cid:1)
2.2.3.3(cid:1) Der erweiterte Resource-based View ........................................ 23(cid:1)
2.2.3.4(cid:1) Der Knowledge-based View ...................................................... 24(cid:1)
2.2.3.5(cid:1) Der Relational View .................................................................... 24(cid:1)
2.3(cid:1)Zwischenfazit: Der Begriff der Wettbewerbsfähigkeit zwischen
Paradigma und Bedeutungslosigkeit................................................................27(cid:1)
3(cid:1) Räume als Wettbewerbseinheiten ......................................................... 31(cid:1)
3.1(cid:1)Zum Raum- und Regionsbegriff......................................................................31(cid:1)
3.2(cid:1)Wettbewerbsfähigkeit von Staaten.................................................................. 37(cid:1)
3.2.1(cid:1) Quellen nationaler Wettbewerbsfähigkeit ......................................... 40(cid:1)
3.3(cid:1)Wettbewerbsfähigkeit von Regionen............................................................... 44(cid:1)
3.3.1(cid:1) Die Standorttheorie .............................................................................. 46(cid:1)
3.3.2(cid:1) Das Diamanten-Modell und der Cluster-Ansatz von Porter ......... 48(cid:1)
3.3.3(cid:1) Industrielle Distrikte ............................................................................ 49(cid:1)
3.3.4(cid:1) Innovative Milieus ................................................................................ 51(cid:1)
3.3.5(cid:1) Lernende Regionen .............................................................................. 53(cid:1)
3.3.6(cid:1) Regionale Innovationssysteme ........................................................... 55(cid:1)
3.3.7(cid:1) Nachhaltige Entwicklungsansätze ...................................................... 57(cid:1)
X Inhaltsverzeichnis
3.4(cid:1)Zwischenfazit: Zum Gebrauchswert des Begriffs der
Wettbewerbsfähigkeit im räumlichen Kontext.............................................. 60(cid:1)
3.5(cid:1)Die Tourismusdestination: Wettbewerbseinheit oder Lebensraum?.......... 64(cid:1)
3.5.1(cid:1) Zum Begriff der Tourismusdestination ............................................ 64(cid:1)
3.5.2(cid:1) Tourismusdestination als Wettbewerbseinheit ................................ 67(cid:1)
3.5.3(cid:1) Tourismusdestination als Region und Lebensraum ........................ 74(cid:1)
3.6(cid:1)Zwischenfazit: Die Konstruktion der Tourismusdestination zwischen
Unternehmern, Touristen und Einheimischen.............................................. 80(cid:1)
4(cid:1) Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsfaktoren von
Tourismusdestinationen ........................................................................ 83(cid:1)
4.1(cid:1)Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusdestinationen aus
wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive...................................................... 84(cid:1)
4.1.1(cid:1)(cid:3) Eindimensionale Ansätze zur Erklärung der
Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusdestinationen ........................86(cid:1)
4.1.1.1(cid:1) Preis ................................................................................................ 86(cid:1)
4.1.1.2(cid:1) Attraktivität ................................................................................... 88(cid:1)
4.1.1.3(cid:1) Ressourcen als komparative Wettbewerbsvorteile ................. 88(cid:1)
4.1.1.4(cid:1) Ressourcen als kompetitive Wettbewerbsvorteile .................. 90(cid:1)
4.1.1.5(cid:1) Markt- und ressourcenorientierte Ansätze als komparative
Wettbewerbsvorteile .................................................................... 91(cid:1)
4.1.1.6(cid:1) Cluster-Ansätze und Industrielle Distrikte .............................. 93(cid:1)
4.1.1.7(cid:1) Effizienz-Ansatz ........................................................................... 94(cid:1)
4.1.1.8(cid:1) Innovation ..................................................................................... 95(cid:1)
4.1.2(cid:1) Mehrdimensionale Ansätze zur Erklärung der
Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusdestinationen ....................... 97(cid:1)
4.1.2.1(cid:1) Das Modell von Ritchie/Crouch ............................................... 99(cid:1)
4.1.2.2(cid:1) Das Modell von Dwyer/Kim ................................................... 110(cid:1)
4.1.2.3(cid:1) Das Modell von Heath .............................................................. 118(cid:1)
4.2(cid:1)Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusdestination aus gesellschafts-
und raumwissenschaftlicher Perspektive.......................................................129(cid:1)
4.2.1(cid:1) Nachhaltigkeit ..................................................................................... 131(cid:1)
4.2.2(cid:1) Bürgerbeteiligung ................................................................................ 136(cid:1)
4.2.3(cid:1) Zusammenarbeit und Koordination ................................................ 141(cid:1)
4.2.4(cid:1) Information, Wissen & Innovation ................................................. 145(cid:1)