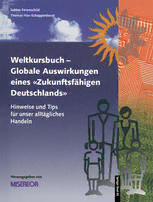Table Of ContentBischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. (Hrsg.)
Sabine Ferenschild, Thomas Hax-Schoppenhorst
Weltkursbuch - Globale Auswirkungen eines "Zukunftsfähigen Deutschlands"
Hinweise und Tips für unser alltägliches Handeln
Mit Illustrationen von Gerhard Mester
Springer Basel AG
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ferenschild, Sabine:
Weltkursbuch - Globale Auswirkungen eines "Zukunftsfähigen
Deutschlands" : Hinweise und Tips für unser alltägliches Handeln /
Sabine Ferenschild ; Thomas Hax-Schoppenhorst. Misereor (Hrsg.). -
ISBN 978-3-7643-5827-3 ISBN 978-3-0348-5091-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-0348-5091-9
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des
Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung
oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei
nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist
auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils gelten
den Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmun
gen des Urheberrechts.
© 1998 Springer Basel AG
Ursprünglich erschienen bei Birkhäuser Verlag 1998
Außenlektorat: Dr. Stefan Breuer, Misereor
Umschlaggestaltung: Matlik & Schelenz, D-55268 Nieder-Olm
Satz und Layout: Bardo Petry
Gedruckt auf säurefreiem Papier, hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. oe
ISBN 978-3-7643-5827-3
987654321
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Einleitung 11
Wohnen - ein Grundrecht zwischen Überfluß und Mangel 18
Wohnen, ein Grundbedürfnis - Die Dinge des Lebens - Elektrogeräte statt Hausarbeit? -
Die Stadt und kein Ende - Lebenswerte ürte, aber wie?
Ernährung - am Tisch der Weltgemeinschaft 40
Zur Welternährungslage - Zu viel, zu fett, zu süß, zu schnell, zu weit -
Nachhaltige Landwirtschaft und neues Konsumverhalten zur langfristigen Sicherung
der Welternährung
Die Kleidung von morgen - zukunftsfähig oder modern?! 62
Kleidung, nicht nur ein Grundbedürfnis - Profit ohne Grenzen in der Konfektionierung -
Der Markt, die Spieler - Altkleider in Deutschland - Der eigene Stil, eine gute Etikette -
Die Kampagne für "saubere" Kleidung
Gesundheit - mehr als die Abwesenheit von Krankheit 86
Zwischen Übergewicht und Existenzkampf - Zum Verständnis von Gesundheit und
Krankheit - Ökologie im Gesundheitswesen - Wege zu einem zukunftsfähigen
Gesundheitsverständnis
Bildung - Motor oder Hemmnis für nachhaltige Entwicklung? 102
Bildung im Norden - Bildung im Süden - Bildung, Motor der Entwicklung
Freizeit - behutsamer, sozialer, näher 124
Ein Begriff, viele Wirklichkeiten - Die Deutschen: Weltmeister im Reisen -
Impulse für ein zukunftsfähiges Freizeitverhalten
Gesellschaftliches Zusammenleben in Zeiten der Globalisierung 144
Globalisierung als Gesellschaftsprojekt - Globalisierung und Regionalisierung:
Die Verschuldungsfalle - Die gefährdete Demokratie - Wasser, die Bedrohung einer
globalen Ressource - Migration - Lösungsansätze
Verkehr - mit Verstand ins dritte Jahrtausend 166
Mit voller Fahrt in die Sackgasse? - Das Sündenregister des Verkehrs-
Über den Wolken muß das Chaos wohl grenzenlos sein - Wege aus der Krise
Nachwort 193
Anhang: Adressen- und Literaturverzeichnis 198
Für
Prälat Narbert Herkenrath
(t 7. Mai 1997)
Vorwort
MISEREOR soll die Armen der Dritten Welt unterstützen - warum mischt es
sich dann in die Diskussionen um ein zukunftsfähiges Deutschland ein?
Die Kritik ist schnell und plakativ formuliert: Misereor ist für die Armen der
Dritten Welt da. Diesen notleidenden Menschen soll das Werk konkret hel
fen. Wenn Misereor sich statt dessen mit Fragen eines zukunftsfähigen Deutsch
lands beschäftigt, gerät es auf Abwege, verfehlt es seinen Auftrag.
Diese schlagwortartigen Formulierungen enthalten eine gefährliche Mischung
aus Richtigem und Falschem. Richtig ist, daß Misereor einzig dafür da ist,
den Armen in der Dritten Welt zu helfen. Falsch ist, daß die Fragen um ein
zukunftsfähiges Deutschland nichts mit dieser Aufgabe zu tun haben. Das
wird klar, wenn man die plakativen Formulierungen einmal hinter sich läßt
und genauer fragt: Wie sieht eigentlich eine Hilfe für die Armen aus, die ihnen
wirklich und auf Dauer hilft?
Die Antwort hat zwei Stoßrichtungen: Zum einen geht es darum, ihnen un
mittelbar materielle und personelle Unterstützung zu geben. Zum anderen ist
es aber ebenso wichtig, sich für eine Beseitigung der Ursachen der Armut
einzusetzen.
Schon bei der Gründung von Misereor hat Kardinal Frings diesen Sachver
halt sehr genau beschrieben. Er sagte im August 1958: "Die Rentenreform
1957 hat mehr Menschen wirtschaftlich geholfen als alle Elisabethen- und
Vinzenzvereine zusammengenommen." Deshalb müsse es die Aufgabe eines
Werkes wie Misereor sein, den Armen direkt zu helfen und zugleich darauf
einzuwirken, daß sich die Rahmenbedingungen für die Armen verbessern.
Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn beides ist das beste,
was man für die Armen tun kann.
Nun gibt es eine Reihe von Strukturen, durch die wir - "wir" als die deutsche
Gesellschaft - mehr profitieren als die armen Länder, obwohl wir doch ohne
hin schon die bessere Lebenssituation haben. Wir schotten unsere Märkte
gegen unerwünschte Konkurrenz ab, verlangen aber von den armen Ländern
die Öffnung ihrer Märkte für unsere Produkte. Deutlich ist dieses Ungleichge
wicht zu unseren Gunsten und zu Lasten der Dritten Welt auch auf dem Ge
biet der Umweltbelastungen. Die Industrieländer produzieren 80 Prozent der
Schadstoffe, die zu Veränderungen des Weltklimas führen, deren Folgen wie
derum die armen Länder noch schlimmer heimsuchen werden als uns. Auch
unsere jetzige Wirtschaftsweise ist so umweltbelastend, daß die ganze Welt
schon längst zusammengebrochen wäre, wenn alle sich so verhielten.
Wenn die Armen der Dritten Welt ihre Armut überwinden wollen, wird das
nur möglich sein, wenn sie die Umwelt mehr belasten als bisher. Die Erde
kann das nur dann verkraften, wenn wir im gleichen Zuge die Umwelt
belastungen bei uns reduzieren. In diesem Sinne schafft eine die Umwelt weni
ger belastende Wirtschaftsweise in unserem Land überhaupt erst den Raum,
den die Armen brauchen, um ihre Armut nachhaltig überwinden zu können.
Das ist eine Einsicht, mit der wir bei unserer alltäglichen Arbeit in der Dritten
Welt immer wieder konfrontiert werden. Was aber folgt daraus? Was muß bei
11
Vorwort
uns selbst konkret verändert werden, damit die Armen der Dritten Welt grö
ßere Lebenschancen erhalten? Das sind schwierige Fragen, auf die es keine
Patentantworten gibt.
Um hier ein Stück klarer zu sehen, haben wir die Studie "Zukunftsfähiges
Deutschland" in Auftrag gegeben. Sie unterbreitet Überlegungen, wie Deutsch
land sich verändern müßte, wenn auch die Bedürfnisse der Armen aus der
Dritten Welt berücksichtigt werden. Sie will Diskussionsanstöße geben.
Prälat Norbert Herkenrath (t 7. Mai 1997) im April 1996
Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor e.V.
Einleitung
Nachhaltige Entwicklung zielt auf eine Entwicklung, "die den Bedürfnissen
der Gegenwart Rechnung trägt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generatio
nen zu beschränken, ihren eigenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen".
Mit dieser Formulierung leitete die von Gro Harlem Brundtland geleitete UN
Kommission für Umwelt und Entwicklung vor 10 Jahren eine neue Phase in
der entwicklungspolitischen und ökologischen Diskussion ein: Indem die In
teressen der zukünftigen Generationen ins Spiel aktueller Politik gebracht
wurden, hob die Brundtland-Kommission die "Gerechtigkeit (. .. ) entlang der
Zeitachse" (Sachs 1997b, S. 27) hervor. Sie vernachlässigte allerdings die For
derung nach Gerechtigkeit in der Gegenwart, denn:
"Welche und wessen Bedürfnisse sollen befriedigt werden? In einer geteilten
Welt sind das Kernfragen, die darüber entscheiden, ob die vertretbare Entwick
lung integraler Bestandteil eines demokratischen Projektes sein kann oder letzt
lich zur Vertiefung der sozialen Polarisierung führt. Ist sie darauf gerichtet, den
Bedarf an Wasser, Land und wirtschaftlicher Sicherheit zu befriedigen, oder
dient sie den Bedürfnissen nach Flugreisen und Bankkonten? Richtet sie sich
auf die Bedürfnisse des Überlebens oder des Luxus? Handelt es sich bei den
angesprochenen Bedürfnissen um die Bedürfnisse einer globalen Klasse von
Konsumenten oder die der riesigen Zahl der Besitzlosen? Die Brundtland-Kom
mission ließ diese Fragen unbeantwortet. Das erleichterte mit Sicherheit die
Akzeptanz des Konzepts der ,nachhaltigen Entwicklung' in den Kreisen von
Privileg und Macht, verschleierte aber die Tatsache, daß es ohne Beschränkung
von Reichtum keine Nachhaltigkeit geben kann. Mit anderen Worten: größere
Gerechtigkeit innerhalb einer Generation ist eine Voraussetzung für die Her
stellung der Gerechtigkeit zwischen den Generationen." (Sachs 1997b, S. 27)
Die Unbestimmtheit der Formulierung ließ die Brundtland-Definition einer
nachhaltigen Entwicklung schnell in aller Munde sein - nahezu jede gesell
schaftliche Gruppe konnte ihre eigenen Interessen in diese Definition hinein
interpretieren.
Mit der Studie "Zukunftsfähiges Deutschland", erstellt vom Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie im Auftrag von Misereor und BUND, sollten die
Anliegen nachhaltiger Entwicklung herunter buchstabiert werden auf die in
Deutschland notwendigen Strukturanpassungen. Mit der Wahl des Begriffs
"zukunftsfähig" (neben "nachhaltig" eine zweite mögliche Übersetzung des
englischen Begriffs "sustainable") suchten sich Autoren und Auftraggeber von
der Beliebigkeit der "nachhaltigen Entwicklung" zu lösen. Mit dem Begriff
"Zukunftsfähigkeit" wollten sie über die umweltpolitische Diskussion hinaus
weisen und den Aspekt der Gerechtigkeit in den Begriff aufnehmen:
"Zukunftsfähigkeit ist im Kern ein normatives Konzept und verlangt Wertur
teile. Wer diese Werturteile nicht teilt, wird zu anderen Ergebnissen kommen
als diese Studie. Die erste, grundlegende Entscheidung heißt: Künftige Gene
rationen sollen gleiche Lebenschancen haben. Jede Generation hat die Erde
treuhänderisch zu nutzen und nachfolgenden Generationen eine möglichst
intakte Natur zu hinterlassen. Und die zweite Wertentscheidung: Jeder Mensch
BI
Einleitung
hat das gleiche Recht auf eine intakte Umwelt und damit umgekehrt auch das
gleiche Recht, globale Ressourcen in Anspruch zu nehmen, solange die Natur
dadurch nicht übernutzt wird. "
(Zukunftsfähiges Deutschland 1997, S. 7)
Umwelt und Entwicklung - zwei Seiten einer Medaille
Die Zusammenhänge zwischen der weltweiten Armutsproblematik und der
Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind unübersehbar:
• Die Ursachen sind teilweise deckungsgleich. So trägt die Verschuldungs
krise nicht nur zur Verelendung in vielen Ländern des Südens, sondern
auch zum ökologischen Raubbau an den natürlichen Gütern der verschul
deten Länder bei.
• Zwischen der Armuts- und der Umweltproblematik besteht ein "positiver
Rückkopplungseffekt": Die Ökologiefrage wird durch die Folgen der Ver
elendung noch verschärft.
• Eine gesellschaftliche Lebensweise ist nur dann "nachhaltig", wenn sie
universalisierbar ist, wenn sie also von allen Menschen gelebt werden könn
te, ohne die globale Ökologie zu gefährden. Dies ist bei der kapitalistischen
Lebens-und Wirtschaftsweise eindeutig nicht der Fall: "Beispiele hierfür sind
die chemieintensive Landwirtschaft, die automobile Gesellschaft und die
fleischhaltige Ernährung. Diese Bereiche der Entwicklung sind strukturell
oligarchisch, sie können nicht weltweit verallgemeinert werden, ohne die
Lebensmöglichkeiten aller aufs Spiel zu setzen." (Sachs 1997b, S. 31)
• Die Auswirkungen der durch unser Wirtschafts-und Lebensmodell produ
zierten ökologischen Veränderungen gefährden bereits jetzt unmittelbar
die Lebens- und Überlebenschancen vieler Menschen im Süden: Beispiele
hierfür sind die Bedrohung der Inselstaaten durch ein Ansteigen des Mee
resspiegels infolge der Erderwärmung, die Zerstörung kleinbäuerlicher
Lebensformen im Nordosten Brasiliens durch die Anlegung von Export
plantagen oder die zunehmenden, ungezählten Umweltflüchtlinge weltweit.
• Während eine Minderheit das "Existenzmaximum " längst überschritten
hat, nimmt die Zahl der Menschen unterhalb der Armutsgrenze oder des
"Existenzminimums" stetig zu. "Dafür verantwortlich ist eine Minderheit,
die bereits alles besitzt, was es für ein Leben in materieller Sicherheit braucht.
Wenn alle Menschen der Erde so wie diese Minderheit produzieren, woh
nen, essen, reisen, einkaufen und wegwerfen wollten, dann würden wir
fünf Planeten brauchen. Zwischen Armut und materiellem Überfluss gibt
es Raum für viele unterschiedliche Lebensweisen. Innerhalb dieses Rau
mes gilt es, eine Existenz aufzubauen, die den Menschen und der Natur
weltweit eine Chance lässt. ,Existenzmaximum' nennen wir die Wohlstands
grenze, die eine zukunftsfähige Entwicklung zulässt." (Sax u.a. 1997, S. 7)
Der anstehende Wandel
Die Zusammenhänge zwischen der Zerstörung unserer natürlichen Lebens
grundlagen und der weltweiten Armutsproblematik vor Augen, stellten sich
die Autoren der Studie "Zukunftsfähiges Deutschland" der Frage, "wie groß
der Handlungsrahmen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Deutsch
lands ist, wenn die Lebenschancen der Menschen in den Ländern des Südens
verbessert und die Lebensgrundlagen künftiger Generationen erhalten wer
den sollen". (Bosse-Brekenfeld 1995, S. 19)
m