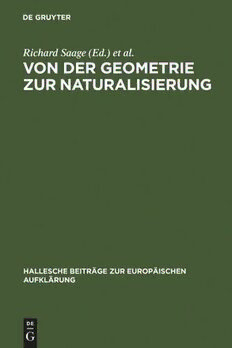Table Of ContentHallesche Beiträge
zur Europäischen Aufklärung 10
Schriftenreihe des Interdisziplinären Zentrums
für die Erforschung der Europäischen Aufklärung
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Von der Geometrie
zur Naturalisierung
Utopisches Denken im 18. Jahrhundert
zwischen literarischer Fiktion
und frühneuzeitlicher Gartenkunst
Herausgegeben von Richard Saage
und Eva-Maria Seng
Max Niemeyer Verlag Tübingen
Wissenschaftlicher Beirat:
Karol Bai, Manfred Beetz, Jörn Garber, Notker Hammerstein, Hans-Hermann
Hartwich, Andreas Kleinert, Gabriela Lehmann-Carli, Klaus Luig, Frangois
Moureau, Monika Neugebauer-Wölk, Alberto Postigliola, Paul Raabe, Hinrich
Rüping, Richard Saage, Gerhard Sauder, Jochen Schlobach, Heiner Schnelling,
Udo Sträter, Heinz Thoma
Redaktion: Sigrid Buthmann
Satz: Kornelia Grün
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufhahme
Von der Geometrie zur Naturalisierung: utopisches Denken im 18. Jahrhundert zwi-
schen literarischer Fiktion und frühneuzeitlicher Gartenkunst / hrsg. von Richard Saage
und Eva-Maria Seng. - Tübingen: Niemeyer, 1999
(Hallesche Beiträge zur europäischen Aufklärung; 10)
ISBN 3-484-81010-6 ISSN 0948-6070
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 1999
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni-
schen Systemen.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Printed in Germany.
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten
Einband: Geiger, Ammerbuch
Inhalt
RICHARD SAAGE, EVA-MARIA SENG:
Einleitung VE
PETER CORNELIUS MAYER-TASCH:
Das Paradies im Quadrat. Zur Entwicklungsgeschichte der Geometrisierung
der Gartenkultur l
HANS-GÜNTER FUNKE:
Die literarische Utopie der französischen Aufklärung zwischen archistischem
(Vairasse, Fontenelle, Morelly) und anarchistischem Ansatz
(Foigny, Fenelon, Lahontan) 8
JOACHIM MEISSNER:
Die Venus von Tahiti. Über den Anteil der Südseeutopien
an der Erotisierung des Utopischen 28
HEINZ THOMA:
Utopie, Naturzustand und Vertragsdenken bei Rousseau 50
HUBERTUS GÜNTHER:
Kult der Primitivität im Klassizismus 62
ULF KÜSTER:
Natur ordnen. Landschaftserfahrung im 18. Jahrhundert 109
EVA-MARIA SENG:
Die Wörlitzer Anlagen zwischen Englischem Landschaftsgarten
und Bon-Sauvage-Utopie? 117
ERHARD HIRSCH:
Utopia realisata. Utopie und Umsetzung: Aufgeklärt-humanistische
Gartengestaltung in Anhalt-Dessau 151
VI
MICHAEL NIEDERMEIER:
Wörlitz als höfische Veranstaltung? Eros zwischen höfischer Selbstreflexion,
pädagogischer Kontrolle und naturalisierter Utopie 180
JÖRN GARBER:
Antagonismus und Utopie: Georg Forsters Städtebilder im
Spannungsfeld von .Wirklichkeit' und ,Idee' 209
HANS ULRICH SEEBER:
Arcadia, Utopia, America. William Dean Howells' A Traveller from Altruria
(1892/93) and the tradition of pastoral thinking in Utopian literature 237
RICHARD SAAGE:
Utopie und Industrielle Revolution bei William Morris und Oscar Wilde . . . 258
BETTIN A Ross:
Sexualität in Utopien - ein Forschungsgegenstand? 280
Verzeichnis der Abbildungen 288
Namenregister 291
Einleitung
In dem Sammelband Die Politisierung des Utopischen im 18. Jahrhundert wurde
der erfolgreiche Versuch unternommen, eine neue Dimension des Utopischen zu
rekonstruieren. Es ging um die Frage, „wie es zu einer Realisierung dessen kom-
men kann, was zunächst nur Fiktion ist".2 Ungeklärt blieb indes das Problem, in
welchen Mustern und Konfigurationen sich diese Politisierung im Rahmen der
„anthropologischen Wende" um die Mitte des 18. Jahrhunderts niederschlug.
Dieser Vorgang ist in seiner ganzen Tragweite nicht hoch genug einzuschätzen.
Die Aufklärung hatte den Menschen bis dahin als reines Vemunftwesen aufgefaßt,
das im Sinne der cartesianisehen „res cogitans" interpretiert wurde. Jetzt begann
sie, den sinnlichen Menschen zu entdecken, dessen Leiblichkeit sie als konsti-
tutiven Bestandteil der menschlichen Existenz aufwertete. Daß durch diese Re-
habilitierung der Sinne der Vernunft neue Erfahrungsräume erschlossen wurden,
liegt auf der Hand. Doch wie wirkte sich die „Wendung zum Körper",3 zur Emo-
tionalität und die damit verbundene Umorientierung von der Leitwissenschaft der
Geometrie zu jener der Biologie auf das utopische Denken in Gestalt der literari-
schen Fiktion und der gestalteten Natur aus? Diese Frage stand im Zentrum des
Symposiums „Von der Geometrie zur Naturalisierung. Utopisches Denken im 18.
Jahrhundert zwischen literarischer Fiktion und frühneuzeitlicher Gartenkunst" am
Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der
Universität Halle-Wittenberg vom 22.-24.9.1997, dessen Referate in diesem Band
abgedruckt worden sind.
Den Veranstaltern war von Anfang an klar, daß die Fragestellung des Symposi-
ums nur in einem interdisziplinären Forschungszusammenhang sinnvoll zu disku-
tieren ist. Jeder Versuch, die Korrelation von utopischem Denken und frühneuzeit-
licher Gartenkunst in enger fachspezifischer Perspektive zu untersuchen, hätte eine
Deformation des Forschungsgegenstandes bedeutet, dessen „Identität" doch gerade
in der Totalität sozialwissenschaftlicher, kunst- bzw. architekturgeschichtlicher,
historischer, ethnologischer, philosophischer und literaturwissenschaftlicher Ele-
mente besteht. Daß es den Veranstaltern gelang, führende Repräsentanten dieser
1 Vgl. Neugebauer-Wölk, Monika/Saage, Richard (Hg.), Die Politisierung des Utopischen im
18. Jahrhundert. Vom utopischen Systementwurf zum Zeitalter der Revolution. Tübingen
1996 (Hailesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung 4).
2 Neugebauer-Wölk, Monika, Zur Einführung, in: Die Politisierung, (wie Anm.l), S. VIII.
3 Schings, Hans-Jürgen, Vorbemerkung des Herausgebers, in: ders. (Hg.), Der ganze Mensch.
Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. DFG-Symposion 1992. Stuttgart/Weimar
1994,8.5.
Richard Saage, Eva-Maria Seng
Fächer zu gewinnen, die bereit waren, ihre engen fachlichen Grenzen zu über-
schreiten und ihr Wissen mit den Kenntnissen anderer Disziplinen zu verbinden,
war die entscheidende Bedingung für das Gelingen des ganzen Unternehmens. Ein
weiteres Problem kam hinzu. Die Veranstalter waren mit der Schwierigkeit
konfrontiert, den mit der „anthropologischen Wende" des 18. Jahrhunderts
verbundenen Paradigmenwechsel im Sinne ihrer Fragestellung zu konzeptualisie-
ren. Den Schlüssel zur Lösung ihres Problems sahen sie in der Unterscheidung
zwischen „archistischer" und „anarchistischer" Utopie. Erst verhältnismäßig spät,
nämlich im Jahr 1906, hat Andreas Voigt darauf hingewiesen, daß die autoritäre
Staatsutopie in der Geschichte dieses Genres stets auch von einer anderen Variante
begleitet wurde, die gerade mit dem Antiindividualismus und dem repressiven
Institutionalismus des Staatsromanes brach. Um ihr spezifisches Profil zu verdeut-
lichen, führte er eine analytische Trennung zwischen zwei Typen von Utopieent-
würfen durch.
Er begründete deren unterscheidendes Merkmal anthropologisch, nämlich „in
dem verschiedenen Verhalten der Menschen zum Herrschen und Dienen, zu
Zwang und Freiheit".4 Unselbständige Naturen, die der Hilfe, Fürsorge und Bera-
tung bedürften, seien die einen bereit, sich der Herrschaft anderer zu unterwerfen,
um bei ihnen Schutz, Frieden und materielle Sicherheit zu finden. Die anderen
dagegen sähen den höchsten Wert in der als Selbstbestimmung verstandenen Frei-
heit, der sie Güter wie wirtschaftliche Sicherheit etc. unterordneten. Voigt zufolge
entsprechen nun diesen beiden Charaktergegensätzen der Menschen zwei ebenso
gegensätzliche Arten von Utopien, die freilich Mischformen nicht ausschließen.
Die eine Variante kennzeichnete er durch den Idealtypus der archistischen Utopie.
Ihr Ideal ist in der Regel das eines Staates mit starker, umfassender Zentralgewalt, welche alle
Beziehungen der Staatsangehörigen aufs strengste regelt und diese in strammer Zucht hält.
Freiheit ist nur für die Herrscher; die Masse hat sich den Gesetzen des Staates und den Ver-
ordnungen der Obrigkeit einfach zu fügen.5
Demgegenüber geht die anarchistische Utopie von dem Gesellschaftsideal der
absoluten persönlichen Freiheit aus. Sie lehnt Jeden Zwang, jede Art der Herr-
schaft" ab und darum auch deren Organe wie Regierung, Polizei, Justiz und selbst-
verständlich auch den Staat als den Träger dieser Gewalten. Selbst geistige Mächte
wie Autorität, Sitten und Religion verfallen dem Verdikt der Herrschaftslosigkeit.6
Ohne die konservativen und utopiefeindlichen Intentionen Voigts mit zu über-
nehmen,7 meinen wir, daß diese idealtypische Unterscheidung ein nützliches
4 Voigt, Andreas, Die sozialen Utopien. Fünf Vorträge. Leipzig 1906, S. 18.
5 Ebd., S. 19.
6 Ebd.
7 So sieht Voigt den „Fehler des Utopismus" darin, „daß ihm die Welt zu einfach vorkommt und
er die Lösung all ihrer Widersprüche gefunden zu haben glaubt" (ebd., S. V). Auch geht er von
der „Verkehrtheit der utopischen Weltanschauung" und deren „Irrlichtnatur" (ebd.) aus.
Einleitung IX
heuristisches Instrumentarium bietet, um das Thema dieses Bandes zu verdeutli-
chen. Es läßt sich nämlich nachweisen, daß die archistische Utopie durch spezifi-
sche Muster der Stadtplanung und der Architektur gekennzeichnet werden kann,
die eine bemerkenswerte Kontinuität von der frühen Neuzeit bis zur russischen
Avantgarde in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts aufweist.8 Wir möchten
folgende Aspekte nennen: Zunächst fällt auf, daß die Stadtplanung auf die Ratio-
nalität geometrischer Basisfiguren wie Quadrat, Rechteck und Kreis festgelegt ist.
Nicht zufällig entsteht die utopische Stadt der frühen Neuzeit auf einer „tabula
rasa": Ihre Gründung setzt gleichsam voraus, daß von den ursprünglichen Gege-
benheiten der Landschaft abstrahiert wird, um der Natur von außen rational durch-
dachte Formen aufzuzwingen. Die utopischen Städte selbst sind in ihrer Planung
und Architektur vollständig transparent und homogen. Den seriellen Typenhäusern
sind im Rastersystem oder in Kreisform angelegte Straßen zugeordnet. Da die
Privatheit in einem Maße abgeschafft ist, daß selbst die Sexualität staatlicher Kon-
trolle unterliegt, stellt sie keine architektonische Herausforderung dar. Der städte-
planerisch und architektonisch zu gestaltende utopische Raum ist per se „öffent-
lich" und läßt für die Entfaltung individueller Bedürfnisse nur einen begrenzten
Raum: Sie sind als Rahmenbedingung für Stadtplanung und Architektur unerheb-
lich. Ihre Zielperspektive besteht vielmehr darin, funktional auf die Hervorbrin-
gung eines kollektiven Gemeinwesens bezogen zu sein, dessen Träger ein „neuer
Mensch" in einer „geometrischen Epoche" ist. Sein Auge will, um mit El Lissitzky
zu sprechen, „reine einfache Formen sehen, die in klaren Proportionen gegliedert
und zur genauen Orientierung im Raum exakt miteinander koordiniert sind".9
Im Gegenzug zu diesem Ansatz läßt die anarchistische Utopie ein ganz anderes
Naturverhältnis erkennen. Sie strebt nicht Herrschaft über die Natur an; ihr Ziel ist
vielmehr, die durch die Zivilisation depravierte Natur - einschließlich die des
Menschen selbst - möglichst authentisch wieder herzustellen. In dezentralen und
in von Institutionen weitgehend entlasteten Lebenswelten soll das zwischen-
menschliche Verhalten gleichsam renaturalisiert werden: Nicht zufällig empfiehlt
sie vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das Leben der sogenannten Natur-
völker als Vorbild für die in ihrer Sicht verkommenen Zivilisationen der westli-
chen Länder. Materieller Überfluß - durch die Natur direkt gesichert - soll den
Zwängen der organisierten Arbeitsteilung den Boden entziehen, um ein authenti-
sches Leben, das sich ausschließlich an natürlichen Normen orientiert, überhaupt
erst zu ermöglichen. Auf den ersten Blick scheint der Gegensatz zwischen der
geometrischen Ausrichtung der archistischen und der naturalisierenden Stoßrich-
tung der anarchistischen Utopie unüberbrückbar zu sein. Doch verbindet beide
8 Vgl. Saage, Richard/Seng, Eva-Maria, Geometrische Muster zwischen frühneuzeitlicher
Utopie und rassischer Avantgarde, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 44. Jg. (1996),
S. 677-692.
9 El Lissitzky, Proun und Wolkenbügel. Schriften, Briefe, Dokumente. Dresden 1977, S. 61.
X Richard Saage, Eva-Maria Seng
Utopietypen eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie sind Konstrukte der menschlichen
Vernunft, die sie als kritische Gegenbilder in Gestalt solidarischer und kon-
fliktfreier Gemeinwesen der bestehenden Gesellschaft konfrontiert.10
Mit diesem Hinweis ist das Thema des vorliegenden Bandes hinreichend ver-
deutlicht. Ihm lag die Hypothese zugrunde, daß die Aufklärung vor der anthropo-
logischen Wende mit ihrer einseitigen Betonung des Primats der Rationalität zu-
gleich auch die Option für ein utopisches Gesellschaftsmodell bedeutet, das - in
sich schlüssig und möglichst widerspruchsfrei - der individuellen Spontaneität
wenig Raum läßt, dafür aber der rationalistischen Planung von einem übergeord-
neten Zentrum her hegemoniale Bedeutung beimißt. Umgekehrt implizierte diese
Hypothese aber auch, daß die Aufwertung des dunklen „fundus animae" bzw. der
„unteren Seelenkräfte" und des Unbewußten im Rahmen der anthropologischen
Wende die Vernunft aus dem engen Korsett diskursiver Rationalität befreit." Ihr
ist ein utopisches Gesellschaftsmodell zuzuordnen, in dem Herrschaft und repres-
sive Institutionen auf ein Minimum reduziert und für das Individuum im Namen
der Naturalisierung der Lebenswelten neue Räume der Spontaneität freigesetzt
werden, die die ältere Aufklärung nicht kannte. Da sich nachweisen läßt, daß die
auf geometrische Formen fixierte etatistische Utopie spezifische Muster der Stadt-
planung, Architektur und Gartenkunst induziert hat, ist die Frage aufgeworfen, wie
es sich in dieser Hinsicht mit den naturalisierten anarchistischen Utopien verhält.
Gibt es Entsprechungen zwischen ihnen und bestimmten Formen der Gestaltung
von Lebensräumen, wie wir sie in der klassischen archistischen Utopie beobachten
können?
Im Licht dieser übergreifenden Fragestellungen sollten die folgenden Beiträge
gelesen werden. Daß sie von den jeweiligen Autoren kontrovers diskutiert wurden,
versteht sich von selbst. Doch weisen die Herausgeber darauf hin, daß sie zu kei-
nem Zeitpunkt von der Annahme ausgegangen sind, im Zuge der anthropologi-
schen Wende und der von ihr ausgelösten Naturalisierungsdebatte sei das „archi-
stische" Muster schlicht vom „anarchistischen" Utopietyp abgelöst worden.12 Frei
von allen teleologisehen Unterstellungen sahen sie in jener Unterscheidung nichts
anderes als einen heuristischen Fokus, der Licht werfen sollte auf einen Prozeß,
welcher von Anfang an in Mischformen verlief. Doch dessen Elemente und ihre
Gewichtung im Gesamtzusammenhang zu verdeutlichen, setzte eine Klärung der
Begrifflichkeit voraus, die sich freilich in der Konfrontation mit dem zu untersu-
10 Vgl. Saage, Richard/Seng, Eva-Maria, Naturalisierte Utopien zwischen literarischer Fiktion
und frühneuzeitlicher Gartenkunst, in: Greven, Michael Th./Münkler, Herfried/Schmalz-
Bruns, Rainer (Hg.), Bürgersinn und Kritik. Festschrift für Udo Bermbach zum 60. Geburts-
tag. Baden-Baden 1998, S, 207-238.
11 Schings, Vorbemerkung, (wie Anm. 3), S. 5.
12 Vgl. hierzu die Kritik an der Konzeption des Symposiums bei Hans-Günter Funke, Die literari-
sche Utopie der französischen Aufklärung zwischen archistischem (Vairasse, Fontenelle,
Morelly) und anarchistischem Ansatz (Foigny, Fdnelon, Lahontan), in diesem Band.