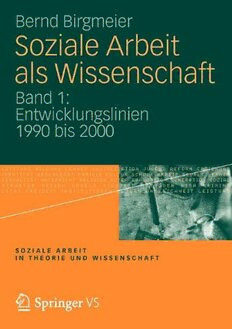Table Of ContentSoziale Arbeit in Theorie
und Wissenschaft
Herausgegeben von
E. Mührel, Eichstätt-Ingolstadt
B. Birgmeier, Eichstätt-Ingolstadt
Herausgegeben von
Prof. Dr. Eric Mührel PD Dr. Bernd Birgmeier
Katholische Universität Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt Eichstätt-Ingolstadt
Bernd Birgmeier
Soziale Arbeit
als Wissenschaft
Band 1:
Entwicklungslinien 1990 bis 2000
Bernd Birgmeier
Eichstätt-Ingolstadt, Deutschland
ISBN 978-3-531-17741-0 ISBN 978-3-531-94239-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-531-94239-1
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufb ar.
Springer VS
© VS Verlag für Sozialwissenschaft en | Springer Fachmedien Wiesbaden 2012
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürft en.
Einbandentwurf: KünkelLopka GmbH, Heidelberg
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE.
Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer-vs.de
Inhalt 5
Inhalt
Prolog.................................................................................................................... 9
1 Soziale Arbeit im Zeitalter ohne Synthese? Geschichte
und Geschichten zur Sozialen Arbeit als Wissenschaft
in den 1990er Jahren .......................................................................... 13
1.1 (Selbst-)Erkenntnisse historiographischen Denkens
in Sozialer Arbeit – eine Einführung .................................................... 13
1.2 Stichpunkte einer Historiographie ab der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts .............................................................................. 23
1.3 Die 1990er Jahre: das sozialarbeitswissenschaftliche Jahrzehnt
im sozialpädagogischen Jahrhundert? ................................................... 32
2 Diskursebenen zur Frage nach einer Sozialen Arbeit als
Wissenschaft – eine systematisierende Reflexion der
Wissenschaftsdebatte in den 1990er Jahren ..................................... 43
2.1 Zur (Verhältnis-)Bestimmung der Begriffe Sozialpädagogik,
Sozialarbeit, Soziale Arbeit .................................................................. 43
2.2 Historiographisch verbürgte Wurzeln einer Sozialen Arbeit
als Wissenschaft .................................................................................... 47
2.3 Verständnisse und „Lesarten“ von Pädagogik und
Erziehungswissenschaft ........................................................................ 52
2.4 Bezugswissenschaftliche und wissenschaftssystemische Fragen ......... 56
2.5 Die Bi-Polarität der Ausbildung in Sozialer Arbeit .............................. 61
6 Soziale Arbeit als Wissenschaft
2.6 Strukturelle, inhaltliche und curriculare Spezifika diverser
Hochschultypen .................................................................................... 65
2.7 Wissenschaftstheorie versus Wissenschaftspolitik? ............................. 69
2.8 „Mythos“ Praxis und das Verhältnis zwischen Disziplin
und Profession ...................................................................................... 74
2.9 Der Hiatus zwischen Theorie und Praxis und die Folgen
für die Forschung .................................................................................. 78
2.10 Zusammenfassung ................................................................................ 82
3 Soziale Arbeit – Wissenschaft – Wissenschaftstheorie:
Grundlagen und Grundfragen zum Verständnis von
Wissenschaft(stheorie) und ihrem Verhältnis zur
Sozialen Arbeit .................................................................................... 93
3.1 Soziale Arbeit? ..................................................................................... 93
3.2 Soziale Arbeit als Wissenschaft? .......................................................... 98
3.2.1 Soziale Arbeit als Wissenschaft = Sozialarbeitswissenschaft? .... 99
3.2.2 Sozialpädagogik als Wissenschaft oder Sozialarbeitswissenschaft? .... 103
3.3 Wissenschaft? ..................................................................................... 106
3.3.1 Die Idee der Wissenschaft ......................................................... 110
3.3.2 Wissenschafts-Wissenschaften und Wissenschaftstheorie......... 113
3.3.3 Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie ............................. 117
3.3.4 Soziale Arbeit im System der Wissenschaften .......................... 119
3.3.5 Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften ........................ 121
3.4 Soziale Arbeit als (wissenschaftliche) Disziplin und
(wissenschaftsgestützte) Profession? .................................................. 123
3.4.1 Disziplin und Profession – Theorie und Praxis? ........................ 124
3.4.2 Theoretische und praktische Wissenschaften –
Erkenntnis- und Handlungswissenschaften ............................... 129
3.4.3 Grundlagenwissenschaften und Angewandte
Wissenschaften .......................................................................... 133
Inhalt 7
3.5 Wissenschaft im Spagat zwischen Tradition und Moderne? .............. 137
3.5.1 Die Modernisierung von Wissenschaft – Grundzüge
einer Wissenschaftskritik .......................................................... 137
3.5.2 Von der Logik zu den Logiken der Wissenschaft? ...................... 141
3.5.3 (Fehl-)Funktionen der Wissenschaft: aktuelle Trends ............... 145
4 Fazit und Perspektiven: ein Blick zurück nach vorn
in die Wissenschaft(en) Sozialer Arbeit –
Diskursanalysen und -interpretationen .......................................... 151
4.1 Theoreme reloaded: Soziale Arbeit als Wissenschaft – eine
Formel und drei Modelle? ................................................................... 151
4.2 Von der Sozialen Arbeit als Wissenschaft zur
Wissenschaft Soziale Arbeit? .............................................................. 160
4.3 „Wissenschaft Soziale Arbeit“: ein Programm für
die dialektische Aufhebung und Relativierung der
Problemebenen aus den 1990ern? ....................................................... 168
5 Zur Notwendigkeit der Wissenschafts- und
Erkenntnistheorie in der Wissenschaft Soziale Arbeit –
ein Preview ........................................................................................ 179
Epilog................................................................................................................ 187
Literatur ............................................................................................................ 191
Prolog 9
Prolog
Nur selten zuvor in ihrer langen Geschichte ist die Soziale Arbeit zu einem derart
streitbaren und emotional aufgeladenen Gegenstand geworden wie in den Dis-
kussionen über ihre Gestalt, ihren Gehalt und ihren Zustand „als Wissenschaft“
im Zeitraum zwischen 1990 bis 2000. Diese sog. „wilden 1990er Jahre“ (Birg-
meier 2003, 19 ff.) stehen nicht nur als Synonym für einen entwicklungsge-
schichtlichen Übergang Sozialer Arbeit in eine „multiperspektivisch-chaotische
Phase“ (vgl. Hey 2000), sondern gleichermaßen auch als Etikett für ein „sozial-
arbeitswissenschaftliches Jahrzehnt“ im sozialpädagogischen Jahrhundert – ein
Jahrzehnt, in dem viele unterschiedliche Auffassungen zur Wissenschaft im
Allgemeinen, zur Wissenschaftlichkeit von Sozialer Arbeit im Speziellen vorget-
ragen wurden und das dementsprechend auch zu Auseinandersetzungen zwi-
schen zwei – so schien es – deutlich unterscheidbaren wissenschaftlichen Diszip-
linen der Sozialen Arbeit führte: der Sozialpädagogik (als Wissenschaft) und der
Sozialarbeitswissenschaft.1
Auseinandersetzungen über die Leistungen, den Stand und die Entwicklung
von einzelnen Wissenschaften bzw. wissenschaftlichen Disziplinen berühren
jedoch nicht nur deren inhaltlich-fachliche Struktur oder deren unverwechselbare
kognitive Identität (vgl. Lepenies 1981; Scherr 2010, 284; vgl. dazu auch De-
we/Otto 2011a, 1740 ff.). Solche Auseinandersetzungen berühren auch den Kern
des Selbstverständnisses derer, die sie betreiben (vgl. Fischer 2007, 65).2 Inso-
1 Wissenschaftliche Diskurse innerhalb eines Fachgebietes dienen i.e.L. der Bestandsaufnahme, der
Weiterentwicklung und der schärferen Profilbildung der (kognitiven) Identität einer Disziplin. Dies
gilt auch für Fragen nach den wissenschaftlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit sowie für Fragen
nach dem jeweiligen Stand ihrer Forschung und Theorieentwicklung. Der Umgang mit solcherlei
Fragen erfordert jedoch immer auch – so Ortega y Gasset (2008) – ein gewisses Maß an sportlicher
Geschicklichkeit, Heiterkeit und Unbekümmertheit sowie „das Ansinnen, Theorien nicht in Glau-
bensgewissheiten verwandeln zu müssen, sondern sie überzeugend in den Diskurs mit anderen ein-
zubringen“ (Mührel/Birgmeier 2011, 8). Auch die Diskurse zur Sozialen Arbeit als Wissenschaft
bzw. zur Sozialarbeitswissenschaft in den 1990er Jahren lassen sich durchaus ähnlich als „sportlicher
Wettkampf“ deuten, wenngleich bei so manchen Argumentationssträngen die Heiterkeit, Unbeküm-
mertheit und das (denk-) sportliche Fairplay nur am Rande eine Rolle zu spielen schienen.
2 Scherr verweist – angelehnt an Lepenies (1981) – in diesem Zusammenhang darauf, dass man
wissenschaftliche Disziplinen „nun ersichtlich nicht in der gleichen Weise begründen (kann; B.B.)
wie eine Ehe oder einen Verein, also durch einen performativen Akt der Deklaration. Entscheidend
ist vielmehr, inwiefern es gelingt, die Grundlagen einer solchen Disziplin sowohl sachhaltig zu
bestimmen (kognitive Identität der Disziplin) als auch ihre gesellschaftliche Anerkennung durchzu-
10 Soziale Arbeit als Wissenschaft
fern durfte so mancher Wissenschaftsentwickler in den 1990er Jahren, der es
wagte, (s)ein Bild der Wissenschaft Sozialer Arbeit vorzustellen, das der Wahr-
nehmung und dem Selbstverständnis Andersdenkender nicht entsprach, auch
nicht immer auf Milde seitens der (scheinbaren) „Konkurrenz“ hoffen (vgl. Fi-
scher 2007).3
Freilich haben derlei Auseinandersetzungen über den Begriff der Wissen-
schaft in dem durch die griechische Philosophie geprägten Teil der Welt eine
lange Tradition. Doch obgleich die Geschichte der Debatten um den Inhalt und
den Begriff der Wissenschaft bereits über zweieinhalb Jahrtausende anhält, wur-
de – insbesondere und im Falle der Diskussionen um die Soziale Arbeit als Wis-
senschaft – auch zum Ende dieses sozialarbeitswissenschaftlichen Jahrzehnts nur
teilweise ein Konsens erreicht. Definitionen von Wissenschaft und von den
Funktionen und Aufgaben wissenschaftlicher Disziplinen, wie sie in den 1990ern
einerseits von der Sozialpädagogik, andererseits von der Sozialarbeitswissen-
schaft vorgenommen wurden, sind daher zwangsweise auch nahezu unfehlbare
Katalysatoren zur Auslösung von Kontroversen (vgl. Fischer 2007, 66).4
Worum es in diesen Kontroversen konkret ging und welche Hintergründe
und Ursachen für die „wilden 1990er Jahre“ ausgemacht werden können, ist die
Leitfrage und das Kerninteresse zugleich, dem sich das vorliegende Buch wid-
met.5
setzen (soziale Identität der Disziplin) sowie eine Disziplingeschichte zu begründen, auf die sich der
disziplinäre Diskurs beziehen kann (historische Identität)“ (Scherr 2010, 285).
3 Das Vorstellen unterschiedlicher „wissenschaftlicher Bilder“ ist hier zu verstehen als das Bemühen
einzelner Experten, den Prozess, die Potentiale und die Probleme der Wissenschaftsentwicklung
Sozialer Arbeit konzeptionell darzulegen und als Grundlage zur wissenschaftlichen Diskussion
anzubieten. Daher verbietet es sich im Rückblick auf die 1990er-Debatte grundsätzlich von den
Sozialarbeitswissenschaftlern oder den Sozialpädagogen (institutionalisiert: vor der Sozialarbeitswis-
senschaft und der Sozialpädagogik) in ihrer Allgemeinheit zu sprechen. Der Einfachheit halber und
der authentischen Berichterstattung wegen wird in nachfolgenden Ausführungen dennoch auch
teilweise die verallgemeinernde Form verwendet.
4 Dies insbesondere dann, wenn – nach Merten – der Annahme Rechnung getragen werden will, „die
längst überholte Diskussion um Gemeinsamkeiten und Differenzen von Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik“ ad acta zu legen, da solcherlei Diskussionen zu „unsinnigen Unterstellungen“ nötigen könnten
(vgl. Merten 1997c, 300).
5 Ähnliche Kerninteressen verfolgten u.a. bereits auch Hans-Jürgen Göppner und Juha Hämäläinen,
die in ihrem empfehlenswerten Buch Die Debatte um Sozialarbeitswissenschaft. Auf der Suche nach
Elementen ihrer Programmatik (2004) ebenso versuchen, das, was in und hinter dem Phänomen
„Sozialarbeitswissenschaft“ steht, zu entschlüsseln. „Die Hintergründe“, so Göppner/Hämäläinen,
sind jedoch „nicht so recht erhellbar … Auf jeden Fall scheint der Versuch lohnend, die umfangrei-
che Literatur zu sichten und auszuloten, wie ein argumentativer Fortschritt zu erreichen wäre“ (ebd.
2004, 11). Ihr Vorhaben beruht damit – analog zum vorliegenden Band – auf dem Interesse, „für eine
´konzertierte´ Argumentation zu sorgen, welche die verschiedenen Positionen aufeinander bezieht
und in ihrem Geltungsanspruch miteinander abzugleichen versucht, um so zur Verbesserung der
Diskussionskultur beizutragen“ (2004, 11).
Prolog 11
Um überhaupt zu einer (vorläufigen) Antwort auf diese Frage zu stoßen,
werden im Anschluss an ein einführendes Kapitel 1, das sich um die historische
und historiographische Einbettung der 1990er Jahre in die Geschichte(n) der
Sozialen Arbeit bemüht, in Kapitel 2 die einzelnen Diskursebenen zur Frage
nach der Sozialen Arbeit als Wissenschaft dargestellt, systematisch reflektiert
und analysiert. Dieses Kapitel verfolgt somit – ganz im Sinne eines Problemauf-
risses der einzelnen „Problemlinien“ (vgl. Merten 2005) – den Zweck, mit Hilfe
einer Analyse der in den 1990er Jahren veröffentlichten einschlägigen Publika-
tionen, Literaturquellen und Dokumente die wichtigsten und zentralsten Themen
der Debatte nachzuzeichnen, um hierüber ein vorläufiges Raster zur Systemati-
sierung der Brennpunkte und Dialektiken innerhalb der einzelnen Diskussions-
themen zu entwickeln.6
Die Analyse dieser „Problemlinien“ der 1990er Jahre macht deutlich, dass
sich insbesondere zwei Problempunkte in der Programmformel Soziale Arbeit als
Wissenschaft herauskristallisierten, von denen auch die Klärung der anderen
Diskursebenen abzuhängen schien: einerseits die Schwierigkeiten einer einheitli-
chen Definition der Begriffe Soziale Arbeit, Sozialarbeit, Sozialpädagogik und
Sozialarbeitswissenschaft und – als Konsequenz dessen – die Heterogenität in
der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Sozialpädagogik (als Wissenschaft)
und Sozialarbeitswissenschaft; zum anderen die Probleme der Bestimmung des
Begriffs Wissenschaft und die Frage nach dem Verhältnis zwischen Disziplin
und Profession.
Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 3 ein wissenschafts- und erkenn-
tnistheoretischer Rahmen gespannt, der (mögliche) Antworten auf die Frage
geben soll, was Wissenschaft ist und welche Anforderungen auch eine Soziale
Arbeit als Wissenschaft bzw. die Wissenschaft Soziale Arbeit diesbezüglich zu
erfüllen hätte. Hier werden also allgemeine Grundlagen der Wissenschaft be-
schrieben und Kriterien erläutert, die für jedes wissenschaftliche Fachgebiet
gelten. Im Kontext der Frage nach dem Unterschied bzw. Verhältnis zwischen
Disziplin und Profession werden hier zudem einige Wissenschaftsprogramme
6 Damit verfolgen die nachfolgenden Ausführungen nicht etwa das Ziel Göppners und Hämäläinens,
als „Ergebnis der Recherchen“ dafür zu plädieren, „eine Sozialarbeitswissenschaft als eine praktische
und epistemologische Notwendigkeit zu betrachten“ (2004, 11). Die hier vorgelegten Entwicklungs-
linien 1990 bis 2000 dienen einzig dem Versuch einer neutralen Bestandsaufnahme darüber, welche
Argumente von einzelnen Diskutanten jeweils vorgetragen wurden. Es geht hier also darum, ohne
Votum für oder gegen einen bestimmten Argumentationsstrang die Essenzen der Debatte nachzuer-
zählen und allenfalls Faktoren zu identifizieren und zu systematisieren, die vermeintlich eine Antwort
geben auf die Frage, worum es in den Diskursen der 1990er Jahre konkret zu gehen schien. Diesbe-
züglich sei auch hier das bereits von Göppner/Hämäläinen hervorgehobene Eingeständnis betont,
dass man bei solchen Vorhaben an Grenzen stößt (bzw. stoßen muss), „so dass eine Nichtberücksich-
tigung oder eine zu geringe Würdigung von Beiträgen keinerlei Urteil über deren Relevanz bedeutet“
(2004, 12).