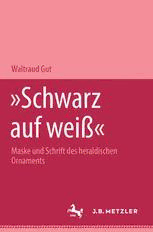Table Of Content»Schwarz auf weiß«
Maske und Schrift des heraldischen Ornaments
Waltraud Gut
»Schwarz auf weiB«
Maske und Schrift
des heraldischen Ornaments
Verlag J. B. Metzler
Stuttgart . Weimar
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Gut, Waltraud:
»Schwarz auf weiB«. Maske und Schrift des heraldischen Ornaments.
-Stuttgart ; Weimar: Metzler, 2000
Zugl.: Konstanz, Univ., Diss. 1998
ISBN 978-3-476-45246-7
ISBN 978-3-476-02747-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-02747-4
Dieses Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschtitzt. Jede
Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzuliissig und strafbar. Das gilt insbesondere fUr
Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
M & P Schriftenreihe fUr Wissenschaft und Forschung
© 2000 Springer-Verlag GmbH Deutschland
Ursprtinglich erschienen bei I.B.Metzlersche Verlagsbuchhandlung
und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2000
Inhaltsiibersicht
1.0 Einleitung: Diskurs und Metapher des Wappens 7
1. 1 Das Wappen auf Reisen 10
1. 2 Das Wappen des Entdeckers und das Wappen des Anfangs 12
1. 3 Das Wappen als Negativ der Schrift 16
1. 4 Das Wappen als erzahlter Korper 19
2.0 Abenteuerliche Mobilitat 21
2. 1 Zur Heterotopie des Mittelalters 21
2. 2 Abenteuerliche Riistungen und hOfische Feste 26
2.3 Vagabundierende Aristokraten 38
2.4 Ritter und Rittertum 46
3. 0 1m Museum der Geschlechter 64
3. 1 Das Wappen der Sachkultur 64
3.2 Das Wappen des Namens 75
4. 0 Ornamente des Kulturbegriffs 80
4. 1 Ornament und Gegen-Ordnung 80
4. 2 Ornament und Textur 85
4. 3 Ornamentlektiiren 92
S. 0 Ornament und Schrift 11 0
5. 1 Der Herold als Agent der Transcodierung 110
5.2 Der Begriff der Reprasentation und seine Medien 119
5.3 Reprasentation und Apprasentation 130
5. 4 Der Herold im Feld der hOfischen Kommunikation 135
5.5 Heraldik als entzifferte Ornamentik 146
5. 6 Groteske Heraldik 153
5
6.0 Ornament und Korper 166
6.1 Wappen und Korper 166
6.2 Wappenstil und Schneiderkunst 176
6.3 Der Korper als Text 183
6.4 Ornament der Geste: Symmetrisches und Asymmetrisches 191
6. 5 Die Fahrenden: die hybride Maske der Mimesis 209
6. 6 Das Geteilte und das Ganze 217
6. 7 Montage und Ensemble 229
7.0 Ornament und Text 245
7. 1 Segmentieren und Skelettieren 245
7. 2 Zerteilen und Zusammenftigen 258
7.3 Poetologische Symmetrien im hOfischen Roman 271
7. 4 Masken des Schreibens 281
7.5 Schreibstuben 293
8. 0 Zusammenfassung 299
Anhang
A Bildtafeln
305
B Bildnachweis 338
C Literaturnachweis 340
6
1. 0 Einleitung: Diskurs und Metapher des Wappens
Der Geschichte des Wappens fehlt bis heute eine kulturhistorische Untersu
chung, die sich auf die Beschreibung der heraldischen Bild- und Ornamentin
halte des Wappenschildes, von der aus eine Neubewertung des Wappens und
der ihm anhangigen Kontexte moglich wird, konzentriert. Vorliegende Arbeit
beabsichtigt dieses Defizit zu beheben und das Wappen auf dem Hintergrund
einer Ornamentgeschichte zu greifen, die ihrerseits im Kontext von Zei
chenordnungen und damit in den Klammern des Kulturbegriffs zu situieren
sein wird. Es wird zu zeigen sein, daB gerade die aktuelle Diskussion des Kul
turbegriffs, die homo gene Kulturkonstruktionen in kritischer Absicht aufkUn
digt und alternierend dazu den Begriff der Interkulturalitat ins Feld fUhrt, das
Thema des Wappens und dessen kulturelle Kontexte von verschiedenen Seiten
beriihrt. Ausgehend von einem heraldischen Ornamentl, das sich nicht nur auf
Wappenschildern prasentiert, sondern dessen Figuren auch den fiktionalen ho
fischen Diskurs durchkreuzen, dessen Gestaltungsmodus sich in der hOfischen
Kleidermode ebenso artikuliert wie im kamevalesken Formenrepertoire, em
pfiehlt es sich, von einer kulturellen Konstruktion auszugehen, die diesen
Duktus des Heterogenen in den rhetorischen Figuren des heraldischen Orna
ments nicht eliminiert. Vor der Folie einer Konstruktion kultureller Hybriditat
dagegen laBt sich ein Wappendiskurs konturieren, dessen Behauptung des <<Ei
genen» in seiner Funktion als personliches Zeichen und des sen Beschworung
von genealogischer Kontinuitat mit dem Duktus und den Techniken seiner Or
namente nicht restlos aufgeht. Neben den Depots hochsten sozialen Prestiges,
die es bildet, scheint es eine Reihe von Widerspriichen auf sich zu haufen: ist
es Zeichen einer Familienstammburg oder Zeichen, das auf abenteuerlichen
Reisen entsteht in der Begegnung mit dem «Fremden», «wilde Semiose» oder
Zeichen hochster WUrde, Zeichen des «In-der-Fremde-Seins» oder ornamen
tale Vorlage fUr das Emblem von Nationalkultur? Die Reihe lieBe sich fortset
zen. Die Herkunft des Zeichens, das selbst zum Zeichen privilegierter Herkunft
und Kontinuitat wird, scheint einigermaBen obskur. Doch als Zeichen von
Herkunft generell artikuliert es eine Botschaft, die nachgerade wartet auf ihre
1 Bei diesem Terminus handelt es sich nicht urn einen feststehenden Ausdruck der fachwissen
schaftlichen Literatur zur Heraldik, die Uberhaupt den ornamenttheoretischen Aspekt des
Wappens bislang vernachliissigte. Die Verwendung dieses Terminus im Gefolge einer Analyse
der ornamentalen Wappeneffekte zielt zugleich auf die Entgrenzung des Wappenbegriffs, der
zwischen dem Ornament- und Schriftbegriff erortert und der zum anderen durch die Ausdeh
nung der Untersuchung auch auf wappeniihnliche Repriisentationen erweitert wird.
7
Entschltisselung innerhalb der zentralen Prlimissen einer interkulturellen Kon
struktion kultureller Identitat.
Der im Speicher des heraldischen Zierats reich entfaltete Fundus an Ornament
figuren tragt alle Kennzeichen der Heterogenitat. Dem direkten Zugriff von
Ordnungskriterien entzieht er sich beharrlich und stellt dabei seine intranspa
rente Zeichengeste aus. Seine heterogene und opake Materialitat behauptet
trotz oder gar aufgrund der ihr aufgetragenen Zeichenfunktion ihre enigmati
sche Qualitat. Die groteske und kamevaleske Exposition des Wappenensem
bles betont die Diskrepanz innerhalb der Korrelationsbeziehung von Zeichen
und Bezeichnetem. Das heraldische Zeichen ist kein Begriff, sondern eine or
namentale Umschreibung des Namens, die weit eher einer Logik der Maske
folgt, denn der der Zeichentransparenz. Es handelt sich hier urn die Evokation
einer grundsatzlichen Ambiguitat, die dem Wappen eigen ist und den die VOf
liegende Arbeit stets aufs neue fokussieren wird. Sie beginnt daher mit dem
Nachweis dieses Widerspruches selbst noch in den gegenwiirtig kursierenden
Wappenmetaphern.
Auf zwei der wichtigsten Ornamentmodalitaten der Wappen, der «verwech
selten Tinktur» und der «heraldischen Skelettierung», rekurrieren diese Meta
phern, die ihrerseits in der Theorie des serniotischen Strukturalismus und der
Diskursanalyse beheimatet sind. Dabei bemachtigten sich diese Theorien vor
allem der bipolaren Funktion des Wappens, seiner zeigenden und verbergenden
Geste, sowie seines Spiels mit dem Verwechseln von Figur und Grund. Diese
Diskurse exponieren die Wappenmetapher an den sensibelsten Punkten der
Diskursordnung selbst. Denn ungeachtet der Zeichenfunktion, die die Wappen
flir ihre Trager haben, inszenieren die heraldischen Zeichenmodalitaten zum
einen die verwirrungsstiftende Gegen-Ordnung als Basis einer jeglichen Ord
nung und zugleich insistieren sie auf der Durchsetzung dieser Ordnung selbst.
Sei es als kulturelles Objekt, als Ornament, als Metapher oder gar als 'Gat
tung', stets indiziert das Wappen dartiber hinaus eine Form der Transgression:
zwischen Schrift und Bild, Schrift und Ornament, Schrift und Korper, zwi
schen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem, zwischen dem Sinn und dem
Anderen der Vernunft. Es thematisiert die medialen Grenzpositionen innerhalb
der Pole von Schreib- und Lesbarkeit. Als Metapher besetzt das Wappen den
Ort der Referenz, des Ursprungs, der Zasur, es besetzt den Platz des Namens
und des Subjekts, es beherrscht den Diskurs der Genealogie und stimuliert die
Proliferation der Kontinuitat tiber seine musealen Dispositionen. Es hat seinen
festen Ort im Feld der Reprasentation und ist tiber Jahrhunderte hinweg favori-
8
siertes und prominentes Symbol im Kampf urn soziales Prestige. Eine nur an
niiherungsweise Prazisierung seines diskursiven Potentials ohne Einbeziehung
einer Analyse des ornamentalen Wappenbildes scheint unm6glich. Die aufge
flihrten und rekonstruierten SchaupHitze dieses Begriffs m6gen einer Illustra
tion dessen Vorschub leisten, was zunlichst als "imaginare Komplizitlit"2 ent
faltet wird. Die Rekonstruktion einer solchen Komplizitlit verhilft zur Ausfal
tung auch der Imponderabilien eines Begriffs und seines Gegenstandes, dem
innerhalb seiner angestammten hilfswissenschaftlichen Disziplin, zu dessen
axiomatischen Grundbegriffen zweifelsohne die Begriffe des Standeszeichens,
der Kontinuitlit, der Tradition und der Reprlisentation zlihlen, bislang eine sehr
einseitige Lesart widerfahren ist.
Die Erweiterung der semiotischen und semantischen Pracht heraldischer Ter
minologie, die Levi-Strauss in seinem Werk «Traurige Tropen» mit der trans
atlantischen Passage dieser Terminologie erzielt, unterbreitet bereits den un
ausgesprochenen Vorschlag, den heraldischen Ornamentmodus als Beschrei
bungsmodus von Ornamenten generell auszutesten. Das von dieser Terminolo
gie in den Tropen der Ethnologie entfaltete Operationsspektrum prlisentiert
sich durch seine Kontextualisierung in rituelle Praktiken weit vielseitiger und
vielschichtiger, als es dessen klimmerliche Existenz innerhalb der hilfswissen
schaftlichen Disziplinen der Geschichtswissenschaften hlitte erahnen lassen.
Die Kunst des Blasonierens enthlilt alle Elemente eines Wappendiskurses, der
gerade in erhellender Weise den Duktus dieser ornamentalen Medialitlit, der
sich im Mittelalter nicht auf die Wappen allein beschrankt, hervorkehrt. Die
Analyse der medialen Aspekte des heraldischen Ornaments erlaubt sodann,
von heraldischen Artikulationen zu sprechen, deren Botschaften alles andere
als einhellig sind. Nicht nur jene Bedeutung, die das Wappen als Zeichen von
Identitlit innerhalb des Repertoires von Standessymbolik transportiert, sondern
auch das, was es als ornamentale Verdeckung und Verhlillung inszeniert im
Unterwegs der Diskurse und der A ventiure wird im folgenden beschrieben.
Dabei wird der Gegenstand in eine zirkulare Bewegung versetzt, die zwischen
den verschiedenen kulturellen Praktiken und sozialen Orten, die sein symboli
sches Kapital prligten, verlliuft. Er wird untersucht zwischen den Bedeutungen,
2 Michel Foucault, Archiiologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1981, S. 11. Mit dem Begriff der
"imaginaren Komplizitiit" kann auch ein Modell kulturhistorischer Analyse erstellt werden.
das weniger die einlinige Beschreibung der fortschreitenden Rationalisierung eines Begriffs
intendiert, sondern verstarkt die "verschiedenen Konstitutions- und Gliltigkeitsfelder. die sei
ner aufeinander folgenden Gebrauchsregeln. der vieifliltigen theoretischen Milieus. in denen
sich seine Herausarbeitung vollzogen und vollendet hat", zum Gegenstand der Analyse erkl3.rt.
9
die ihm iibertragen wurden, und zwischen den Disziplinen, die sich seiner
Teilaspekte bislang angenommen haben. Wobei hervorzuheben ware, daB es
keine Disziplin gibt, in die er zur Ganze gehoren wiirde und dariiber hinaus,
daB es 'das' Wappen nicht gibt. Deswegen solI hier ein Netz von kulturellen
Nachbarschaften, von Affinitaten des Wappens zu Personen, kulturellen Prak
tiken, bestimmten Orten innerhalb einer mittelalterlichen Topographie und zu
Zeichenordnungen, die auf den ersten Blick weniger offensichtlich sind, ge
kniipft werden, urn des sen intermediarem Grenzgangertum auf die Spur zu
kommen. Die Beschreibung einer nicht nur vordergrundigen Komplizenschaft
verortet seinen Gegenstand in einem 'Netz'3 von Spuren, in dem er verwoben
ist, anstatt ihn zu isolieren.
1. 1 Das Wappen auf Reisen
Dem Wappen ist in erstaunlich vielen Diskursen zu begegnen. Ais Gegenstand,
flir den sich hierzulande nur noch Heraldiker und Genealogen interessieren,
scheint der Begriff des Wappens und dessen metaphorisches Potential andem
orts in theoretischen Diskursen zu reiissieren, die einem semiotischen Struktu
ralismus verpflichtet sind und deren Verwendung des Begriffs hochst Unter
schiedliches intendiert. Die fachlichen Disziplinen, die sich jenen - oft auch
nur metaphorischen - Zugriff auf ein verstaubtes Relikt erlaubten, reprasentie
ren gleichfalls verschiedene Theorieansatze, die es vorerst nicht gestatten, ei
nen einheitlichen Gebrauch des Begriffes anzunehmen. In chronologischer
Reihenfolge begegnen wir der 'tropisch' ausformulierten Variante des Begriffs
als erstes. Levi-Strauss bediente sich der terminologischen Vorziige des Be
griffs, die sich offenbar zur Beschreibung der arabesken Gesichtsbemalungen
der Caduveo-Indianerinnen in besonderer Weise eigneten. Dabei zeigt sieh,
daB die heraldische Blasonierung zugleich eine exakte Analyse der Omament
techniken leistet, die den Schreibduktus der Linienflihrung betont. Das Bei
spiel, das mit der Studie «Traurige Tropen» vorliegt, ist frappierend in meh
rerlei Hinsicht: das von der Mittelalterforschung als genuin europaisch be
trachtete Phanomen der heraldischen Tingierung in einer archaischen Kultur
3 Der Begriff des 'Netzes' distanziert sich von Stephen Greenblatts 'Netzwerk' insoweit, als
dieser Begriff auf die Rekonstruktion der elisabethanischen Gesellschaft und die Konstruktion
eines nahezu omniprasenten Machtdiskursesrekurriert. Das von ihm postulierte 'Netzwerk'
operiert unter der Dominanz dieses totalisierenden Machtdiskurses, der auch die Diskurse des
Peripheren affiziert. Ein solch hierarchisierter Vernetzungsgrad kann fUr die Konstruktion
mittelalterlicher Kulturraume nicht in Frage kommen. Siehe "Verhandlungen mit Shakespeare.
Innenansichten der englischen Renaissance", Frankfurt a. M. 1993, S. 10.
10