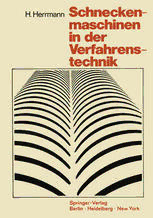Table Of ContentHeinz Herrmann
Schneckenmaschinen
in der
Verfahrenstechnik
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1972
Dipl.-Ing. Heinz Herrmann
Werner u. Pfleiderer
Maschinenfabrik, Stuttgart
Mit 115 Abbildungen
ISBN 978-3-642-51086-1 ISBN 978-3-642-51085-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-51085-4
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der
Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Daten
verarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Bei Ver
vielfältigungen für gewerbliche Zwecke ist gemäß § 54 UrhG eine Vergütung an den Verlag
zu zahlen, deren Höhe mit dem Verlag zu vereinbaren ist
® by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1972
Softcover reprint of the hardcover 1s t edition 1972
Library of Congress Catalog Card Number 72-76763
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen
im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und
daher von jedermann benutzt werden dürften
Vorwort
Schneckenmaschinen werden heute in einer kaum noch zu übersehenden Typen
vielfalt und in tausenden von Exemplaren für die verschiedensten Verfahrens
aufgaben eingesetzt. Im Zuge der Umstellung der diskontinuierlichen auf die
kontinuierliche Arbeitsweise sind sie zu einem wichtigen Hilfsmittel der Ver
fahrenstechnik geworden. Gleichzeitig gab die in den letzten 30 Jahren stürmisch
wachsende Kunststofft echnologie starke Impulse zur Weiterentwicklung der
Schneckenmaschinen.
Während sich ihre Anwendung ursprünglich im wesentlichen auf die Förderung
von Schüttgütern und die Extrusion von Kunststoffen und Kautschuk konzen
trierte, werden Schneckenmaschinen heute ganz allgemein für Stoffvereinigungs-,
Stofft rennungs- und Stoffumwandlungsverfahren verwendet. Ihr Anwendungs
gebiet umfaßt fast die gesamte Verfahrenstechnik der Schüttgüter und der mittel
bis hochviskosen, plastischen und viskoelastischen Materialien.
Während Förderschnecken für Schüttgüter und Schneckenextruder für Kunst
stoffe weitgehend bekannt und in der Fachliteratur ausführlich und zusammen
fassend beschrieben worden sind, liegen Informationen über andere Arten von
Schneckenmaschinen nur vereinzelt in Form von Firmenschriften und Zeit
schriftenaufsätzen vor.
Ziel dieses Buches ist es, eine systematische Ordnung aller Schneckenmaschinen
nach verfahrens technischen Gesichtspunkten vorzunehmen und eine Übersicht
über die zur Zeit zum Stande der Technik gehörenden Dosierschnecken, Schnecken
rnischer, Schneckenkneter, Abpreßschnecken, Schneckenverdampfer und Schnek
kenreaktoren zu geben.
Nach einem Überblick über die Einsatzgebiete und einer verfahrenstechnischen
Klassifikation der Schneckenmaschinen in Kapitel 1 wird die historische Entwick
lung in Kapitel 2 dargestellt. Die heute verwendeten Bauarten sind mit ihren
besonderen Anwendungsgebieten in Kapitel 3 beschrieben. Die technischen
Daten der verschiedenen Maschinentypen sind in Tabellen zusammengefaßt, damit
sich der Praktiker direkt über die auf dem Markt befindlichen Baugrößen in
formieren kann.
Über die Theorie der Schneckenmischer, Schneckenkneter, Abpreßschnecken,
Schneckenverdampfer und Schneckenreaktoren ist bisher nur wenig bekannt.
Dies ist ein Zeichen dafür, daß sich die Hochschulen mit Schneckenmaschinen mit
Ausnahme der Schneckenextruder bisher nur sehr wenig beschäftigt haben.
Soweit allgemein anwendbare theoretische Grundlagen vorhanden sind, wurden
sie am Beginn der einzelnen Abschnitte kurz dargelegt. Am Ende jedes Kapitels
findet der Leser ein Literaturverzeichnis, welches die bisher erschienenen ein
schlägigen Veröffentlichungen einschließlich der Firmenschriften weitgehend
berücksichtigt.
V
Vorwort
Die in diesem Buch gegebene Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständig
keit. Bei ihrer Zusammenstellung war der Verfasser weitgehend auf Informations
material angewiesen, das die einzelnen Firmen zur Verfügung gestellt haben. Der
Verfasser und der Verlag sind deshalb für Ergänzungen, Korrekturen und An
regungen im Hinblick auf eine zweite Auflage dankbar.
Der Verfasser hofft, daß dieses Buch sowohl für den mit Schneckenmaschinen be
faßten Ingenieur und Chemiker als auch für den auf diesem Gebiet tätigen tech
nischen Kaufmann von Nutzen ist. Darüber hinaus soll es dem Studenten der
Verfahrenstechnik und der Chemie den Einblick in ein modernes Gebiet der
chemischen Technologie erleichtern.
Der Verfasser möchte der Geschäftsleitung seiner Firma, und hier insbesondere
Herrn Dr. Günther Fahr, für das in großzügiger Weise gegebene Einverständnis
zu dieser Veröffentlichung herzlich danken. Der Dank des Verfassers gilt ferner
allen den Firmen, die Unterlagen und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.
Darüber hinaus dankt er Herrn Dipl.-Ing. R. Erdmenger, Leverkusen, für wert
volle Hinweise zum historischen Teil.
Stuttgart-Feuerbach, März 1972
H einz Herrmann
VI
Inhalt
Einsatzgebiete und verfahrenstechnische Klassifikation der Schneckenmaschinen
1.1 Einsatzgebiete . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Definition und Erläuterung verschiedener Verfahren 2
1.3 Einteilung der Schneckenmaschinen 4
1.4 Literaturhinweise . . . . . . . . . 8
2 Die Entwicklung der Schneckenmaschinen 9
2.1 Die ersten Schneckenmaschinen in der Verfahrenstechnik . 9
2.2 Schneckenkneter (Schneckenmischer für plastische und viskoelastische Gesamt-
phase) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 Schneckenmischer für flüssige Gesamtphase 23
2.4 Abpreßschnecken 24
2.5 Schneckenverdampfer 27
2.6 Schneckenreaktoren 32
2·7 Literaturhinweise . . 48
3 Bauarten und technische Daten von Schneckenmaschinen 52
3.1 Dosierschnecken ... ........ . 52
3.1.1 Verfahrenstechnische Grundbegriffe. 52
3.1.2 Einwellige Dosierschnecken 56
3.1.3 Einwellige Vibrationsdosierschnecken 58
3.1.4 Zweiwellige Dosierschnecken . . . . 60
3.1. 5 Dosierschnecken mit Wiegesystem 61
3.1.6 Dosierschneck2n für diskontinuierliche Arbeitsweise. 62
3.2 Schnecken misch er für Schüttgüter in fester Gesamtphase 65
3.2.1 Verfahrenstechnische Grundbegriffe ..... 65
3.2.2 Diskontinuierliche Planeten-Schneckenmischer 68
3.2.3 Diskontinuierliche Schneckenbandmischer .. 68
3.2.4 Kontinuierliche Schneckenbandmischer . . . 70
3.2.5 Diskontinuierliche und kontinuierliche Paddelmischer. 71
3.2.6 Diskontinuierliche und kontinuierliche Intensiv-Paddelmischer 73
3.2.7 Kontinuierliche Frenkel-Schneckenmischer . 76
3.3 Schneckenkneter. . . . . . . . . . . . . . . 77
Schneckenmischer für plastische und viskoelastische Gesamtphase
3.3.1 Verfahrenstechnische Grundbegriffe. . . . . 77
3.3.1.1. Zerteilvorgänge in Schneckenknetern 77
3.3.1.2. Verteil vorgänge in Schneckenknetern 80
3.3.1.3. Verweilzeit und Selbstreinigung ... 83
3.3.1.4. \Värmeaustauschvorgänge in Schneckenknetern . 84
3.3.1.5. Durchsatzberechnung .. 86
3.3.2 Plastifikat or. . . . . . . . . . 88
3.3.3 Der Frenkel-Mischer (Transfermix) 91
3.3.4 Der Ko-Kneter. . . . . . . . . 95
VII
Inhalt
3.3.5 Der Planetwalzen-Extruder . . . . . . . 110
3.3.6 Zweiwellenmaschine von Welding Engineers 112
3.3.7 Der Doppelschnecken- Mischer DSM. . . . 114
3.3.8 Der Continuous Mixer FCM . . . . . . . 117
3.3.9 Die zweiwellige Knetscheiben-Schneckenpresse vom Typ ZSK 120
3.3.10 Zweiwellige, zweiseitig beschickte Knetscheiben-Schneckenpresse vom Typ
ZZK. . . . 135
3.4 Schneckenklassierer 139
3.5 Abpreßschnecken . 141
3.5.1 Ein- und zweiwellige Seiherpressen 141
3.5.2 Seiherlose Abpreßschnecken . . . 146
3.6 Schneckenverdampfer für Schüttgüter in fester Gesamtphase 147
3·6.1 Fluidatbett-Holoflite-Schneckenverdampfer 147
3.6.2 Zweischnecken-Durchlüftungstrockner SDT 147
3.7 Schneckenverdampfer für plastische und viskoelastische Gesamtphase 149
3.7.1 Die Zweiwellenmaschine von Welding Engineers . . 149
3.7.2 Die zweiwellige Knetscheiben-Schneckenpresse ZSK 151
3.7.3 Der Vierwellige Schneckenverdampfer VDS-V 154
3.7·4 Holoflite-Schneckenverdampfer. . . . . . 157
3.7·5 Hohlschneckenverdampfer mit Dichtprofil . 159
3.7.6 Entspannungsverdampfer 159
3.8 Schneckenreaktoren . 161
3.8.1 Der Ko-Kneter. 161
3.8.2 Die zweiwellige Knetscheibenschneckenpresse ZSK 163
3.8.3 Zweiwelliger Schneckenreaktor ZDS-R. . 166
3.8.4 Zweiwelliger Schneckenreaktor ZDS-RE . 168
3.9 Literaturhinweise 171
Sachverzeichnis. . . . 177
VIII
1 Einsatzgebiete und verfahrenstechnische
Klassifikation der Schneckenmaschinen
1.1 Einsatzgebiete
Die Schraube oder Schnecke ist ein Maschinenelement, mit dem flüssige, hoch
viskose und feste Stoffe gefördert werden können. Förderschnecken sind bereits
seit Jahrhunderten bekannt. Bereits um 200 v. ehr. wurden schräggestellte Archi
medes-Schrauben in römischen Wasserversorgungsanlagen verwendet, um Wasser
kontinuierlich auf ein höheres geodätisches Niveau zu fördern [1J. Förderschnecken
für Schüttgüter werden im Bergbau, der Landwirtschaft, in der Industrie der
Steine, Erden und Mineralien, der ~ahrungsmittel- und der chemischen Industrie
seit über 100 Jahren eingesetzt. Da sie schon lange zum Stand der Technik ge
hören, ist eine umfangreiche Spezialliteratur vorhanden [2].
Hochviskose, plastische Massen werden seit etwa 100 Jahren mit Schnecken
maschinen extrudiert. Besonders für die Verarbeitung von Kautschuk und thermo
plastischen Kunststoffen wurden Schneckenextruder entwickelt, die den poly
meren Werkstoff durch Wärmezufuhr in den plastischen Zustand überführen und
dann durch Düsen und Spritzköpfe gegen den Widerstand dieser Werkzeuge hin
durchpressen können. Auch über dieses wichtige Anwendungsgebiet der Schnecken
r"
maschinen liegt eine ausführliche Spezialliteratur vor 4, 5]. Für die Förderung
niedrigviskoser Flüssigkeiten wurden zweiwellige, gegenläufige, selbstansaugende
Schraubenpumpen für Gegendrücke bis zu 200 atü entwickelt, die vor allem im
Schiffbau, in der Ölindustrie, in der Ölhydraulik und in Ölfeuerungsanlagen An
wendung finden [6, 71. Auch Gase können mit zweiwelligen, gegenläufigen Schrau
benkompressoren mit Durchsatzmengen bis zu 22000 m3/h bei einem maximalen
Gegendruck von 14 atü gefördert werden 16.
Während des Fördervorganges können durch die Schnecke und das sie umgebende
Sclznec!?engehäuse zusätzliche Kräfte und Wirkungen unterschiedlicher Art auf
das Fördergut ausgeübt werden, die im einzelnen von der konstruktiven Gestal
tung der Schnecke und des Schneckengehäuses und von der Betriebsweise der
Maschine abhängen.
So sind im Laufe der letzten 100 Jahre Schnecken maschinen in immer neuen Ab
wandlungen und mit besonderen konstruktiven Merkmalen für
Stoffvereinigungs-,
Stofftrennungs- oder
Stoffumwandlungsverfahren
entwickelt worden. Das Einsatzgebiet der Schneckenmaschinen ist somit über die
ursprünglichen und allgemein bekannten Anwendungsfälle des Förderns von
1 Hcrrrnann, Schneckenlllaschinen
1 Einsatzgebiete und verfahrenstechnische Klassifikation [Lit. S. 8
Schüttgütern und der Extrusion von Kunststoffen, Kautschuk und plastischen
Massen weit hinausgewachsen und umfaßt heute fast die gesamte Verfahrens
technik der Schüttgüter und der plastischen und viskoelastischen Materialien.
Von besonderer Bedeutung sind dabei Misch- und Homogenisierverfahren, Ab
preß-, Trocknungs- und Verdampfungsvorgänge sowie chemische Reaktionen in
zähplastischer Phase.
Da die kontinuierliche Arbeitsweise für Schneckenmaschinen im allgemeinen charak
teristisch ist, geht ihre Entwicklung in den einzelnen Anwendungsgebieten Hand
in Hand mit der Umstellung von der diskontinuierlichen auf die kontinuierliche
Betriebsweise. In vielen Fällen ist es möglich, auf Schnecken maschinen mehrere
Verfahrensschritte wie z. B. Mischen, Dispergieren und Entgasen gleichzeitig
durchzuführen, so daß durch die Zusammenfassung von Arbeitsgängen wirtschaft
liche Vorteile gegenüber einer mehrstufigen Arbeitsweise erzielt werden können.
In anderen Fällen haben Schneckenmaschinen erst die Voraussetzung für die
direkte Lösung einer Verfahrensaufgabe geschaffen, die sonst nur unter Einschal
tung aufwendiger verfahrenstechnischer Umwege zu bewältigen war. Das gilt
z. B. für die Konzentration von Polymerlösungen, die vor der Entwicklung ge
eigneter Schneckenverdampfer nur über den Umweg der Wasserdampfdestillation
mit den Begleiterscheinungen der Lösungsmittel- und der Feststofftrocknung
durchgeführt werden konnte.
Nach dem heutigen Stand der Technik läßt sich das gesamte Einsatzgebiet der
Schneckenmaschinen in sechs Verfahrensgruppen einteilen:
A. Fördern und Dosieren
B. Extrudieren
C. Stoffvereinigungsverfahren
D. Stofftrennungsverfahren
E. Stoffumwandlungsverfahren
F. Wärmeaustauschverfahren.
Innerhalb dieser Gruppen werden z. Z. insgesamt mindestens 28 Einzelverfahren
unterschieden, die in Tabelle 1 zusammengestellt sind. Die meisten dieser Einzel
verfahren sind von der allgemeinen Verfahrenstechnik und der Chemie her be
ka,nnt. Einige Verfahren werden jedoch im Sprachgebrauch unterschiedlich inter
pretiert oder sind Eigentümlichkeiten bestimmter Anwendungsgebiete, so daß
sie erläutert und definiert werden müssen.
1.2 Definition und Erläuterung verschiedener Verfahren
Das Mischen bezweckt die Aneinanderlagerung verschiedener Stoffe zu einem
Gemenge, dessen Raumelemente eine gleichartige Zusammensetzung aufweisen.
Durch ständigen Platzwechsel sollen die Teilchen eines Stoffes abwechselnd
zwischen die Teilchen eines anderen Stoffes gebracht werden, wobei sich der
Sollwert der Konzentration mit fortschreitender Mischung in zunehmend kleineren
Volumina einstellt. Es findet also ein reiner Verteilungsvorgang statt. Das Mischen
von plastischen und viskoelastischen Stoffen ist stets mit Knetvorgängen verbun-
2
Lit. S. 8J 1.1 Definition und Erläuterung verschiedener Verfahren
den, da in diesem Fall eine Durchmischung nur unter Aufwendung von Scher-und
Druckkräften möglich ist.
Vom Dispergieren spricht man dann, wenn als eine Mischungskomponente ein
Feststoff in Agglomeratform vorliegt. Der Vorgang um faßt das Auseinander
brechen dieser Agglomerate möglichst auf Primärteilchengröße, die Benetzung
der Primärteilchen mit der flüssigen oder plastischen zweiten Mischungskompo
nente und die gleichmäßige Verteilung der benetzten Primärteilchen in der flüssi
gen oder plastischen Gesamtphase. Zum Verteilvorgang des Mischens kommt also
noch ein Zerteil- und ein Benetzungsprozeß hinzu. Bei der Zerteilung müssen die
Bindekräfte der Agglomerate durch Scherkräfte überwunden werden. Ein typi
sches Beispiel für einen Dispergierprozeß ist die Einfärbung von Kunststoff
schmelzen mit nicht zubereiteten Pigmenten.
Unter Homogenisieren versteht man Mischvorgänge, bei denen Teilchengrößen
von 1 f.I. und weniger vorkommen. Ferner ist damit ganz allgemein die Herstellung
eines gleichartig beschaffenen Stoffes gemeint, der z. B. überall die gleiche Tempe
ratur oder eine andere gleiche Eigenschaft besitzt. Darüber hinaus kennt man in
der Kunststofftechnologie besondere Homogenisierungsverfahren im molekularen
und kristallinen Bereich, die als "Zerstören von Fischaugen" und als "Refinern"
bezeichnet werden.
Fischaugen oder Stippen sind einzelne, schwierig oder unter üblichen Bedingungen
nicht verarbeitbare Teilchen eines sonst homogenen Polymers, die zu Fehlstellen
im Endprodukt führen. Sie sind im allgemeinen vernetzte, durch Sauerstoff
brücken verknüpfte Molekülgruppen, die insbesondere bei Polyäthylen und Poly
propylen auftreten. Diese vernetzten Partikel können eine Größe annehmen, die
bis in den makroskopischen Bereich hineinreicht. Bei PVC-Weich oder bei weich
gemachtem Celluloseacetat bestehen Fischaugen meist aus weichmacherarmen,
verhornten Stellen. Unter dem Zerstören ,'on Fischaugen versteht man nun die
Auflösung dieser Partikel durch Scherkräfte.
Das Rejinern von Thermoplasten erfolgt ebenfalls durch intensive Knetung in
plastischer Phase. Es wird insbesondere bei Hochdruck-Polyäthylen durchgeführt.
Dabei handelt es sich um einen in seinen phvsikalischen Zusammenhängen noch
nicht eindeutig geklärten Homogenisiervorgang im molekularen und kristallinen
Bereich, der bessere optische Eigenschaften, d. h. bessere Glanz- und Trübungs
werte einer aus diesem Material hergestellten Folie zur Folge hat.
Gelieren bedeutet die Bildung eines Gels. Man versteht hierunter ein leicht defor
mierbares, mehr oder weniger flüssigkeitsreiches, disperses System, das zumeist
aus einem festen, kolloidal verteilten Stoff und einer Flüssigkeit besteht. Eine Ge
lierung tritt z. B. ein, wenn bestimmte Weichmacher in PVC-Partikel eindringen
und diese zur Quellung bringen.
Während beim Gelieren ein Mischungszustand im kolloidaldispersen Bereich er
reicht wird, führt das Lösen zu einer im molekularen Bereich homogenen Zu
sammensetzung der Mischung.
Unter Ansintern versteht man die Erhitzung feinkörniger und pulvriger Stoffe bis
nahe an ihren Schmelzpunkt, so daß sie an ihrer Oberfläche teigig bis flüssig
werden und daher miteinander zu größeren Agglomeraten oder einer zusammen
hängenden Masse verkleben, ohne daß sie vollständig in den Schmelzezustand über
gehen.
1 * 3