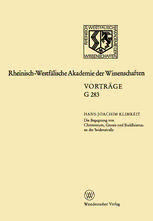Table Of ContentRheinisch-Westfalische Akademie der Wissenschaften
Geisteswissenschaften Vortrage . G 283
Herausgegeben von der
Rheinisch-WestfaIischen Akademie der Wissenschaften
HANS-JOACHIM KLIMKEIT
Die Begegnung von Christentum, Gnosis und Buddhismus
an der SeidenstraBe
Westdeutscher Verlag
304. Sitzung am 16. Juli 1986 in Dusseldorf
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Klirnkcit, Han&-Joachim
Die Begegnung von Christentum, Gnosis und Buddhismus an der Seidenstra/lel
Hans-Joachim Klimkeit_ -Opladen: Westdeutscher Verlag. 1986_
(V ortrige I Rheinisch-WestfaJische Akademie der Wissenschahen: Geisteswissen
schahen; G 283)
ISBN-13: 978-3-53\-07283-8 ..I SBN-13: 978-3-322-852984
DOl: 10_007/978-3-322-852_
NE: Rheinisch-WestfaJische Akademie der Wissenschahen (DUsseldorf): Vortriige I
Geisteswissenschahen
© 1986 by Westdeutscher Verlag GmbH Opladen
Herstellung: Westdeutscher Verlag
Satz, Druck und buchbinderische Verarbeitung: Boss-Druck, Kleve
Inhalt
1. Einleitung ..................................................... 7
2. Die Begegnung von Christentum und Buddhismus .................. 8
a) Die Ausbreitung des Buddhismus in Zentralasien ................. 8
b) Die Ausbreitung des Christentums nach Osten ................... 11
c) Dokumente zur Begegnung von Christentum und Buddhismus in
Zentralasien ................................................ 15
d) Das Verhaltnis des Buddhismus zum Christentum ................ 20
3. Die Begegnung von Gnosis und Buddhismus an der SeidenstraBe ...... 23
a) Buddhistische Ubernahmen im Manichaismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
b) Manichaische Ubernahmen im Buddhismus ...................... 44
4. Ausblick ...................................................... 51
Abkiirzungen .................................................... 53
1. Einleitung
Das Land der SeidenstraBe, das groBe Steppen-und Wiistengebiet nordlich der
tibetischen Hochebene, das sich yom westlichen China iiber Ostturkestan und
Westturkestan bis hin zum Rande der iranischen Hochebene erstreckt, ist mit
seinen transkontinentalen Verbindungswegen von jeher ein Gebiet der Begegnung
von Volkern, Kulturen und Religionen gewesen. Dienten die Handelswege, die
China iiber das heutige Afghanistan mit Indien, femer mit Persien, Syrien, Agyp
ten und sogar Rom verbanden, in erster Linie dem Warenaustausch, so vermittel
ten sie dariiber hinaus auch geistige und religiose Inhalte von einem Yolk zum
anderen. So trafen hier die groBen Religionen des Orients, u. a. das nestorianische
Christentum, der gnostische Manichaismus und der Buddhismus des "Kleinen"
und "GroBen Fahrzeugs", in der Zeit zwischen dem 3.14. und dem 13.114. Jh. auf
einander. Ihre Trager lebten nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander;
sie traten in eine lebendige Begegnung ein, so unterschiedlich deren Tiefe jeweils
gewesen sem mag.
DaB die Begegnung, sofem sie tatsachlich zu einem Ort des Gespraches wird,
grundsatzlich AnlaB zu einer Neubesinnung auf die eigene Lebenswahrheit geben
kann, hat die Lebensphilosophie erkannt. Der Sachverhalt ist jiingst in aller Schade
von O.F. Bollnow herausgearbeitet worden.! Wir werden uns also die Frage vor
legen miissen, inwiefern die miteinander lebenden Vertreter der drei Religionen
sich einem solchen Gesprach offneten und inwiefern sie sich auf dogmatisch festge
legte Positionen zUrUckzogen. Vor allem aber werden wir im AnschluB an Hans
Jonas' tiefschiirfende Gnosisdeutung2 zu fragen haben, welche fundamentalen
Daseinshaltungen diese Religionen jeweils vermittelten und wie diese in der Begeg-
Fiir diverse Hinweise bei der Erarbeitung dieses Materials bin ich mehreren Kollegen und Freunden
dankbarverbunden, insbesondere Dr. Helmut Eimer (Bonn), Prof;Dr. Annemarie von Gabain (Anger),
Dr.Jens Peter Laut (Marburg) und Dr. Werner Sundermann (Berlin). Mein Dank gilt auch der Klop
stock-Stiftung, die einen Beitrag zur Beschaffung der notigen Literatur leistete.
1 o. F. Bollnow, Das Doppelgesicht tier Wahrheit. Stuttgart 1975,32££.,41££.
2 H.Jonas, Gnosis und spatantiker Geist. I: Die mythologische Gnosis. 3. Aufl. GOttingen 1964.
8 Hans-Joachim Klimkeit
nung eine neue Akzentuierung erhieIten_ Es geht letztlich also urn mehr als nur urn
auBere Einfiusse, die philologisch registriert werden konnen, auch wenn diese die
Ausgangspunkte unserer Untersuchung sein mussen_
Wir werden sehen, daB das Christentum sich erst im Laufe der Entwicklung auf
die religiose Sprache der U mwelt einlieB. Seine Bewertung weltlichen Daseins
hatte zunachst eine andere Ausrichtung als die der Buddhisten, die grundsatzlich
yom leidhaften Charakter der WeIt sprachen. Diesem buddhistischen Ausgangs
punkt kam das manichaische Daseinsverstandnis schon nahe, so daB zwischen der
gnostischen und der buddhistischen GeistesweIt die engsten Beriihrungen zu
erwarten sind. Aber der Mahayana-Buddhismus konnte von der Durchdringung
von Transzendenz und Immanenz sprechen und so einem gelauterten Sein in der
Welt eine neue Bedeutung verleihen. Der Manichaismus hat ihm auf diesem Wege
z. T. folgen konnen. Das syrische Christentum hat schlieBlich trotz seines Festhal
tens an der Idee der Auferstehung und der damit gegebenen Hochschatzung der
Korperlichkeit und Weltlichkeit auf seinem Weg nach Osten zunehmend seine
asketisch-monastischen Zuge zur GeItung gebracht. Dieser Ruckzug aus der WeIt
ist sicherlich eine Voraussetzung seines U ntergangs nach der Mongolenzeit ge
wesen.
2. Die Begegnung von Christentum und Buddhismus
a) Die Ausbreitung des Buddhismus in Zentralasien
Die Geschichte der Ausbreitung des Buddhismus yom Ganges-Land uber das
heutige Afghanistan, Westturkestan und das Tarim-Becken bis ins Reich der Mitte
konnen wir hier nicht in ihren Einzelheiten skizzieren.3 Es sei nur darauf hinge
wiesen, daB durch die yom indischen Kaiser Asoka (269-223 v. Chr.) geforderte
Missionstatigkeit die buddhistische Lehre einen festen Platz im nordwestlichen
Indien, besonders in Gandhara und Swat, gewann und daB diese Hochburg schon
in vorchristlicher Zeit zum Ausgangspunkt einer Zentralasien-Mission wurde.
Dabei bediente man sich fUr literarische Zwecke der Sprache der Landschaft
Gandhara, die aber zunehmend durch das Sanskrit erganzt und im 7. lh. n. Chr.
vollig verdrangt wurde.4 Ob auch schon die Oase Khotan von den Sendboten
3 Zur Ausbreitung des Buddhismus nach und in Zentralasien: B. A. Litvinsky, Outline History of
Buddhism in Central Asia. Moscow 1968; Fr. Bernhard, DGandhari and the Buddhist Mission in
Central Asia", in: Afijali. Papers on Indology and Buddhism. Peredeniya 1970, 55-62; A. von Gabain,
"ner Buddhismus in Zentralasien", in: HO, 1. Abt., 8. Bd., 2. Abschnitt. Leiden-Koln 1961, 496-514.
4 0. von Hiniiber, DBuddhistische Kultur in Zentralasien und Afghanistan", in: H. Bechert und
R. Gombrich (Hrsg.), Die Welt des Buddhismus. Miinchen 1984, (99-107), 103f.
Christentum, Gnosis und Buddhismus 9
Asokas erfaBt wurde, wie es die Tradition berichtet, miissen wir offenlassen. J eden
falls scheint der Buddhismus schon in vorchristlicher Zeit in diese Oase am Siid
rand des Tarim-Beckens gekommen zu sein.s
Es waren keineswegs nur Mahayana-Buddhisten, die den Weg nach Zentralasien
fanden. Auch Anhanger des "Kleinen Fahrzeugs" waren an verschiedenen Orten
der SeidenstraBe vertreten, wie textliche Funde bezeugen und wie wir aus den
Berichten chinesischer Pilger wissen.6
Die iranischen Volker haben sich nicht in dem MaBe fUr die buddhistische Lehre
gewinnen lassen wie die Zentralasiaten oder die Chinesen; dabei bilden freilich die
Khotan·Sa/een, die Sogdierund die Baktrier eine Ausnahme.7 Schon das Baktrien der
griechischen Zeit kam mit dem Buddhismus in Beriihrung, und bekanntlich war es
vornehmlich der Kushan-Herrscher Kanishka, der dem Buddhismus zur Ausbrei
tung in seinem Reich, das sich weit iiber Baktrien hinaus erstreckte, verhalf.8
Auch eine buddhistische Mission unter Parthern, vornehmlich unter jenen, die
nordlich der iranischen Hochebene lebten, ist belegt. Davon zeugen nicht zuletzt
die buddhistischen Termini in den parthischen Manichaica.9 Eine parthisch
buddhistische Literatur ist zwar nicht bekannt, eine solche konnte es aber gegeben
haben, wie ein stark buddhisiertes manichaisches Fragment aus dem indisch
iranischen Grenzland nahelegt.!O In diesem Zusammenhang muB auch An Shi-Kao
erwahnt werden, der parthische Prinz aus Buchara, der im Jahre 148 n. Chr. zum
Zweck der buddhistischen Mission nach China gelangte, dessen Reise aber auch auf
dem Hintergrund der diplomatischen Beziehungen zwischen Parthern und Chine
sen zu sehen ist.!! Vor allem die ostiranischen Sogdier, deren Stammgebiet um
Samarkand und Buchara lag, die aber iiber bedeutsame Kolonien bis hin nach
China und in die Mongolei verfiigten, waren entscheidend daran beteiligt, den
Buddhismus - wie auch das Christentum und den Manichaismus - nach Zentral-
S G. Gropp, Archaologische Funde am Khotan, Chinesisch-Ostturkestan. Bremen 1974, 29ff.; R.E. Emme
rick; "Buddhism among Iranian peoples", in: Cambridge History of Iran 3/2. Cambridge 1983,
(949-964), 951£.
6 von Hiniiber, aaO, 104.
7 Emmerick, aaO, 954ff. S. auch R. E. Emmerick, "Iranian Settlements to the East of the Pamirs", in:
Cambridge History ofI ran 3/1. Cambridge 1983,263-275.
8 J.H. Rosenfield, The Dynastic Arts oft he Kushans. Berkeley-Los Angeles 1967, 27ff.; B. Stawiski, Mittel·
asien. Kunst der Kuschan. Leipzig 1979, 106ff.
11 S. dazu J. P. Asmussen, X!'astviini[t. Studies in Manichaeism. Copenhagen 1965, 136; W. Sundermann,
"Die Bedeutung des Parthischen fur die Verbreitung buddhistischer Warter indischer Herkunft", in:
AoF9 (1982), 99-113; N. Sims-Williams, "Indian Elements in Parthian and Sogdian", in: K. Rahrborn
und W. Veenker (Hrsg.), Sprachen des Buddhismus in Zentralasien. Wiesbaden 1983, 132-141.
10 W.B. Henning, "Two Manichaean Magical Texts", in: BSOAS 12 (1947), 47ff.
11 Zu An Shi-Kao s. Asmussen, X!'astviinift, 136,217; K. Ch'en, Buddhism in China. Princeton, N.J.
1973, 43 f.; E. ZUrcher, The Buddhist Conquest ofC hina. Leiden 1972, Index, 448.
10 Hans-Joachim Klimkeit
asien zu vermitteln.12 Sogdische Gelehrte haben schon im 2. und 3. Jh. n. Chr. an
der Dbersetzung indischer buddhistischer Texte ins Chinesische mitgewirkt.13
Von der friihen sogdisch-buddhistischen Literatur ist uns allerdings nichts erhalten
geblieben. Die meisten buddhistischen Sogdica sind Dbersetzungen aus dem Chi
nesischen der T'a ng-Zeit. Wiederum ist es die manichaisch-sogdische Literatur, die
starke buddhistische Einfliisse aufweist.14
An den beiden Routen der SeidenstraBe, die um das Tarim-Becken herumfiihr
ten, waren schon in den ersten Jahrhunderten n. Chr. neben Chinesen auch Inder
ansassig, wie schriftliche und kiinstlerische Zeugnisse zeigen. Polyglotte Inder
waren in Zentren der NordstraBe wie in Ku~a beheimatet, und einige von ihnen,
wie z. B. Kumarajiva (gest. 415), sollten eine entscheidende Rolle bei der Uber
setzung indisch-buddhistischer T exte ins Chinesische spielen.lS
Zu den weiteren Volkern, die sich in Zentralasien dem Buddhismus zuwandten,
gehoren die Tocharer, ein Volk groBgewachsener, europid aussehender Menschen
indogermanischer Zunge, das vor allem in den Oasen Ku~a und Kar~ahr ansassig
war, wo sich der westliche und der ostliche Dialekt (Tocharisch B und A) als
Schriftsprachen entwickelten.16
Von den Tocharern und Sogdiern ebenso wie von den Indern und zunehmend
auch von den Chinesen beeinfluBt ist der Buddhismus der Turkv61ker, unter denen
die Uiguren eine fiihrende kulturelle Rolle einnahmen.17 N ach Zerschlagung ihres
groBen Steppenimperiums durch die Kirgisen 840 und nach Auseinandersetzungen
mit den nach Norden vordringenden Tibetern setzten sie sich u. a. in der Turfan
Oase fest. Die Tiirken verbreiteten sich in den folgenden J ahrhunderten zuneh
mend nach Siiden und Westen, um schlieBlich auch »W estturkestan" sprachlich
und ethnisch zu turkisieren. Der Buddhismus der zentralasiatischen Tiirken wird
yom 9. Jh. an zunehmend von chinesischen Gedanken und Formen bestimmt, wie
die Masse der aus dem Chinesischen iibersetzten buddhistischen Uigurica zeigt.
Die friihesten T exte dagegen weisen zahlreiche sogdische, dann auch tocharische
Entlehnungen auf.18
12 L. Bazin, "Turcs et Sogdiens", in: Melanges linguistiques offerts a Emile Benveniste. Louvain 1975,
37-45; J. P. Laut, Der /TUbe turkiscbe Buddhismus und seine literarischen Denkmaler. Wiesbaden
1986, Iff.
13 Ch'e n, aaO, 44; A. von Gabain, "Buddhistische Tiirkenmission", in: Asiatica. (Festschrift Fr. Weller).
Leipzig 1954, 164f.
14 Sims-Williams, "Indian Elements", 136ff.
15 Ch'en, aaO, 81ff.
16 Zur tocharisch-buddhistischen Literatur s. W. Thomas, "Die tocharische Literatur", in: W. von Ein
siedel (Hrsg.), Die Literaturen der Welt in ihrer mundlichen und schriftlichen Oberlieferung. Ziirich
1965,967-973; zur buddhistischen Kunst der Tocharer E. Waldschmidt, Gandhara, Kutscha, Turfan.
Leipzig 1925.
17 Laut, aaO, Iff.; von Gabain, "Buddhistische Tiirkenmission", 168ff.
18 Laut, aaO, 116ff.