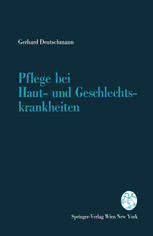Table Of ContentG rhard Deutschmann
Pfleo·e lei
b
l-
all llll(1 (; ~sel Il~ellls-
i
l(rallJ(ll( l(~ll
pringer-\erlag Wien New York
Opfl. Gerhard Deutschmann
Univ.-Klinik fUr Dermatologie und Venerologie,
Landeskrankenhaus Innsbruck, Osterreich
Gedruckt mit Unterstiitzung von
Hypobank Innsbruck, Fa. Mediscus, Fa. M6lnlycke
Das Werk ist urheberrechtlich geschUtzt.
Die dadurch begrUndeten Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des
Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wieder
gabe auf photomechanischem oder ahnliehem Wege und der Speieherung in
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, aueh bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten.
© 1994 Springer- Verlag/Wien
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeiehnungen
usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeiehnung nieht zu
der Annahme, daB solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Marken
sehutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann
benutzt werden dUrfen.
Produkthaftung: FUr Angaben Uber Dosierungsanweisungen und Applika
tionsformen kann vom Verlag keine Gewiihr tibemommen werden. Derartige
Angaben mUssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer
Literaturstellen auf ihre Riehtigkeit Uberpriift werden.
Datenkonvertierung: Zehetner Ges.m.b.H., A-2105 Oberrohrbaeh
Gedruekt auf saurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier - TCF
Mit 11 Abbildungen
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Deutschmann, Gerhard:
Pflege bei Haut-und Geschlechtskrankheiten / Gerhard
Deutschmann. -Wien ; New York: Springer, 1994
ISBN-13:978-3-211-82491-7
ISBN-13:978-3-211-82491-7 e-ISBN-13 :978-3-7091-9308-2
DOl: 10.1007/978-3-7091-9308-2
Vorwort
Dieses vorliegende Buch gibt einen Uberlick tiber die derrnatologisch
pflegerischen Tatigkeiten fUr das Pflegepersonal. Mit Hilfe einer Ar
beitsgruppe von Dipl.-Schwestem und SaniUitshilfsdienste - wofUr ich
mich fUr die Zusammenarbeit herzlich bedanke - habe ich dieses Buch
zusammengesteHt.
Mein Anliegen und Ziel war stets: aktive Arbeit im Pflegebereich
zu leisten, das heiBt: Verbesserung der Verbandstechniken, individuel
ler Einsatz verschiedener Verbandsstoffe, sowie durch neue Erkennt
nisse die klassischen Behandlungsmethoden und die derrnatologische
Pflege auf dem neuesten Stand zu halten.
Dieses Buch ist also eine Bestandsaufnahme unseres Aufgabenbe
reiches, andererseits soH es Schwestem, Pflegem und Schtilem derrna
tologische Pflege naherbringen.
Besonders zu erwahnen ware das Kapitel Dekubitusprophylaxe und
Therapie, das aus eigenen Erfahrungswerten der Klinik resultiert und
bereits seit Jahren erfolgreiche Methoden beinhaltet, die sich auch zur
vollsten Zufriedenheit etabliert haben.
Ein besonderer Dank gilt der Abt. Sr. Andrea Steinacher und dem
Leiter der Station 5 (AIDS-Station), Herm Doz. Dr. Robert Zangerle,
die das Kapitel "Aids" verfaBt und zur Verftigung gestellt haben.
Bedanken mochte ich mich auch bei Herm Prof. Fritsch fUr die
Untersttitzung sowie bei Frau Dr. Unterkircher fUr die Durchsicht und
Beratung. Nicht zu verges sen, ein herzliches Danke den beiden Sekre
tarinnen Frau Angelika Hansel und Frau Gabi Pranger fUr die mtihe
volle Schreibarbeit.
Innsbruck, Ende 1993 Gerhard Deutschmann
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ................................................ .
1. Grundlagen der derrnatologischen Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. LokaItherapeutika ....................................... 4
2.1 Zubereitung von LokaItherapeutika ...................... 4
2.2 Arten ... .. . . .. . .. . .... . ... .. . . . . . . . . . .. . ... . ... . ... 5
2.2.1 Losungen, Tinkturen, Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2.2 Cremen ....................................... 5
2.2.3 Salben ........................................ 5
2.2.4 Schtittelmixtur ................................. 5
2.2.5 Paste ......................................... 6
2.2.6 Puder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Wirkstoffe in LokaItherapeutika ........................ 6
2.4 Was ist bei der Anwendung von Lokaltherapeutika zu
beachten? .......................................... 7
3. Methoden zur Entfernung von Krankheitsauflagerungen ......... 9
3.1 Reinigungsbiider (Voll-oder Teilbiider) .................. 9
3.2 Ole ............................................... 9
3.3 Salben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
4. AuBerliche Behandlung von Hauterkrankungen ............... . 12
4.1 Losungen ......................................... . 12
4.1.1 Borwasser .................................... . 12
4.1.2 KochsalzlOsungen (NaCI) ........................ . 13
4.1.3 Wasserstoffperoxyd (HP2) ...................... . 13
4.1.4 Antiseptika (Desinfizientia) ...................... . 13
4.1.5 Tinkturen .................................... . 14
4.1.6 Ole ......................................... . 14
4.2 Cremen (Emulsionen, Lotionen) ........................ 15
4.3 Salben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
4.3.1 Salbenverbiinde ................................ . 17
VIII Inhaltsverzeichnis
4.3.1.1 Fingerverband ............... . . . . . . . . . . .. 17
4.3.1.2 FuBverband ............................. 18
4.4 Schiittelmixtur (Trockenpinselung) ...................... 18
4.5 Puder.............................................. 19
4.6 Paste .............................................. 19
5. Der Okklusivverband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
5.1 Grundregeln des Okklusivverbandes ..................... 21
5.1.1 Liegedauer des Okklusivverbandes ................. 21
5.1.2 Altersgruppen .................................. 21
5.l.3 Reinigungsbad ................................. 21
5.1.4 Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
5.1.5 Wickeltechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
5.l.6 Hautfalten ..................................... 22
5.1.7 Okklusivverband bei Einzelherden . .. . .. . .. . . ... . . .. 22
6. Abreinigen bzw. Entfemen von Extema ...................... 24
7. Der Kompressionsverband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25
7.1 Fixierter, nicht nachgebender Verband ................... 26
7.2 Fixierter, elastischer Verband - Kurzzugklebebinde ......... 32
7.3 Nicht fixierter, elastischer Verband ...................... 36
7.4 Kompressionsstriimpfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
8. Dekubitus: Prophylaxe und Therapie ........................ 38
8.1 Schwerpunkt-Prophylaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40
8.1.1 Lagerungswechsel .............................. 40
8.l.2 Lagerungsbehelfe ............................... 42
8.1.2.1 Schaumstoffmatratzen..................... 42
8.1.2.2 Gelkissen............................... 42
8.1.2.3 Sitzkissen (ROHO®) ...................... 44
8.1.2.4 Fersenrollen............................. 44
8.1.2.5 Schaffelle .............................. 46
8.1.2.6 Lokale Druckentlastung ................... 46
8.1.3 Spezialbetten. Wechseldruckmatratzen, Luftkissenbetten,
Sandbetten .................................... 48
8.1.4 Hautpflege ................................ 49
8.2 Therapie eines Dekubitus .............................. 50
9. Folienverband .......................................... 53
9.1 Handhabung des Folienverbandes ....................... 54
9.1.1 Verbandstechnik ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55
9.1.2 Entfemen des Folienverbandes . . . ...... . . . . . ... . ... 58
Inhaltsverzeichnis IX
10. Was ein(e) dennatologische(r) Schwester/Pfleger wissen soU! 60
10.1 Thennische Schaden ................................. 60
10.2 Chemische Schaden ................................. 61
10.3 Insektenstiche ...................................... 61
10.4 Zeckenbisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61
10.5 Anaphylaktischer Schock - Typ-I-Reaktion . . . . . . . . . . . . . .. 62
11. Verbrennung und Brandverletzung .......................... 64
11.1 Verbrennung ....................................... 64
11.2 Brandverletzung .................................... 65
12. Dennatologische Untersuchungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
12.1 Mikroskopische Untersuchungen ....................... 68
12.2 Auflichtmikroskop .................................. 69
12.3 Woodlicht ......................................... 69
12.4 Doppler-UltraschaUgerat (Pocket) ...................... 70
12.5 Proktoskopie ....................................... 70
12.6 Plethysmographie ................................... 71
13. Dennatochirurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
13.1 Exzision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72
13.2 Hautstanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
13.3 Elektrokaustik, Koagulation ........................... 73
13.4 Hautfrase (Abrasion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74
13.5 Exkochleation (Curettage) ............................ 74
14. Physikalische Hauttherapien ............................... 75
14.1 Infrarotbestrahlung .................................. 75
14.2 Ultraviolettbestrahlung ............................... 75
14.3 Rontgenbestrahlung - nur mehr bei spezieUer Indikation .... 76
14.4 Kryotherapie ....................................... 77
14.5 Dennojet .......................................... 77
14.6 Ulrichstempel ...................................... 78
14.7 Laser ............................................. 78
14.8 Medizinische Bader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
15. AUergologische Testmethoden ............................. 81
15.1 Pricktest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
15.2 Intracutan-Test (Durchftihrung nur bei negativem Prick) . . . .. 82
15.3 Reibetest .......................................... 82
15.4 Provokationstest .................................... 82
15.5 Expositionstest ..................................... 82
15.6 Epicutan-Test ...................................... 83
15.7 Photopatch-Test .................................... 83
x Inhaltsverzeichnis
15.S Kalte-Warme-Druck-Test ............................ S3
15.9 Immunblock ...................................... S4
15.10 Allergologische Bluttests (in vitro) ..... . . . . . . . . . . . . . . .. S4
16. Geschlechtskrankheiten (Venerische Erkrankungen) ............ S5
17. Psychische Betreuung des hautkranken Patienten .. . . . . . . . . . . . .. SS
17.1 Fallbeispiel ........................................ S9
IS. AIDS (Andrea Steinacher, Robert Zangerle) .................. 91
IS.1 Epidemiologie und Hygiene ........................... 92
IS.1.1 Ubertragung der HIV-Infektion . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
IS.l.1.1 Sexualverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
IS.I.1.2 Blut zu Blut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92
IS.l.l.3 Ubertragung von der Mutter auf das Kind... 92
IS.l.2 Keine Ubertragung der HIV -Infektion ............. 92
IS.l.3 Schutz vor Infektion mit HIV .................... 93
IS.l.3.1 Allgemeines - "Universelle Vorsicht" ...... 93
IS.l.3.2 SchutzmaBnahmen ..................... 93
IS.l.3.3 Verhalten bei Zwischenfallen . . . . . . . . . . . .. 94
IS.I.4 Unterbringung von Patienten mit AIDS ............ 95
IS.1.5 Sonstige hygienische Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . .. 95
IS.l.5.1 Abfalle .............................. 95
IS.l.5.2 Instrumente/Gerate ..................... 96
IS.l.5.3 Betten/Matratzen ...................... 96
IS.l.5.4 Wasche .............................. 96
IS.l.5.5 Geschirr ............................. 96
IS.2 Klinischer Verlauf der HIV-Infektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
IS.2.1 Die akute HIV -Infektion - der HIV -Test ........... 96
IS.2.2 Klassifikation der HIV-Infektion ................. 9S
IS.2.3 Opportunistische Infektionen .................... 99
IS.2.4 Infektionen der Lunge .......................... 100
IS.2.5 Infektionen des Verdauungstraktes ................ 101
IS.2.6 Infektionen des zentralen Nervensystems ........... 102
IS.2.7 Andere Infektionen ............................ 103
IS.2.7.1 Komplikationen durch das Zytomega1ievirus . 103
IS.2.7.2 Mykobakteriosen ...................... 103
IS.2.S Neurologische Erkrankungen .................... 103
IS.2.9 Dermato1ogische Erkrankungen .................. 104
IS.2.1O Bosartige Tumoren ........................... 105
IS.2.1O.l Kaposi-Sarkom ...................... 105
IS.2.1O.2 Lymphome ......................... 105
IS.2.1O.3 Zervixkarzinom ..................... 105
IS.3 AIDS in der Krankenpflege ........................... 106
Inhaltsverzeichnis XI
18.3.1 Allgemeines .................................. 106
18.3.1.1 Psychosozia1e Lage HIV-Infizierter ........ 106
18.3.1.2 Verlust an Autonomie ................... 107
18.3.1.3 Sterben und Tod ....................... 109
18.3.2 Spezifische Pflegeprobleme ..................... 109
18.3.2.1 Nervositat, Arger, Depression und/oder Furcht 109
18.3.2.2 Verletzungen durch Stiirze ............... 110
18.3.2.3 Anorexie, Ubelkeit/Erbrechen, Durchfall .... 110
18.3.2.4 Atemschwierigkeiten ................... 111
18.3.2.5 Miidigkeit und Mattigkeit ................ 111
18.3.2.6 Hautveranderungen ..................... 111
18.3.2.7 Schmerzen ........................... 111
18.3.2.8 Fieber ............................... 111
18.3.2.9 Dekubitusprophylaxe ................... 112
18.3.3 Mikrobiologisches Monitoring ................... 112
18.3.3.1 Blutkulturen .......................... 112
18.3.3.2 Sputum .............................. 113
18.3.3.3 Stuhlkulturen ......................... 113
18.3.3.4 Kulturen von Kathetermaterial ............ 113
18.3.3.5 Nosokomiale Infektionen ("Hospitalismus") . 114
18.3.4 Psychosoziale Auswirkungen von AIDS auf das
Pflegepersonal ................................ 114
18.3.4.1 Angst vor Infektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114
18.3.4.2 Umgang mit Minderheiten ............... 114
18.3.4.3 Identifikation ......................... 115
18.3.4.4 Ausblick ............................. 115
Literaturverzeichnis ......................................... 116
Sachverzeichnis ............................................ 117
Einleitung
Urn ganzheitliche, individuelle Pflege berntiht sich der Pflegeberuf
schon seit vielen Jahren. Dabei geht es urn die Erfassung von physi
schen und psychischen Bedtirfnissen des Patienten, pflegerischen
MaBnahrnen sowie arztlicher Anordnungen, die anhand einer Pflege
dokurnentation aufgezeichnet werden. Sornit stehen Aufnahrnedaten
und laufende Informationen des einzelnen Patienten jeder Pflegeper
son zur Verftigung, was in der Folge individuelle Betreuung gewahr
leistet. Wie andere Berufe, so hat sich auch der Pflegeberuf fortzubil
den: sei es die Pflegequalit1it anzuheben, Besuch von Fachkursen,
Weiterbildung in der Pflegedokurnentation sowie die Aneignung von
rnedizinischern Fachwissen. Es ist nicht ausreichend, sich nur auf
langjahrige Erfahrung zu sttitzen, wie vielfach angenommen wird.
Der hautkranke Patient bedarf einer besonderen und oft sehr auf
wendigen Pflege. Hiermit rneine ich pflegerische MaBnahrnen, die fast
ausschlieBlich die Durchfiihrung bzw. Anwendungsrnethoden der 10-
kalen Therapie betreffen. So hat das Pflegepersonal einer Hautabtei
lung diesbeztiglich folgenden Aufgabenbereich: Auftragen von Losun
gen, Crernen, Salben usw. sowie Anlegen von Gesichts-, Hand- und
Korperverbanden, weiters die Durchfiihrung verschiedener Wund-und
Kornpressionsverbande bis hin zu speziellen dermatologischen Ver
banden (z. B.: Okklusivverbande).
Voraussetzung hierfiir ist einerseits ein rnedizinisch-dermatologi
sches Grundwissen und andererseits die Kenntnis tiber Wirkung, Zu
sammensetzung und Anwendungsrnethoden verschiedenster Lokal
therapeutika sowie die Beherrschung der Verbandstechnik. Die Viel
zahl der Verbandsstoffe ist natiirlich auch dern Zweck entsprechend
und wirtschaftlich anzuwenden. Diese sollen auch individuell dern