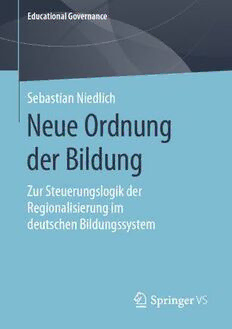Table Of ContentEducational Governance
Sebastian Niedlich
Neue Ordnung
der Bildung
Zur Steuerungslogik der
Regionalisierung im
deutschen Bildungssystem
Educational Governance
Band 49
Reihe herausgegeben von
Herbert Altrichter, Linz, Österreich
Thomas Brüsemeister, Gießen, Deutschland
Ute Clement, Kassel, Deutschland
Martin Heinrich, Bielefeld, Deutschland
Roman Langer, Linz, Österreich
Katharina Maag Merki, Zürich, Schweiz
Matthias Rürup, Wuppertal, Deutschland
Jochen Wissinger, Gießen, Deutschland
Reihe herausgegeben von
H. Altrichter Th. Brüsemeister
Johannes Kepler Universität Justus-Liebig-Universität
Linz, Österreich Gießen, Deutschland
U. Clement M. Heinrich
Universität Kassel Universität Bielefeld
Kassel, Deutschland Bielefeld, Deutschland
R. Langer K. Maag Merki
Johannes Kepler Universität Universität Zürich
Linz, Österreich Zürich, Schweiz
M. Rürup J. Wissinger
Bergische Universität Wuppertal Justus-Liebig-Universität
Wuppertal, Deutschland Gießen, Deutschland
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12179
Sebastian Niedlich
Neue Ordnung
der Bildung
Zur Steuerungslogik der
Regionalisierung im
deutschen B ildungssystem
Sebastian Niedlich
AB Allgemeine Erziehungswissenschaft
Freie Universität Berlin
Berlin, Deutschland
Gießener Dissertation im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
ISSN 2512-0794 ISSN 2512-0808 (electronic)
Educational Governance
ISBN 978-3-658-27205-0 ISBN 978-3-658-27206-7 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27206-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Inhalt
1 Einleitung ....................................................................................................... 1
2 Theoretische Grundlagen ........................................................................... 13
2.1 Grundlagen der (Educational) Governance-Perspektive ......................... 16
2.1.1 Planung ........................................................................................ 17
2.1.2 Steuerung ..................................................................................... 19
2.1.3 Governance .................................................................................. 23
2.1.4 Educational Governance-Forschung ............................................ 31
2.2 Kritik und Entwicklungsbedarf der Governance-Perspektive ................. 36
2.2.1 Problemlösungsbias der Governance-Perspektive ....................... 37
2.2.2 Verkürztes Machtverständnis der Governance-Perspektive ........ 40
2.2.3 Demokratietheoretisches Defizit der Governance-Perspektive .... 44
2.2.4 Konsequenzen für eine erweiterte Governance-Perspektive ........ 52
2.3 Governance und Wissen .......................................................................... 56
2.3.1 Zur Rolle von Wissen in der politikwissenschaftlichen
Forschung .................................................................................... 57
2.3.2 Wissen und Koordination ............................................................ 60
2.3.3 Steuerung und Governance mit Wissen ....................................... 61
2.3.4 Wissen und Gouvernementalität .................................................. 65
2.4 Rahmen für eine wissensorientierte Governance-Analyse ...................... 70
2.4.1 Wissensordnungen ....................................................................... 70
2.4.2 Wissenspolitik ............................................................................. 78
2.4.3 Innovationen als Wissenspassagen .............................................. 81
2.4.4 Analyserahmen für eine wissensorientierte Governance-
Forschung .................................................................................... 87
2.5 Zwischenfazit .......................................................................................... 94
3 Leitbilder der Staats- und Verwaltungsmodernisierung ......................... 97
3.1 Verwaltungsleitbilder bis Anfang der 1990er Jahre .............................. 100
3.1.1 Traditionelle Bürokratie ............................................................. 100
3.1.2 Planungsorganisation ................................................................. 103
3.2 Das Managementmodell ........................................................................ 106
3.2.1 Bürokratiekritik und New Public Management ......................... 108
3.2.2 Das Neue Steuerungsmodell ...................................................... 111
VI Inhalt
3.2.3 Kritik am Managementmodell ................................................... 120
3.3 Neuere Reformvorschläge in der Diskussion ........................................ 128
3.3.1 Strategisches, multirationales Management ............................... 129
3.3.2 Evidenzbasierte Politik und Praxis ............................................ 132
3.3.3 Neo-weberianischer Staat .......................................................... 133
3.3.4 Joined-up Government und Whole-of-Government .................. 138
3.3.5 Regional/Local Governance ...................................................... 142
3.3.6 Pragmatisches Management in der kooperativen Demokratie ... 146
3.3.7 Postmoderne Steuerung ............................................................. 150
3.4 Ein alternatives Leitbild: New Public Governance ................................ 154
3.5 Zwischenfazit ........................................................................................ 161
4 Neue Steuerung im deutschen Bildungssystem ....................................... 165
4.1 Neue Steuerung im Schulsystem ........................................................... 167
4.1.1 Output-Steuerung ....................................................................... 170
4.1.2 Dezentralisierung/Autonomisierung .......................................... 171
4.1.3 Evidenzbasierung ....................................................................... 174
4.1.4 Wettbewerbsorientierung ........................................................... 178
4.2 Neue Steuerung in der Hochschule ....................................................... 180
4.3 Neue Steuerung in der Weiterbildung ................................................... 184
4.4 Neue Steuerung in der beruflichen Bildung .......................................... 189
4.5 Neue Steuerung in der Elementarbildung .............................................. 193
4.6 Neue Steuerung – Zusammenführung und Diskussion .......................... 196
4.6.1 Bereichsübergreifende Gemeinsamkeiten und Unterschiede ..... 196
4.6.2 Zur Kritik an der Neuen Steuerung im Bildungssystem ............ 199
5 Regionalisierung im Bildungssystem: Leitbilder und Programme ....... 207
5.1 Steuerungstheoretische Zugänge zur Regionalisierung ......................... 209
5.1.1 Regionalisierung im deutschen Bildungssystem –
Begriffsklärung .......................................................................... 209
5.1.2 Regionalisierung als Teil Neuer Steuerung ............................... 212
5.1.3 Neue Steuerung als Vorbedingung bzw. Auslöser für
Regionalisierung ........................................................................ 216
5.1.4 Regionalisierung als Alternative zu Neuer Steuerung ............... 218
5.1.5 Schlussfolgerungen für die weitere Analyse .............................. 221
5.2 Regionalisierung im Bildungsbereich bis Mitte der 1990er Jahre ......... 224
5.3 Regionalisierungsleitbilder ab Mitte der 1990er Jahre .......................... 228
5.3.1 Regionalisierungsleitbilder in der schulischen Bildung ............. 229
Inhalt VII
5.3.2 Regionalisierungsleitbilder im Bereich
Weiterbildung/lebenslanges Lernen .......................................... 230
5.3.3 Regionalisierungsleitbilder im Bereich Berufliche
Bildung/Übergang Schule – Beruf ............................................. 233
5.3.4 Regionalisierungsleitbilder in der Kinder- und Jugendhilfe ...... 235
5.3.5 Bereichsübergreifende Beiträge zum
Regionalisierungsdiskurs ........................................................... 239
5.3.6 Zusammenführung ..................................................................... 240
5.4 Regionalisierungsprogramme ab Mitte der 1990er Jahre ...................... 244
5.4.1 Regionalisierungsprogramme im Bereich der schulischen
Bildung ...................................................................................... 246
5.4.2 Regionalisierungsprogramme im Bereich der
Elementarbildung ....................................................................... 254
5.4.3 Regionalisierungsprogramme im Bereich der beruflichen
Bildung ...................................................................................... 258
5.4.4 Regionalisierungsprogramme im Bereich
Weiterbildung/Lebenslanges Lernen ......................................... 264
5.5 Steuerungstheoretische Verortung der Regionalisierung ....................... 277
5.5.1 Systematisierung der Regionalisierungsansätze ........................ 277
5.5.2 Zwei Grundvarianten von Regionalisierung .............................. 285
6 Vertiefende Analyse I: Programm „Lernen vor Ort“ ............................ 291
6.1 Annahmen des Programms über Problemlagen und Anforderungen ..... 294
6.2 Kommunales Bildungsmanagement ...................................................... 297
6.2.1 Ziele und Anforderungen des Bildungsmanagements ............... 298
6.2.2 Gremien und Organisationseinheiten für das
Bildungsmanagement ................................................................ 301
6.3 Kommunales Bildungsmonitoring ......................................................... 307
6.3.1 Ziele und Anforderungen des Bildungsmonitorings .................. 307
6.3.2 Funktionale Beiträge des Bildungsmonitorings ......................... 309
6.3.3 Anforderungen an die Qualität der Monitoringdaten ................. 312
6.3.4 Prozessuale und kommunikative Einbettung des
Bildungsmonitorings ................................................................. 315
6.4 Zusammenführung: Steuerungslogik von DKBM ................................. 322
7 Vertiefende Analyse II: Fallstudien in „Lernen vor Ort“ ..................... 331
7.1 Methodik ............................................................................................... 332
7.1.1 Datengrundlage .......................................................................... 332
VIII Inhalt
7.1.2 Vorgehen bei der Datenanalyse ................................................. 333
7.2 Themenorientierte Darstellung der Ergebnisse ...................................... 342
7.2.1 Ausgangslagen der Kommunen ................................................. 343
7.2.2 Bildungsmanagement ................................................................ 344
7.2.3 Bildungsmonitoring ................................................................... 358
7.3 Zusammenfassung von Gemeinsamkeiten und Gegensätzen ................ 371
7.4 Verortung der Kommunen im Merkmalsraum ...................................... 377
7.5 Vertiefende Betrachtung der gebildeten Fallgruppen ............................ 384
7.5.1 Gruppe 1: Zuordnung zu Pol A .................................................. 384
7.5.2 Gruppe 2: Zuordnung zu Pol B .................................................. 388
7.5.3 Gruppe 3: Keine eindeutige Zuordnung .................................... 393
7.6 Zwei Idealtypen kommunalen Bildungsmanagements .......................... 397
7.6.1 Instrumentelles Bildungsmanagement ....................................... 400
7.6.2 Reflexives Bildungsmanagement............................................... 401
8 Schluss ........................................................................................................ 405
8.1 Fazit ...................................................................................................... 406
8.2 Implikationen für Kommunen ............................................................... 410
8.3 Implikationen für die Educational Governance-Forschung ................... 411
8.4 Limitierungen und Desiderata ............................................................... 414
9 Literaturverzeichnis .................................................................................. 421
Anhang ............................................................................................................. 489
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungen
Abbildung 2-1: Drei Ebenen der wissensorientierten Governance-Analyse .... 93
Abbildung 7-1: Verortung der untersuchten Kommunen zwischen den
beiden Polen ......................................................................... 384
Tabellen
Tabelle 2-1: Steuerung und Governance im Vergleich ............................... 27
Tabelle 2-2: Zentrale Merkmale von Input-, Throughput- und Output-
Legitimität .............................................................................. 49
Tabelle 2-3: Vier Dimensionen von Wissensordnungen ............................. 79
Tabelle 2-4: Darstellung der rekonstruierten Diskurstypen bei Bormann ... 84
Tabelle 2-5: Analysedimensionen, Leitfragen und Teilaspekte .................. 88
Tabelle 3-1: Politische Rationalität des Bürokratiemodells ...................... 102
Tabelle 3-2: Politische Rationalität der Planungsorganisation .................. 106
Tabelle 3-3: Kernelemente des Neuen Steuerungsmodells ....................... 116
Tabelle 3-4: Politische Rationalität des Managementmodells .................. 119
Tabelle 3-5: Performance, Messung und Management – Vier Modelle
nach Bouckaert ..................................................................... 136
Tabelle 3-6: Politische Rationalität von New Public Governance ............ 161
Tabelle 4-1: Politische Rationalität der Neuen Steuerung im
Bildungssystem ..................................................................... 198
Tabelle 5-1: Beiträge zum Regionalisierungsdiskurs ................................ 241
Tabelle 5-2: Aktionsfelder im Programm „Lernen vor Ort“ ..................... 272
Tabelle 5-3: Zentrale Programme der Regionalisierung im
Bildungswesen ...................................................................... 278
Tabelle 5-4: Vier-Felder-Matrix: Handlungsebenen und -felder der
Regionalisierung ................................................................... 282
Tabelle 5-5: Verortung der Regionalisierungsansätze in der Vier-
Felder-Matrix ........................................................................ 284
Tabelle 5-6: Politische Rationalitäten der zwei Grundvarianten von
Regionalisierung ................................................................... 287
Tabelle 6-1: Gremien und Organisationseinheiten für die kommunale
Koordinierung ....................................................................... 302