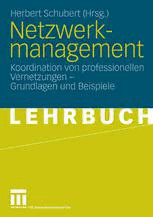Table Of ContentHerbert Schubert (Hrsg.)
Netzwerkmanagement
Herbert Schubert (Hrsg.)
Netzwerk-
management
Koordination von professionellen
Vernetzungen –
Grundlagen und Praxisbeispiele
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1.Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH,Wiesbaden 2008
Lektorat:Stefanie Laux
VS Verlag für Sozialwissenschaften ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werkeinschließlichallerseiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohneZustimmungdes Verlags unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw.in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung:KünkelLopka Medienentwicklung,Heidelberg
Satz:F.A.Z.Susanne Koch,Niedernhausen
Druck und buchbinderische Verarbeitung:Krips b.v.,Meppel
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in the Netherlands
ISBN 978-3-531-15444-2
Inhalt
Grundlagen
Herbert Schubert
Netzwerkkooperation – Organisation und Koordination von
professionellen Vernetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Praxisbeispiele
Mira Kleinbauer
Kooperationsmodell im Maschinen- und Anlagenbau . . . . . . . . . . . 106
René Böhmer, Markus Ziegler, Sascha Tilli
Netzwerkmanagement in der Transportlogistik . . . . . . . . . . . . . . . 127
Günter Schicker
Praxisnetze im Gesundheitswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tassilo Knauf
Netzwerk der Offenen Ganztagsschule in Herford . . . . . . . . . . . . . 167
Holger Spieckermann
Netzwerkmanagement in einer „Lernenden Region“ . . . . . . . . . . . . 179
Bernt-Michael Breuksch, Katja Engelberg
Netzwerkaufbau für die Weiterentwicklung von Kindertages -
einrichtungen zu Familienzentren in Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . . 188
Ursula Müller-Brackmann, Bernd Selbach
Das „Netzwerk Frühe Förderung“(NeFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Vanessa Schlevogt
Das Mo.Ki Netzwerk – Verbesserung der Bildungs- und
Entwicklungschancen von Kindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Alexandra Birkle, Andreas Hildebrand
Sozialraumkoordination in Köln Höhenberg/Vingst . . . . . . . . . . . . 241
Anhang
Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Herbert Schubert
Netzwerkkooperation – Organisation und
Koordination von professionellen Vernetzungen
Übersicht
1. Auf dem Weg zur Netzwerkorganisation
1.1 Wirtschaftliche Perspektiven von Netzwerken
1.2 Netzwerk als neue Organisationsform
1.3 Organisatorische Evolution
1.4 Cluster als regionale Wirtschaftsnetzwerke
2. Kontext der Netzwerkorganisation in der Sozialwirtschaft
2.1 Institutionelle Zerstückelung der Lebenswelten
2.2 Integriertes Prozessdenken
2.3 Normative Standards des kommunalen Handlungsrahmens
3. Theoretische Grundlagen der Netzwerkkooperation
3.1 Vernetzung von Akteuren
3.2 Netzwerk als System
3.3 Netzwerk als Institution
3.4 Defi nitionen: Kooperation, Netzwerk, Vernetzung
3.5 Systematik von Netzwerken und Netzwerksteuerung
4. Handlungsrahmen für ein Netzwerkmanagement
4.1 Managementmodell für die Netzwerkkooperation
4.2 Klärung von Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken einer Netz-
werkkooperation im Rahmen einer strategischen Situationsanalyse
4.3 Stakeholderanalyse zur Identifi kation geeigneter Kooperationspartner
4.4 Diagnose des Vernetzungsstatus mit einer Netzwerkanalyse
4.5 Managementbausteine und Steuerungselemente
5. Ausblick: Netzwerkplanung
6. Überblick über die nachfolgenden Praxisbeispiele dieser Publikation
6.1 Netzwerkkooperation in der Erwerbswirtschaft
6.2 Netzwerkkooperation zwischen Non-Profi t-Organisationen der
gemeinnützigen Sozialwirtschaft in der öffentlichen Daseinsvorsorge
8 Herbert Schubert
1 Auf dem Weg zur Netzwerkorganisation
Die Metapher des Netzwerks, das aus Bändern und untereinander verbunde-
nen Knoten besteht, ist in einer übertragenen Bedeutung zu einer dominanten
rhetorischen Figur geworden, um aktuelle Gesellschaftsentwicklungen zu be-
schreiben. Manuel Castells prägte den Begriff der „Netzwerkgesellschaft“, weil
die gesellschaftlichen Prozesse und Funktionen vor allem von Inklusion und
Exklusion aus Netzwerken und von der Architektur der Beziehungen zwischen
Netzwerken – informationstechnologisch verstärkt – konfi guriert werden (2001:
528). Die besondere Qualität dieses Netzwerkverständnisses wird von offenen
Strukturen repräsentiert, die expansionsfähig neue Knoten integrieren, wenn
diese die Kommunikationscodes des Netzwerkes – wie z. B. Werte oder Leis-
tungsziele – beherrschen. Insofern eignet sich die Netzwerkallegorie, um den
dynamischen und offenen Systemcharakter der gegenwärtigen Organisations-
strukturen in der Gesellschaft zu skizzieren.
1.1 Wirtschaftliche Perspektiven von Netzwerken
Netzwerken wird ein besonderer instrumenteller Charakter für die kapitalis-
tische Wirtschaft zugeschrieben. Forcierte Innovationsprozesse, die Globali-
sierung wirtschaftlicher Verfl echtungen und dezentralisierte Konzentrations-
prozesse basieren auf fl exiblen Unternehmen und einer Neuorganisation der
Machtbeziehungen zwischen ihnen. Den organisatorischen Wandel zu globalen
Netzwerken von Kapital, Management und Information beschreibt Castells mit
den folgenden Worten:
„Wirtschaftsunternehmen und zunehmend auch Organisationen und Institutionen
sind in Netzwerken mit variabler Geometrie organisiert, deren Verfl echtung die
traditionelle Unterscheidung zwischen Konzernen und Kleinunternehmen ersetzt,
sich quer durch alle Sektoren erstreckt und sich entlang unterschiedlicher geogra-
fi scher Konzentrationen ökonomischer Einheiten ausbreitet. Der Arbeitsprozess
wird entsprechend zunehmend individualisiert, die Arbeit wird in ihrer Ausfüh-
rung in ihre Bestandteile zerlegt und am Ende durch eine Vielzahl zusammenhän-
gender Aufgaben an verschiedenen Standorten neu integriert.“ (ebd.: 529)
Wirtschaftliches Handeln in Netzwerken erfordert „weiche Steuerungsstra-
tegien“, über die sich die beteiligten Organisationen des Wirtschafts- und Ar-
beitssystems sowie darüber hinaus eingebundene Organisationen fortwährend
abstimmen, ohne ihr eigenes Steuerungspotenzial aufzugeben (vgl. Heinze
2000: 33). Die neuen Informationstechnologien bilden dabei die grundlegende
Infrastruktur zur Reduktion der mit der Vernetzung verbundenen Komplexität.
Netzwerkkooperation 9
Die Ausbreitung des ‚world wide web‘ im Laufe der vergangenen Jahrzehnte
symbolisiert den technisch-ökonomischen Paradigmenwechsel, der im Kontext
von Fortschritten in Mikroelektronik und Telekommunikation den Übergang
von einer Technologie auf der Grundlage billiger Energie zu einer Technologie
auf der Basis billiger Informationen markiert. Die neuen Technologien nutzen
bei der Bearbeitung von Informationen als Rohstoff eine „Netzwerklogik“, die
in der Folge für eine Vielzahl von Prozessen und Organisationsformen materiell
verwirklicht wird, weil sie einerseits Strukturierungskraft hat, andererseits aber
auch Flexibilität sichert, was das Re-Arrangement organisationaler und insti-
tutioneller Komponenten betrifft. Die Entstehung der informationell basierten
globalen Ökonomie steht mit der Entwicklung dieser neuen Organisationslogik
des Netzwerks in einem engen Zusammenhang (Castells 2001: 75ff.). Umge-
kehrt repräsentiert die Netzwerkorganisation auch eine Reaktion auf das dyna-
mischer und komplexer gewordene Umfeld wirtschaftlicher Unternehmungen:
Denn mit der Globalisierung der Wettbewerbsbedingungen beschleunigt sich
auch der ökonomische und technologische Wandel, was beispielsweise in ei-
ner Verkürzung der Produktlebenszeiten erkennbar wird. Die damit verbundene
wachsende Unsicherheit wird kompensiert mit Netzwerkkooperation, die den
Akteuren mehr Flexibilität ermöglicht (Kraege 1997: 1).
Mit dem Wandel der Organisationsweise und den neuen Informationstech-
nologien bildet sich eine charakteristische Organisationsform zu Beginn des 21.
Jahrhunderts heraus: das „Netzwerkunternehmen“, dessen Teile sowohl autonom
wie auch abhängig sind (Castells 2001: 198f.). Die Leistungsfähigkeit des Netz-
werkunternehmens wird durch seinen „Verknüpfungsstatus“ – als Fähigkeit einer
störungsfreien Kommunikation zwischen seinen Elementen – und durch seine
„Konsistenz“ – als Übereinstimmung zwischen den Netzwerkzielen und den Zie-
len der Komponenten – geprägt (vgl. Windeler 2001). Netzwerkorganisationen
sind danach erfolgreich, wenn sie Wissen und Prozessinformation effi zient her-
vorbringen, fl exibel ihre Mittel wechseln und innovativ mit kulturellem, techno-
logischem und institutionellem Wandel umgehen können (vgl. Welter 2005).
1.2 Netzwerk als neue Organisationsform
Seit den 1990er Jahren setzen sich Netzwerke als neue Organisationsform
durch. Ein bekanntes Beispiel ist das Management marktbasierter Netzwerke
– wie z. B. Kooperationsnetzwerke in der Automobilproduktion der Mobilitäts-
industrie. Mit der Defi nition von Schnittstellen, der kooperativen Entwicklung
gemeinsamer Produkte in ‚Systempartnerschaft’ und der gegenseitigen Abstim-
mung ihrer Beiträge hilft die Netzwerkorganisation, die Defi zite traditioneller
Organisationsmuster zu beseitigen (vgl. Scott 2003).
10 Herbert Schubert
Den Kern der Netzwerkorganisation bildet eine „Netzwerkkooperation“
mit folgenden konstitutiven Merkmalen (Kraege 1997: 51): (1) Der Kooperati-
onsinhalt und die Koordination werden explizit auf der Grundlage eines gemein-
samen Zieles (informell oder vertraglich, für einen begrenzten oder unbegrenz-
ten zeitlichen Horizont) vereinbart. (2) Die beteiligten Akteure bleiben rechtlich
und wirtschaftlich selbständige Einheiten mit einer Mindestautonomie, die eine
Option zum freiwilligen Ein- und Austritt enthält. (3) Die Kontrolle über das
Zusammenwirken wird unter den Akteuren so aufgeteilt, dass die Leistungsbei-
träge dezentral verantwortet werden. (4) Die Netzwerkorganisation wird durch
die „Kommunikation von Entscheidungen“ konfi guriert und ersetzt dadurch
kontinuierlich Unsicherheit der einzelnen Organisation durch selbst erzeugte
Sicherheiten des Netzverbunds (vgl. Luhmann 1998: 833). Killich (2007:21f.)
erkennt darin die Chance, dass die Organisation ihre Selbständigkeit behalten
und trotzdem Ergebnisse realisieren könne, die sie allein nicht bewerkstelligt
hätte. Aber es sind auch mögliche Risiken zu diagnostizieren: So ist beispiels-
weise nicht auszuschließen, dass ein Partner nur einen kurzfristigen Vorteil aus
der Kooperation zieht. Auch der hohe Aufwand für Abstimmungs- und Steu-
erungsvereinbarungen kann die Kooperationsvorteile beträchtlich einschrän-
ken. Rößl grenzt deshalb davon „nicht kooperative Netzwerke“ ab, in denen
das Verhalten der Akteure durch klassische hierarchische Managementinstru-
mente der hierarchischen Bürokratie (Anordnung, Kontrollen und nachfolgende
Sanktionen) – nicht freiwillig – sichergestellt wird, während die Akteure in der
Netzwerkkooperation freiwillig über die Möglichkeit entscheiden, ob sie durch
ein nicht vereinbarungsgemäßes Verhalten kurzfristige Vorteile ziehen (Ausbeu-
tung, betrügerisches Verhalten) oder ob sie darauf zugunsten eines langfristigen
Bestandes der Beziehung verzichten wollen (1996: 311ff.)
Der Trend zur Bildung von Netzwerken als neue Organisationsform voll-
zieht sich international und global (vgl. Nadler/Gerstein/Shaw 1992). Die be-
teiligten Akteure ziehen daraus den Vorteil, ihre Ressourcen bündeln, ihre
Kapazitäten verknüpfen und ihr Leistungsspektrum erweitern zu können. Die
Netzwerkorganisation dient vor allem auch der Bewältigung des ökonomischen
und technischen Wandels und den damit verbundenen Unsicherheiten und Ri-
siken: Die kleinen und mittleren Betriebe der Zulieferungsnetzwerke in der Mo-
bilitätsindustrie zum Beispiel reduzieren über Abstimmungen im Netzwerk die
hohe Umweltkomplexität bei der Produktion von Fahrzeugen. Selbst die hierar-
chische Bürokratie der Kommunalverwaltung, die sich immer schon komplexen
Umwelten ausgesetzt sah, aber in einer ‚stabilen Welt‘ bisher nur standardisierte
Routinehandlungen vollzog, entwickelt sich in der Gegenwart in die Richtung
der Netzwerkorganisation weiter. Denn die Maßnahmen der ‚öffentlichen Hand‘
können – angesichts der Vielfältigkeit und des fortwährenden Wandels von Le-
Netzwerkkooperation 11
benssituationen der Adressaten – nicht mehr nach einem immer und überall
gleichen Schema erfolgen. Die Netzwerkkooperation wird in einem „postkom-
petitiven Strategieverständnis“ als Handlungsalternative zur Erreichung einer
fortschritts- und handlungsfähigen Organisation verstanden, indem nicht mehr
eindeutige Organisationsgrenzen angestrebt werden, sondern kooperative Struk-
turen (Kraege 1997: 56).
Nach der reinen Orientierung an „effi zienten Prozessen“ (im Übereifer)
zu Beginn der 90er Jahre verschiebt sich das Interesse der Netzwerkorganisa-
tion vermehrt zu „wirkungsvollen Prozessen“ (Vahs 2003: 244). Statt sich am
schlichten Modell der ‚schlanken Organisation‘ (Lean Management) zu orien-
tieren, werden drei Orientierungsdimensionen von der Netzwerkkooperation
integriert (vgl. Abbildung 1):
• die Kundenorientierung (bzw. Adressatenorientierung),
• die Produkt- inkl. Qualitätsorientierung und
• die Kompetenzorientierung.
Quelle: nach Nadler/Gerstein/Shaw 1992: 33 und Vahs 2003: 244
Abbildung 1: Trend zur Netzwerkkooperation