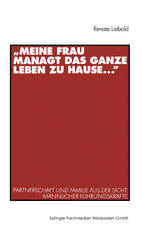Table Of ContentRenate Liebold
"Meine Frau managt das ganze Leben zu Hause ..."
Renate Liebold
"Meine Frau
managt das ganze
Leben zu Hause ..."
Partnerschaft und Familie
aus der Sicht
männlicher Füh rungsk räft e
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich.
1. Auflage Mai 2001
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2001
Ursprünglich erschienen bei Westdeutscher Verlag 2001
Lektorat: Dr. Tatjana Rollnik-Manke
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim
mung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun
gen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jeder
mann benutzt werden dürften.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt
ISBN 978-3-531-13636-3 ISBN 978-3-663-07774-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-07774-9
Inhalt
Einleitung ....................................................... 11
Kapitel I: Stand der Forschung ..................................... 15
1. Sozialhistorische Hintergründe von Ehe und Familie ........ 15
l.l Der Funktionszusammenhang des 'Ganzen Hauses' ........ 16
1.2 Die Entstehung des bürgerlichen Familienmodells . . . . . . . . .. 18
1.3 Das Geschlechterverhältnis als Entsprechung von Öffentlich-
keit und Privatheit ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
Exkurs: Der Geschlechterdiskurs bei den soziologischen Klassikern:
Naturalisierung, Polarisierung und Komplementarität . . . . . . . . . . . .. 21
1.4 Universalisierung des bürgerlichen Familienmodells und die
Entwicklung zur modemen Kleinfamilie . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25
2. Die Familie der Gegenwart ........................... , 27
2.1 Die Familie in den 50er und 60er Jahren:
Zwischen wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit, Ideologie und
gelebtem Familienalltag ............................... 28
2.2 Familie im Umbruch -der gesellschaftliche Wandel und die
Folgen für die Lebensform 'Familie' .................... 31
2.2.1 Individualisierung und Pluralisierung familialer Lebensformen 31
2.2.2 'Gebundene' Individualisierung und 'erlittene Emanzipation':
Über Frauen und Männer ............................. 36
2.2.3 Gleichheit in Paarbeziehungen: Zwischen Idee und Alltags-
praxis ............................................ 40
2.3 Resümee .......................................... 44
Kapitel 11: Untersuchungsansatz und Forschungsprozess ............... 47
1. Die Forschungsfrage: Lebensgeschichte und Familie von
männlichen Führungskräften ........................... 47
2. Zur Auswahl der Methode ............................. 48
2.1 Biographisches Erhebungsinstrument: Das autobiographisch
narrative Interview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48
5
2.2 Struktur und Durchführung eines autobiographisch-narrativen
Interviews .......................................... 50
2.3 Parallele Auswertung, strukturelle Beschreibung und Fall-
vergleich .......................................... 52
3. Reflexionen zum autobiographisch-narrativen Interview ..... 54
4. Über den Zusammenhang von Erleben, Erinnern und
Erzählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60
5. Zur Verallgemeinerungsfähigkeit biographischer Einzelfall-
studien ............................................ 63
Kapitel III: Fallstudien und vergleichende Analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
1. Auswahl des Sampies ................................ 67
2. Präsentation der biographischen Gesamtformungen ......... 69
2.1 Herr Paulsen ....................................... 69
2.2 Herr Gerhard ....................................... 81
2.3 Herr Diem ......................................... 92
3. Verallgemeinerung und Fallvergleich ................... 107
3.1 Die Bedeutung von Familie im biographischen Ablauf ..... 109
3.1.1 Die Junggesellenzeit -Durststrecke und Wunsch nach sozia-
ler Einbindung: "Wenn keiner zu Hause auf einen wartet" . .. 109
3.1.2 Karrierebeginn und Familiengründung: "Meine Frau brauchte
gar nicht mehr mit mir zu rechnen" .................... 111
3.1.2.1 Die Entscheidung für eine geschlechtsspezifische Arbeits-
teilung: "Das war eigentlich ganz klar" . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
3.1.2.2. Der sukzessive Rückzug aus der Familie:
"Das ist eine Einbahnstraße" ......................... 114
3.1.2.3 Soziale Folgekosten des erwerbszentrierten Lebens:
"Der Beruf macht einsam" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117
3.2 Familie und Beruf: Über die Schwierigkeiten der Integration 122
3.2.1 Der Blick auf die Ehefrauen:
Zwischen Huldigung und schlechtem Gewissen ........... 122
3.2.2 Führungskräfte als Väter:
Zwischen Abwesenheit und exklusiver Präsenz ........... 127
3.2.3 Das Aufrechterhalten eines labilen Gleichgewichts:
Die alltägliche Balance zwischen Beharrungsvermögen und
Krisenintervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
6
3.2.4 'Produktive Irritationen' in festgefahrenen Lebensarrange
ments: "Die Meinung über Erfolg und weniger Erfolg ändert
sich ja auch im Laufe des Lebens" ..................... 141
3.2.5 Thematisierung von Arbeit in der Sphäre des Heims:
Zwei Strategien .................................... 147
3.3 Sichtweisen auf die eigene Biographie .................. 152
3.3.1 Der resignative Blick auf das eigene Leben: "Du hast als
Berufsmensch keine Chance, was anders zu machen" ...... 153
3.3.2 Die legitimierende Retrospektive: "Man kann nicht aus
seiner Haut raus" ................................... 155
3.3.3 Die idealisierende Perspektive: "Im Nachhinein bin ich
ganz froh" ........................................ 157
Fazit und Ausblick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 161
Literatur ....................................................... 169
7
Vorwort
Die vorliegende Studie ist im Arbeitszusammenhang der Projektgruppe 'Lebensarrange
ments von Führungskräften ' entstanden. Ich möchte allen danken, die mich in den
letzten Jahren auch über den Diskussionszusammenhang des Projekts hinaus unter
stützt, mit mir diskutiert und mich motiviert haben, diese Arbeit zu einem Abschluss
zu bringen. Alle, die mir nahestanden, haben viel geleistet.
Ganz besonders möchte ich mich bei Rainer Trinczek für seine kontinuierliche
Begleitung und verständnisvolle Beratung bedanken. Ohne ihn und seine Hilfe im
Entstehungszusammenhang des genannten Projektes, wäre diese Arbeit niemals
entstanden. Viel verdanke ich Cornelia Behnke, die mir mehr als eine Kollegin war. In
den gemeinsamen Projekt-Diskussionen am Text und darüber hinaus habe ich viele
inspirierende Impulse von ihr erhalten und von ihrer Fähigkeit, Textmaterial zu ordnen
und Ideen zu strukturieren, profitiert. Hanjo Gergs gab nicht nur konstruktive Denk
Anstöße, sondern er ermutigte mich über einen langen Zeitraum hinweg zu diesem
Dissertationsvorhaben. Susanne Singer war eine interessierte Zuhörerin und unbe
stechliche Kommentatorin. Ihre inhaltliche 'Mit-Sicht' und ihr geduldiger Beistand
auch in der 'heißen Phase' kurz vor Abgabetermin haben mir sehr geholfen. Wichtig
für mich war Andreas Krach. Sein liebevolles Bemühen, mich immer wieder vom
Schreibtisch ins Leben zu holen, haben viel dazu beigetragen, dass diese Arbeit
gelang. Technischen Support und auch die mühsame Suche nach Tippfehlern haben
viele geleistet. Neben den bereits genannten FreundInnen sind da noch: Christa
Herrmann, Heike Tombrink, Silvia Rosini, Nina Gerl, Paul Rose, Susanne Pamer und
Tobias Rudolf.
Die Arbeit ist Siegfried Heinemeier gewidmet, der 1996 gestorben ist. Ihm ver
danke ich viel.
9
Einleitung
"Sie heißen 'Montagsflüchtlinge' im eigenen Jargon" (Brawand 1996: 51) - jene
Männer in Führungspositionen, die nach einem Wochenende mit Familie aufatmend
an ihrem Schreibtisch sitzen, an einem Ort, :für den sie besser qualifiziert sind und wo
sie ohnehin mehr Anerkennung bekommen: In ihrer Firma. In dieser Karikatur führen
beruflich erfolgreiche Männer lediglich ein familiales 'Schattendasein' und in ihren
kurzen 'Gastspielen' zu Hause offenbart sich die Kehrseite einer beruflichen Erfolgs
biographie. Demgegenüber wird in den Medien mit 'neuen' Vätern, sogenannten
Hausmännern oder auch Familienpionieren ein ganz anderes Szenario entworfen, das
in extremer Weise mit diesem klischeehaft gezeichneten Bild von karrierefixierten
'Man(n)agern' kontrastiert. Denn: Männer geraten heute zunehmend unter Druck, weil
sie nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen können, dass ihnen ihre Partnerinnen
den Rückenfür Erwerbsarbeit freihalten. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, das
auch männliche (Selbst) Ansprüche an eine stärkere lebensweltliche Verankerung und
somit 'aktive Familienarbeit' zunehmen. Wie vor dem Hintergrund des geschlechter
politischen Wandels beruflich stark engagierte Männer -Führungskräfte in Industrie
betrieben - Familie und Partnerschaft deuten und (er-) leben, mit dieser Frage be
schäftigt sich die vorliegende Untersuchung.
Das Interesse :für diese Fragestellung entstand im Projektzusammenhang über
'Lebensarrangements von Führungskräften im Kontext veränderter beruflicher und
privater Herausforderungen'l. Führungskräfte, so die leitende Arbeitshypothese,
erfahren gegenwärtig eine 'doppelte' Dramatisierung ihrer Lebenssituation, weil sie
mit veränderten Herausforderungen in beiden Sphären, Beruf und Familie, konfron
tiert werden (vgl. Ellguth u.a. 1998). Beruflich werden die Führungskräfte aufg rund
neuer betrieblicher Umstrukturierungsmaßnahmen -nicht zuletzt im Rahmen von' lean
management'-Strategien -mit einer zunehmend prekärer werdenden Arbeitssituation
konfrontiert, die mehr denn je hohes berufliches Engagement und uneingeschränkte
Verfiigbarkeit:für das Unternehmen abverlangt (vgl. Deutschmann u.a. 1995). Neue
und erweiterte Anforderungen an berufliche Qualifikationsprofile, die Infragestellung
traditioneller Karrierepfade sowie eine verschärfte Arbeitsmarktkonkurrenz umfassen
die veränderten Rollenanforderungen und die verschärften betrieblichen Handlungs
bedingungen der Führungskräfte (Baethge u.a. 1995). Gleichzeitig vollzieht sich dieser
'Sog' der Institution Arbeit in einer Zeit, in der sich Hinweise darauf verdichten, dass
Das Projekt wird von der DFG gefördert und ist am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum
sowie am Institut rur Soziologie der Universität Erlangen-NOmberg angesiedelt. Federfilhrend sind
daran Comelia Behnke, Renate Liebold und Rainer Trinczek beteiligt.
11
Männer heute von ihren Partnerinnen weitaus stärker als früher mit Forderungen nach
einem größeren Engagement als Partner und Vater konfrontiert werden. Frauen (vor
allem jüngere) stellen verstärkt die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der
Familie in Frage und nehmen dabei auch partnerschaftliche Konflikte in Kauf. Darü
ber hinaus formulieren Männer - der einschlägigen Literatur zufolge - auch selbst
Wünsche nach mehr (Frei-) Zeit und aktivem Eingebundensein in private Lebenskon
texte (vgl. von Rosenstiel 1992, Scase und Goffee 1989). Vor diesem Hintergrund
entstand die Frage, ob männliche Führungskräfte mit einer besonders zugespitzten
Problemkonstellation konfrontiert werden und sich hier Modemisierungsparadoxien
pointiert beschreiben lassen.
Eine solche 'Männer-Perspektive' stellt darüber hinaus eine sinnvolle und notwen
dige Ergänzung der bisherigen familien- und auch managementsoziologischen For
schung dar. Die Untersuchungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind
bislang - aus nachvollziehbaren Gründen - in der Tradition der Frauenforschung
verankert (vgl. u.a. Tölke 1991). Männer tauchen in dieser Forschungsperspektive in
erster Linie als Kontextvariable auf. Auch wenn vereinzelte Untersuchungen speziell
zu Männem publiziert werden (vgl. Behnke 1997, Brock 1990 Metz-Göckel 1985,
Meuser 1998, PrenzeVStrümpel 1990) sowie vergleichende Analysen zum demogra
phischen Verhalten von Männem und Frauen vorliegen (vgl. Huinink 1989, Diekmann
1987, Krüger 1995), so ist doch ein weiblicher 'bias' der Familienforschung zu
verzeichnen. Daneben dominiert auch in der Managementsoziologie ein selektiver
Blick. Mit der Konzentration auf die funktionale Rolle von Managem in der betriebli
chen Sphäre wird die lebensweltliche Einbettung von Führungskräften weitgehend
ausgeblendet (vgl. Ellguth u.a. 1998).
Meine eigene Untersuchung knüpft an den skizzierten Forschungskontext an.
Dabei werden allerdings spezifische Akzentuierungen vorgenommen: Zum einen
werden männliche Führungskräfte nicht vorrangig in ihrer Eigenschaft als betriebliche
Akteure beschrieben; vielmehr geht es mir darum, wie sie als vielbeschäftigte Männer
ihre Rolle als Ehemänner und Väter ausfüllen. Um dieser Frage adäquat nachgehen zu
können, hat es sich zum anderen angeboten, die empirische Untersuchung auf 'ältere'
Führungskräfte zu fokussieren, die auf langjährige Familien-und Berufsgeschichten
zurückblicken können. Mit dieser Beschränkung auf eine bestimmte Altersgruppe wird
der Blick auf diejenigen Männer aus dem Gesamtsampie gerichtet, in deren biographi
schem Verlauf die 'alten' Leitbilder von Familie zunehmend brüchiger werden. Im
Laufe ihrer Familienbiographie werden sie sukzessive mit einem geschlechterpoliti
schen Wandel konfrontiert.
Im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung stehen die Sichtweisen von Män
nem -beruflich stark engagierten Männem -auf Partnerschaft und Familie im biogra
phischen Verlauf. Mit Hilfe biographischer Interviews werden die subjektiven Deu
tungen und Interpretationen sowie die gewählten Handlungsmuster der Führungskräfte
rekonstruiert. Inhaltlich gliedert sich die Arbeit in drei Teile:
Im ersten Kapitel (I) wird der Forschungsstand zum Thema dargestellt. Dabei geht
es um die Entstehungsgeschichte des bürgerlichen Familienleitbildes, in der sich
männliche Erwerbsarbeit und weibliche Hausarbeit ergänzen. Auch gegenwärtige
12
Vorstellungen von familialer Arbeitsteilung sind noch - zumindest partiell - in der
Tradition des bürgerlichen Familienideals verwurzelt, wenngleich neue Leitbilder die
Geschlechterordnung aufzubrechen beginnen. Diese Widersprüche zwischen tradierten
und neuen Haltungen werden im Binnenverhältnis der Familien ausgetragen.
Im zweiten Teil der Untersuchung (Kap. 11) werden die methodische Anlage, die
Auswahl und Begründung der Methode und das Auswertungsprozedere erläutert sowie
einige ( auch kritische) Reflexionen zum autobiographisch-narrativen Interview darge
legt. Darüber hinaus werde ich zur Verallgemeinerungsfahigkeit biographischer
Einzelfallstudien Stellung beziehen.
Das dritte Kapitel (III) ist der empirische Teil und somit das 'Herzstück' meiner
Untersuchung. Es werden zunächst drei biographische Fallstudien exemplarisch
vorgestellt. In einem zweiten Schritt, der vergleichenden Analyse, werden Unter
schiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und beschrieben. Zuletzt werden die
Ergebnisse noch einmal gebündelt resümiert.
13