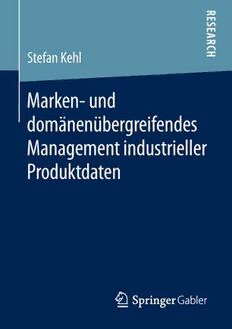Table Of ContentStefan Kehl
Marken- und
domänenübergreifendes
Management industrieller
Produktdaten
Marken- und domänenübergreifendes
Management industrieller Produktdaten
Stefan Kehl
Marken- und
domänenübergreifendes
Management industrieller
Produktdaten
Stefan Kehl
Gifhorn, Deutschland
Dissertation Technische Universität Clausthal, 2018
D 104
Originaltitel: Marken- und domänenübergreifendes Management industrieller Produktdaten.
Komponentenbasiertes Produktmodell und ereignisbasierte Softwarearchitektur für die
dezentrale Produktentwicklung.
ISBN 978-3-658-24448-4 ISBN 978-3-658-24449-1 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24449-1
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
»Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere Weg
zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen.«
(Thomas Alva Edison)
Danksagung
Allen voran möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Doktorvater Jörg P.
MüllerfürdieChance,beiihmzupromovieren,bedanken.AmAnfangmeiner
Arbeitszeit hattest du wahrscheinlich Bedenken, ob ich der richtige für die
Stelle bin. Wie lange einem ein ich–mache–nur–das–allernötigste–Seminar
im Grundstudium doch nachhängen kann. Trotzdem hast du mich damals
eingestellt und es mir ermöglicht, mich selbstständig in ein Forschungsthema
einzuarbeiten und meine Vorstellungen darin zu verwirklichen. Wenn ich
an der ein oder anderen Stelle nicht weiter kam, standest du mir sowohl
thematisch als auch persönlich immer mit Rat und Tat zur Seite und gabst
mir die Denkanstöße, die mich letztendlich hierher geführt haben.
Ich bedanke mich ebenfalls bei Sven Hartmann für die Übernahme des
Koreferats und seine wertvollen Anmerkungen gegen Ende meiner Arbeit.
Auch Patrick Stiefel und seinem damaligen Chef Saad Metz gilt mein
Dank. Sie ermöglichten mir meine Arbeit in enger Zusammenarbeit mit der
Volkswagen AG zu schreiben und somit eine wissenschaftliche Arbeit mit
einer praktischen Relevanz zu verfassen, die ich an der Universität allein
nichthätteerreichenkönnen.AuchwenndiefachlichenDiskussionenmitdir,
lieber Patrick, häufig sehr anstrengend und wir nicht immer einer Meinung
waren, hätte ich ohne dich nicht doch immer noch einen Schritt nach vorne
machen können. Ohne deine Rückendeckung und dein Engagement wäre
diese Arbeit in ihrer letztendlichen Form nicht möglich gewesen.
Ein ebenso großes Dankeschön möchte ich all denen aussprechen, die mich
während ihres Studium als Hiwi begleitet oder die einen Beitrag zu dieser
Arbeit in Form einer Abschlussarbeit geleistet haben. Carsten Hesselmann
möchte ich für den intensiven Gedankenaustausch und vor allem für das
Korrekturlesen meiner Arbeit danken. Durch deine Hilfe hat diese Arbeit
noch einmal deutlich an Struktur und Konsistenz gewonnen. Janek Bender
seigedanktfürseineIdeenzuderSoftwarearchitektur,dieimRahmendieser
VIII Danksagung
Arbeit entstanden ist. Rico Jiménez und Sören Schleibaum möchte ich für
ihre Unterstützung bei der Evaluierung meiner Konzepte danken.
Auch meinen Kollegen Günter Schweer, Raul Radnai, Dirk Hosenfeld, En-
gelbert Suchla, Utz Klemm, André Wagner und Majid Rezaei aus Wolfsburg
gebührt mein Dank. Mit Hilfe eures großen fachlichen Wissens brachtet ihr
mir sowohl sehr viele Details des Product Lifecycle Managements in der
Praxis näher als auch wichtige Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag in
einem konzernweiten Entwicklungsprojekt. Nicht zuletzt durch eure Hilfe
bei der qualitativen Evaluierung meiner Konzepte halft ihr mir dabei eine
Arbeit mit dem für mich größtmöglichen praktischen Nutzen zu verfassen.
Ein besonderes Dankeschön möchte ich unseren Verwaltungsangestellten
ChristineKammann,SandraKarpenstein,AnitaSeiz–Uhlig,AndreaBehfeld
sowieunserenTechnikernPeterPlatzdasch,JörnKörnerundThomasBravin
am Institut für Informatik für ihre Hilfe bei allen nicht–wissenschaftlichen
Dingen des Alltags aussprechen. Ohne euch hätte ich weder Dienstreisen
machen können oder Hiwis gehabt noch hätte ich Übungen für unsere
Studierendendurchführenkönnen.DieseArbeithätteichwahrscheinlichnicht
mit Stift und Papier schreiben müssen, es wäre aber nah dran gewesen. In
diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz besonders bei meiner Kollegin
und Freundin Stefanie Cronjäger für ihre ausdauernde Unterstützung gerade
während der Schreibphase dieser Arbeit bedanken. Hättest du mich nicht
stets von neuem motiviert sowie mir den Rücken gestärkt und freigehalten,
würde ich diese Sätze jetzt vermutlich nicht schreiben. Am Ende meines
Studiums war ich mir lange nicht sicher, ob eine Promotion das richtige für
mich ist. Zum Glück entschied ich mich dafür, denn sonst hätte ich dich
heute nicht. Und allein dafür hat sich die Mühe schon mehr als gelohnt.
Zu guter letzte möchte ich mich noch bei meiner Familie bedanken. Schon
in der Schule habt ihr mir immer wieder auf die Füße getreten und mich
dazu gebracht mein Abitur zu machen. Dabei habe ich mich zwar nicht
mit Ruhm bekleckert, habe es aber doch irgendwie geschafft. Während des
Studiums merkte ich relativ schnell, dass das Nötigste nicht mehr reicht um
Danksagung IX
wirklichgutzuseinundentwickelteeinenEhrgeiz,denmeineMutterSiegrid
Kehl gerne schon zu Schulzeiten gesehen hätte. Auch während dieser Zeit
wart ihr immer für mich da, habt mich unterstützt wo ihr nur konntet und
spracht mir immer wieder Mut zu, wenn ich eigentlich schon aufgegeben
hatte. Insbesondere den Anteil meiner Großeltern Hans–Jürgen und Irmgard
Ips an meinem Werdegang möchte ich an dieser Stelle hervorheben: Ohne
eure Unterstützung hätte ich gar nicht erst studieren können. Dadurch habt
ihr den Grundstein für meine berufliche Laufbahn gelegt. Das Wort Danke
reicht da eigentlich gar nicht aus.
Nach dem Abschluss meines Studiums fragte meine Mutter mich, ob
ich im Nachhinein gerne mehr für mein Abitur getan hätte. Letztendlich
habe trotz einer nicht gerade guten Abiturnote genau das gemacht, was ich
wollte: Wirtschaftsinformatik an einer sehr guten Universität studieren. Im
Nachgang durfte ich sogar noch promovieren und in der Schule zuvor hatte
ich sehr viel Spaß. Was hätte ich also anders machen sollen?
Inhalt
I Motivation und Problemstellung 1
1 Einleitung 3
2 Hintergrund 13
2.1 Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.1 Produkte und Produktkomponenten . . . . . . . . 14
2.1.2 Produktentstehungsprozess . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.3 Datenelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.4 Rollen und Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.5 Prozesse und Arbeitsweisen . . . . . . . . . . . . . 29
2.2 Wiederverwendungskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.1 Plattform–Hut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.2 Modularisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Softwarearchitekturen und Technologien zur Umsetzung . 35
2.3.1 Makro–Meso–Mikro–Architektur . . . . . . . . . . 35
2.3.2 Event–Driven Architecture (EDA) . . . . . . . . . 37
2.3.3 Service–Oriented Architecture (SOA) . . . . . . . 41
2.3.4 Event–Driven SOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4 Entwurfsmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3 Analyse des Entwicklungsprozesses in der
Automobilindustrie 47
3.1 Identifikation von Handlungsfeldern . . . . . . . . . . . . 48
3.2 Entstehung und Nutzung einer Plattform . . . . . . . . . 53
3.2.1 Bereitstellung, Verwendung und Änderungen von
Plattformkomponenten. . . . . . . . . . . . . . . . 54
XII Inhalt
3.2.2 Transparenz bei der Wiederverwendung von
Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3 Markenspezifischer Produktentwicklungsprozess . . . . . . 58
3.3.1 Anforderungsdefinition . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.3.2 Spezifikation von Eigenschaften . . . . . . . . . . . 62
3.3.3 Ablage von Geometrien (ohne Stücklistenbezug) . 64
3.3.4 Übergang von Design zu Serie . . . . . . . . . . . . 67
3.3.5 Ablage von Geometrien und Teilen
(mit Stücklistenbezug) . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.6 Änderungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . 78
4 SotA und Related Work 83
4.1 Produktdatenmodellierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.1.1 NIST Core Product Model . . . . . . . . . . . . . 86
4.1.2 STandard for the Exchange of Product model data
(STEP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.1.3 Produktstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.1.4 Sonstige Datenmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2 Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.1 Prozessintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.2.2 Datenintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.2.3 Zusammenfassung verwandter Arbeiten im Bereich
der Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.3 Änderungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.3.1 Engineering Change Management (ECM) . . . . . 109
4.3.2 Agentengestützte Änderungsoperationen . . . . . . 112
4.3.3 Versionskontrollsysteme . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.4 Wiederverwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.4.1 Softwareproduktlinien . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.5 Zusammenarbeitsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.6 Zusammenfassung der Forschungsfragen . . . . . . . . . . 131