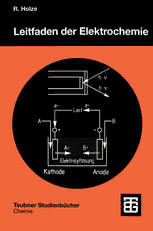Table Of ContentTeubner StudienbOcher Chemie
R. Holze
Leitfaden der Elektrochemie
Teubner Studienbi.icher Chemie
Herausgegeben von
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Eischenbroich, Marburg
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Hensel, Marburg
Prof. Dr. phil. Henning Hopf, Braunschweig
Die Studienbucher der Reihe Chemie sollen in Form einzel
ner Bausteine grundlegende und weiterfuhrende Themen
aus allen Gebieten der Chemie umfassen. Sie streben nicht
die Breite eines Lehrbuchs oder einer umfangreichen Mo
nographie an, sondern soli en den Studenten der Chemie -
aber auch den bereits im Berufsleben stehenden Chemiker
- kompetent in aktuelle und sich in rascher Entwicklung be
findende Gebiete der Chemie einfUhren. Die Bucher sind
zum Gebrauch neben der Vorlesung, aber auch - da sie
hc1ufig auf Vorlesungsmanuskripten beruhen - anstelle von
Vorlesungen geeignet. Es wird angestrebt, im Laufe der Zeit
aile Bereiche der Chemie in derartigen Lehrbuchern vorzu
stellen. Die Reihe richtet sich auch an Studenten anderer
Naturwissenschaften, die an einer exemplarischen Darstel
lung der Chemie interessiert sind.
Leitfaden der Elektrochemie
Von Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Holze
Technische Universitat Chemnitz
m
B. G. Teubner Stuttgart· Leipzig 1998
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Holze
Geboren 1954 In Hildesheim/Niedersachsen. Von 1973 bis 1979 Stu
dium der Chemie an der Universitat Bonn, Diplomarbeit Ober "Neue
Kathodenmaterialien fOr Lithiumbatterien" und 1983 Promotion mit dem
Thema "Impedanzmessungen an porosen Elektroden" bei Prof. Viel
stich, Bonn. Von 1983 bis 1984 Postdoctoral Fellow am Case Center for
Electrochemical Sciences der Case Western Reserve University in
Cleveland/USA bei Prof. E. Yeager als Stipendiat der Heinrich-Hertz
Stiftung. Von 1984 bis 1987 wiss. Assistent am Institut fOr Physikalische
Chemie der Universitat Bonn. 1987 Hochschulassistent, 1989 Habilita
tion fOr das Fach "Physikalische Chemie" und 1991 Hochschuldozent im
Fachbereich Chemie der Universitat Oldenburg. Seit 1993 Professor fOr
Physikalische Chemie/Elektrochemie an der Technischen Universitat
Chemnitz.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Holze, Rudolf:
Leitfaden der Elektrochemie / von Rudolf Holze. - Stuttgart; Leipzig
: Teubner, 1998
(Teubner-StudienbOcher: Chemie)
ISBN-13: 978-3-519-03547-3 e-ISBN-13: 978-3-322-80122-7
DOl: 10.1007/978-3-322-80122-7
Das Werk einschlieB1ich alier seiner Teile ist urheberrechtlich geschOtzt. Jede
Verwertung auBerhalb derengen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Veri ages unzulassig und strafbar. Das gilt besonders fOr
Vervielfaltigungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeiche
rung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 1998 B. G. Teubner Stuttgart· Leipzig
Vorwort
Elektrochemie ist eine auBerordentlich interdisziplinare Wissenschaft im Be
riihrungsfeld von Chemie, Physik, Werkstoffwissenschaft, Biologie und zahlrei
chen anderen technisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen. In beispielhafter
Weise vereinigen sich grundlagenorientierte und anwendungsbezogene Aspekte.
Kaum eine elektrochemische experimentelle Arbeit ist ohne einen zumindest
mittelbaren Bezug zu einem praktischen Verfahren. Die Anwendungen reichen
von in groBem Umfang eingesetzten elektrochemischen Produktionsverfahren
iiber die aus der technischen Welt nicht mehr wegzudenkenden elektrochemi
schen Energiespeicher bis zur Ultraspurenanalytik und Sensorik. Diese groBe
und allgemeine Bedeutung rechtfertigt eine angemessene Darstellung im Chemie
studium.
Elektrochemie wird daher im Studium bereits in den ersten Semestern in Vor
lesungen der organischen, anorganischen und physikalischen Chemie angespro
chen. Die vielseitigen Wege der Annaherung und unterschiedlichen Wichtungen
von Grundlagen, Methoden oder Anwendungen lassen ordnende Konzepte und
gemeinsame Grundlagen nicht immer mit der notigen Klarheit erkennen. Diese
Liicke wird mit dies em kompakten Leitfaden geschlossen. Anders als umfassen
de Lehrbiicher der physikalische Chemie, die zahlreiche Aspekte der Elektro
chemie mit unterschiedlicher Intensitat behandeln, wird hier ein Uberblick
gegeben, der Grundlegendes und Typisches hervorhebt. Dabei geht der Bezug
zu den zahlreichen Feldern der Anwendung elektrochemischer Konzepte und
Methoden deutIich hervor. Dies fiihrt zu einem tieferen Verstandnis der E1ektro
chemie und erleichtert den Zugang zu intensiver Beschaftigung mit ihr. Daher
wird in diesem Leitfaden immer wieder anschlieBend an die Darstellung der
Grundlagen, Theorien und Modelle die Anwendung beschrieben. Auch dies ist
ein wichtiger, das tiefere Verstandnis erleichternder Unterschied zu umfassen
den Lehrbiichern. Diese unmittelbare Verkniipfung erlaubt die rasche Uberprii
fung des zuvor erworbenen theoretischen Wissens an praktischen Fragestellun
gen. Dabei konnen im begrenzten Umfang eines Leitfadens natiirlich nicht aile
theoretischen wie praktischen Aspekte vollstandig und mit gleicher Intensitat
behandeIt werden. Trotzdem ist der Uberblick so vollstandig, daB von diesem
Buch ausgehend der Zugang zu allen Feldern der Elektrochemie erfolgverspre
chend moglich ist. Die bestehende Liicke zwischen allgemeinen Lehrbiichern
einerseits und der Fachliteratur andererseits solI so geschlossen werden.
Das vorliegende Buch ist aus einer Vorlesung hervorgegangen, in der Studieren
de im Grundstudium der Chemie einen Uberblick iiber die wichtigsten Aspekte
6 Vorwort
der Elektrochemie erhalten sollen. Dabei stehen die Vollstandigkeit und die Er
schlieBung des Arbeitsgebietes im V ordergrund, manche Details der Grundlagen
wie der experimentellen Methoden und technischen Anwendungen konnen im
knappen Umfang nicht uberall beriicksichtigt werden. Die naheliegende Idee,
am Ende der Kapitel Hinweise aufLehrbucher, Monographien und Ubersichtsar
tikel zu geben, die einen weitergehenden Einblick erlauben, muBte recht rasch
verworfen werden. Da sich das Buch an einen sehr heterogenen Leserkreis richt
et, ist es schlicht unmoglich, solche Hinweise in auch nur annahemd allgemein
gultiger und fur jeden Leser und jede Leserin in gleich guter Weise und verwert
barer Form zu geben. Die in Zukunft eher noch knapper werdenden Biblio
theksmittel lassen hier kaum Besserung erhoffen. Andererseits ist es in praktisch
jeder Bibliothek moglich, mit Hilfe "elektronischer Kataloge" einen raschen Zu
gang zu den vorhandenen Buchem und Zeitschriften zu gewinnen. Hiermit
durfte das Auffinden weiterfuhrender Literatur auch in sehr speziellen Fallen
keine Schwierigkeit bereiten. Zum Einstieg in eine solche Literatursuche sind
am Ende jedes Kapitels Stich- und Schlagworte genannt, die entsprechend
einschlagigen Systematiken zuverlassig zum Erfolg fuhren. Diesem Zweck dient
auch das umfangreiche Register, das in vielen Fallen nicht nur das rasche Auf
finden wichtiger Definitionen, Gesetze und gangiger Begriffe erlaubt, sondem
auch die Verbindung zu entsprechenden experimentellen Techniken und prakti
schen Anwendungen herstellt. Fur den an umfassenden Lehrbuchem zum Ge
samtgebiet der Elektrochemie wie zu wichtigen Teilgebieten Interessierten gibt
folgende Ubersicht einige Anregungen:
J.O'M. Bockris und A.K.N. Reddy, Modern Electrochemistry, Plenum Press,
1972
J. Koryta, Lehrbuch der Elektrochemie, Springer Verlag, 1976
C.H. Hamann und W. Vielstich, Elektrochemie, VCH-Wiley Verlag, 1998
E. Zimgiebl, Einfohrung in die Angewandte Elektrochemie, Salle Verlag, 1993
W. Schmickler, Grundlagen der Elektrochemie, Vieweg Verlag, 1996
D. T. Sawyer, Electrochemistry for Chemists, John Wiley & Sons, 1995
Organic Electrochemistry: An Introduction and a Guide, H. Lund und
M.M. Baizer Hrsg., Marcel Dekker, 1991
Symbole und Achsenbeschriftungen sind nach den Empfehlungen der IUP AC
(Pure Appl. Chern. 37 (1974) 499) ausgefuhrt. Dies wird im Vergleich zu ande
ren, vor aHem alteren Lehrbiichem, moglicherweise zu Verwirrung ftihren. Das
ausfuhrliche Symbolverzeichnis (S. 299) soli hier weiterhelfen. Dimensionen
sind dabei durch einen Schragstrich von der zugehOrigen Zahl getrennt, nur in
Ausnahmen wird der besseren Ubersicht halber die Dimension in eckigen
Klammem angegeben. Das Buch ware ohne die Hilfe zahlreicher Mitarbeiter
und Freunde nicht entstanden. Fur experimentelle Daten und praktische Hinwei
se auf Details danke ich V. Brandl, M. Bron, S. Kania, J.Lippe, W. Leyffer, K.
Oehlschlager, M. Probstund P. Roland.
Inhalt
Eine Einfiihrung: Zwei Metallbleche, eine L6sung und
eine Stromquelle .................................................................................... 9
2 Elektrochemie im Gleichgewicht: lonen und Elektroden ....................... 14
2.1 Aktivitaten von lonen in Lasung, das elektrochemische Potential .......... 14
2.2 Die Debye-Huckel-Theorie ................................................................... 23
2.3 Potentiale und Strukturen an Phasengrenzen:
Nemst-Gleichung und Doppelschicht ................................................... 33
2.4 Elektroden ........................................................................................... 50
2.5 Elektrochemische Analytik: Ionenselektive Elektroden ........................ 57
2.6 Einfache Anwendungen: Potentiometrie,
Aktivitatsbestimmungen ...................................................................... 67
2.7 Elektrochemische Zellen ...................................................................... 76
2.8 Elektrochemie und Thermodynamik, die Spannungsreihe ..................... 86
2.9 Elektrochemische Energiespeicher: Batterien,
Akkum ulatoren und Brennstoffzellen ................................................. .1 00
3 Stoffiransport und elektrochemische Kinetik ...................................... .126
3.1 lonenwanderung im elektrischen F eld und elektrolytische
Leitfahigkeit ....................................................................................... 128
3.2 Eine Anwendung: Konduktometrie .................................................... .144
3.3 Stoffbilanzen elektrochemischer Prozesse ........................................... 151
3.4 Struktur und Dynamik elektrochemischer Phasengrenzen .................... 153
3.4.1 Teilschritte elektrochemischer Prozesse: die Uberspannungen ............ .153
3.4.2 Der Ladungsdurchtritt: die Butler-Volmer-Gleichung und
die Durchtrittsuberspannung ............................................................... 15 8
3.4.3 Die Konzentrationsiiberspannung ........................................................1 69
3.4.4 Die Adsorptionsiiberspannung ............................................................ 174
3.4.5 Die Kristallisationsuberspannung ........................................................ 178
3.4.6 Elektrokatalyse ................................................................................... 183
3.5 Korrosion ........................................................................................... 185
3.6 Technische Elektrochemie .................................................................. 202
3.7 Elektrochemische Analytik ................................................................. 217
8 Inhalt
4 Methoden der experimentellen Elektrochemie .................................... 224
4.1 Stationiire Methoden: Messung bei konstantem Potential
oder Strom ......................................................................................... 228
4.2 Quasistationiire Methoden .................................................................. 239
4.3 Instationiire Methoden ........................................................................ 264
4.4 Nichtklassische Methoden: Oberfliichenanalytik,
Spektroskopie .................................................................................... .274
Liste der Symbole und Abkiirzungen .................................................. 299
Register ............................................................................................. 307
1 Eine Einfiihrung: Zwei Metallbleche,
eine Losung und eine Stromquelle
Elektrochemie ist als ein an zahlreiche naturwissenschaftliche Arbeitsgebiet
(Chemie, Physik, Biologie, Materialkunde, Medizin) angrenzendes, sehr inter
disziplinares Arbeitsgebiet schwer mit einer knappen Definition zu beschreiben.
In der klassischen Darstellung der Elektrochemie als der Lehre von der Bezie
hung zwischen elektrischen und chemischen Prozessen oder der Vorstellung als
physikalischer Chemie unter Beteiligung geladener Teilchen (Ionen) werden die
vielseitigen Aspekte, die tiber das Auftreten und die besonderen Eigenschaften
von lonen hinausgehen, nicht deutlich. Bezeichnet man Elektrochemie als die
Wissenschaft von Elektronentibertragungsreaktionen vor allem an Phasengren
zen (FestkorperlFltissigkeit, Membran, Zellwand, FestkorperlFestkorper, nicht
mischbare Fltissigkeit), so kommt man der groBen Vielseitigkeit dieses Gebietes
naher.
Anschaulicher ist dagegen die Betrachtung der Resultate einer Reihe einfacher
Experimente, die mit elektrochemischen Phanomenen, Methoden und Modellen
vertraut machen.
Ais experimentelle Anordnung wird ein GlasgefaB mit einer wiillrigen Losung
eines Salzes oder einer Saure verwandt, in das zwei Metallbleche eintauchen.
Bild 1.1 MeBanordnung fiir einfache elektrochemische Versuche.
Sie sind entsprechend Bild 1.1 mit einer auBeren einstellbaren Spannungsquelle
(Batterie) verbunden. Die an den Blechen anliegende elektrische Spannung und
10 1 Einflihrung
der flieBende Strom werden mit Volt-und Milliamperemeter gemessen.
Werden zwei Platinbleche und als Fliissigkeit reinstes Wasser verwendet, so
registriert man bei einer angelegten Spannung von ca. 1 - 2 Volt einen auBerst
geringen Strom, der kurze Zeit nach dem Einschalten praktisch verschwindet.
Da im Wasser freie Elektronen nur eine auBerst geringe Lebensdauer haben,
muB der StromfluB auf anderen beweglichen Ladungstragern beruhen. Nach der
Eigendissoziation des Wassers gemiiB
(1.1)
ist eine sehr kleine Konzentration von Protonen und Hydroxidionen (in jeweils
hydratisierter Form) vorhanden, die den Strom transportiert.
Wenn in der Fliissigkeit Salzsaure gelost ist, so beobachtet man einen wesentlich
groBeren Strom als im ersten Experiment. Die Leitfahigkeit einer Losung hangt
offenbar von der Konzentration der darin gelosten lonen abo Bei Salzsaure kann
angenommen werden, daB sie als starke Saure voI1ig in lonen dissoziiert ist.
Man bezeichnet allgemein Stoffe, die in geladene Tei1chen (Ionen) zerfallen
(dissoziieren) konnen (z.B. Salz- oder Essigsaure) oder die bereits im festen
Zustand in lonenform vorliegen (Natriumchlorid), als Elektrolyte. Sprachlich
etwas ungenau werden Losungen so1cher Elektrolyte in einem Losungsmittel
ebenfalls oft als Elektrolyte und nicht priiziser als Elektrolytlosung bezeichnet.
Uber die erhOhte Leitfahigkeit hinaus beobachten wir an den beiden Platinble
chen weitere Veranderungen. Dies steht im Gegensatz zur Erfahrung, daB ein
metallischer elektrischer Leiter sich unter Strom fluB, abgesehen von einer gerin
gen Erwarmung bei groBeren Stromstiirken, nicht verandert. An beiden BIechen,
die wir als Elektroden bezeichnen wollen, wird eine Gasentwicklung beobachtet,
deren Intensitat mit gesteigerter Stromstiirke zunimmt. An der mit dem Pluspol
der auBeren Stromquelle verbundenen Elektrode ist Chlorgeruch wahrnehmbar;
das an der anderen Elektrode entwickelte Gas kann mit der Knallgasprobe als
Wasserstoff identifiziert werden. Wahrend an der ersten Elektrode (am Pluspol)
eine Oxidation gemiiB
(1.2)
ablaufi (diese Elektrode wird Anode genannt), bildet sich an der anderen
Elektrode in einer Reduktion Wasserstoffnach
(1.3)
die Elektrode heiBt Kathode. Der Begriff "Elektrode" wie auch die Bezeichnun
gen der beiden Elektroden als "Anode" und "Kathode" gehen auf Michael Fara
day zurUck. Die Zellreaktion, mit der der Elektrochemiker das gesamte Gesche-