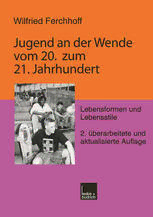Table Of ContentWilfried Ferchhoff
Jugend an der Wende
vom 20. zum 21. Jahrhundert
Wilfried Ferchhoff
Jugend an der Wende
vom 20. zum 21. Jahrhundert
Lebensformen und Lebensstile
2., überarbeitete und aktualisierte Auflage
Leske + Budrich, Opladen 1999
Gedruckt auf säurefreiem und altersbeständigem Papier.
ISBN 978-3-8100-2351-3 ISBN 978-3-322-95187-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95187-8
© 1999 Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlieh geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorwort
In der redaktionellen Bearbeitung und insbesondere in der technischen Aus
gestaltung des Bandes unterstützte mich Sven Kommer. Ihm sei für seine en
gagierte Mitarbeit gedankt.
Bielefeld, im August 1993 Wilfried Ferchhoff
Vorwort zur überarbeiteten, 2. Auflage
Seit der ersten Auflage dieses Buches (1993) sind inzwischen fast sechs Jahre
vergangen. In diesem Zeitraum haben sich die jugendkulturellen Stilbildun
gen und Szenen gegenüber denen Anfang der 90er Jahre zum Teil beträcht
lich verändert. Neue Jugendszenen sind entstanden, alte haben sich ausdiffe
renziert und viele Jugendstile und -szenen vermischen sich mittlerweile -sind
in der Regel .nicht mehr so strikt gegeneinander abgegrenzt. Deshalb ist es
auch notwendig, die jugendkulturellen Entwicklungen und Ambivalenzen an
der Wende zum 2l. Jahrhundert neu zu justieren, die freilich auch die gesell
schaftlich-soziologischen Rahmungen, Einbettungen und Verweisungszu
sammenhänge vornehmlich der Individualisierung, Pluralisierung, Differen
zierung, Mediatisierung, Kommerzialisierung und Globalisierung einschlie
ßen.
Ich habe zwar in den Grundzügen die Tektonik der ersten Auflage beibehal
ten, dennoch mußte das gesamte Buch - die empirisch belegten jugendkultu
rellen Neuerungen aufnehmend - an vielen Stellen überarbeitet, ergänzt und
verändert werden.
Bielefeld, im Dezember 1998 Wilfried Ferchhoff
5
Inhalt
Einleitung ....................................................................................................... 9
1. Vom Wandervogel zu den heutigen postalternativen Jugendkulturen.
Kontinuität im Wandel von Jugendkulturkonzeptionen ....................... 21
2. Veränderte Strukturen sozialer Ungleichheit. Gesellschaftliche
Globalisierung und Individualisierung - Segen oder Fluch? ............... .49
3. Zur Differenzierung des Jugendbegriffs ............................................... 67
4. Entwicklungs- und Lebensbewältigungsaufgaben von Jugendlichen
neu definiert -ein anderes Verständnis von (Patchwork)Identität.. ...... 77
5. Pauschale Jugendbilder und epochale Generationsgestalten ................. 85
6. Jugendgenerationen in der Bundesrepublik Deutschland -revisited .... 95
7. Jugendkulturelle Stile und Szenen vor der Jahrtausendwende ............ 115
8. Idealisierung und Individualisierung von Jugend am Beispiel
Mode und Sport ................................................................................... 151
9. Aufwachsen heute: Veränderte Erziehungs- und
Sozialisationsbedingungen in Familie, Schule,
Beruf, Freizeit und Gleichaltrigengruppe ............................................ 173
9.1 Jugend ist im ambivalenten Sinne individualisierte Jugend ................ 181
9.2 Jugend ist Schul-und Bildungsjugend ................................................ 183
9.3 Jugend ist arbeitsfeme Jugend ............................................................ 194
9.4 Jugend ist Gegenwartsjugend .............................................................. 200
9.5 Jugend ist Leitbild-und Expertenjugend ............................................ 202
9.6 Jugend ist Kaufkraft- und Konsumjugend .......................................... 205
9.7 Jugend ist alltagskulturell vermittelte Jugendkulturjugend ................. 208
9.8 Jugend ist alltagspragmatisch familiale Versorgungs- und
umsorgte Mutterjugend ....................................................................... 210
9.9 Jugend ist eine in Partnerschaften und familialen
Zusammenhängen emotional aufgeladene und psychosoziale
Nutzenfunktionen gewinnende Jugend ................................................ 213
9.10 Jugend ist Gleichaltrigenjugend .......................................................... 216
9.11 Jugend ist weibliche und männliche, aber auch androgyne Jugend ..... 220
9.12 Jugend ist sexuelle Jugend .................................................................. 222
9.13 Jugend ist auf Autonomie zielende liberalisierte, aber auch permissive
(Erziehungs )Jugend .............................................................................. 224
7
9.14 Jugend ist Multi-Media-Jugend ........................................................... 227
9.15 Jugend ist Patchworkjugend ................................................................ 238
9.16 Jugend ist nicht nur sprachlose Jugend ............................................... 240
9.17 Jugend ist ego- und ethnozentrische Jugend ........................................ 241
9.18 Jugend ist eine jugendpolitisch vergessene Jugend ............................. 242
9.19 Jugend ist (was die konventionelle Politik betrifft) parteien-, z.T
auch politikverdrossen, aber dennoch keine politikabstinente
Jugend .................................................................................................. 244
10. Jugendkulturelle Lebensmilieus ........................................................... 249
10.1 Religiös-Spirituelle .............................................................................. 252
10.2 Kritisch-Engagierte .............................................................................. 261
10.3 Körper- und Action-Orientierte ........................................................... 265
10.4 Manieristisch-Postalternative ............................................................... 269
10.5 Institutionell-Integrierte ....................................................................... 277
10.6 Milieu-und Szenenvermischungen ..................................................... 280
11. Pädagogische Herausforderungen. Antworten und Konsequenzen
in Schule und Jugendarbeit ................................................................. 283
11.1 Veränderungen der Jugendbilder in der Jugendarbeit ......................... 295
11.2 Die LebensverhäItnisse und -bedingungen von Pädagogen und
Pädagoginnen in Schule und Jugendarbeit sind andere als die
ihrer Adressaten. Eine unhinterfragte Gleichstellung
steht mindestens unter Ideologieverdacht ............................................ 297
11.3 Zur Unstimmigkeit des pädagogischen Outfits und Habitus' ............. 298
11.4 Zur Ambivalenz und zum Pluralismus von Jugendbildern
in der Jugendarbeit. .............................................................................. 298
11.5 Der Weg von den formellen Mitgliedschaften zu den informellen
Beziehungen. Die Abkehr von institutionalisierten pädagogischen
Arrangements trifft auch die Jugendarbeit.. ......................................... 299
11.6 Das vergleichsweise biedere pädagogische Ambiente der
Jugendarbeit gegenüber der stilistisch ausdrucksstarken
kommerzialisierten Freizeitindustrie .................................................... 300
11.7 Die Chancen einer neuen pädagogischen Professionalität... ................ 302
11.8 Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule. Möglichkeiten
und Grenzen ......................................................................................... 306
Literatur ....................................................................................................... 309
8
Einleitung
In diesem Buch geht es darum, das Aufwachsen von Jugendlichen in der
Bundesrepublik Deutschland und den Strukturwandel der Jugendphase auf
der Basis der veränderten Lebensbedingungen im ausgehenden 20. und an
der Wende zum 21 Jahrhundert vornehmlich im Kontext sozialhistorischer
und sozialwissenschaftlicher Fragestellungen und Perspektiven zu rekonstru
ieren.
Zu den veränderten Lebensbedingungen, die zunächst nur stichwortartig
benannt, später dann im einzelnen sozialstruktureIl und alltagsphänomeno
logisch ausgefächert und in ihrer Mehrdeutigkeit analysiert werden sollen,
gehören vor allem folgende, kaum unfreundlich klingende mehrperspekti
visch-vieldimensionale und ambivalente Entwicklungsprozesse: Globalisie
rung, Enttraditionalisierung, Neoliberalismus und Individualisierung wurden
und werden immer wieder als die zentralen epochalen sozialstrukturellen
Prozesse und catch all terms genannt, die die "Grundlagen fur die Verände
rung des Zusammenlebens in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen" bil
den sollen (Beck 1997, S. 32). Hinzu kommen freilich weitere: Enträumli
chung, Beschleunigung, Technisierung, Automatisierung, Digitalisierung,
Virtualisierung und Ästhetisierung des Alltags, wachsende Partikularisierung
von Lebensbereichen, neue Zeit- und Lebensrhythmen durch Mobilitätsan
forderungen, Verkürzung der Arbeitszeiten, Zunahme der Freizeit, aber auch
Zeitnot, Hektik und Streß, wachsende Verkehrs- und Kommunikationsdichte,
Entsinnlichung, Expansion und Differenzierung der Waren- und Kon
summärkte, Deregulierung und Flexibilisierung, Mediatisierung, Virtualisie
rung, Differenz, Vielheit auch jenseits von Einheit, Internationalisierung,
Verwissenschaftlichung und Kommerzialisierung von Alltagserfahrungen,
Entinstitutionalisierung von Lebenslaufubergängen, Enttraditionalisierung,
Entritualisierung und Entkonventionalisierung von Werten, Normen und Le
bensmilieus, Aufweichung traditioneller sozio-kultureller Kollektive, Ortlo
sigkeit von Gemeinschaft, Arbeit und Kapital, Fragilität der sozialen Bezie
hungen, pluralisierte und individualisierte Lebensformen u.v.m.
Der ambivalenten Globalisierung und Individualisierung und damit auch
der Pluralisierung und Differenzierung von Lebensbedingungen, Lebensla
gen, Lebensformen und Lebensstilen wird am ehesten ein erfahrungsgesättig
tes, anschauliches Forschungsdesign gerecht, das zu Beginn des Forschungs
prozesses mit möglichst unvoreingenommenen und dennoch kontrollierten
sogenannten "sensitizing concepts" in das Untersuchungs feld eintaucht, um
sich zunächst orientierend, entdeckend, ohne eindeutig fixiertes, allerdings
offenes Konzept, aber hellwach und mehrdimensional auf induktivem Wege
9
eine dem Gegenstand angemessene Theorie- und Hypothesenbildung bin
nenperspektivisch verstehend erschließt. Dies kann selbstverständlich nur in
der Logik und der Sprache der gesellschaftlichen Adressaten geschehen. Und
insofern hat sozialwissenschaftliehe Jugendforschung auch schon im Rahmen
ihrer Begriffiichkeiten die öffentlichen Erfahrungen auftusaugen. Eine sol
che alltagsweltorientierte, mit (auto-)biographischen, soziographischen, eth
nographischen und hermeneutischen Methoden ausgestattete qualitative V or
gehensweise interessiert sich auf der einen Seite für die subjektiven Äuße
rungen, Selbstdeutungen, Interpretationen und Selbstzeugnisse der Heran
wachsenden. Auf der anderen Seite geht es darum, die subjektiv erlebten All
tage von Jugendlichen als Selbstgestaltungsprozesse - auch Kinder und Ju
gendliche sind in gewissen Grenzen ganz im interaktionistischen Sinne frei
lich im Medium von institutionalisierten Vorgaben Konstrukteure ihrer eige
nen Biographien - im Zusammenhang historischer und sozialer Bedingungs
konstellationen zu betrachten. Es geht also um die Berücksichtigung der ver
schiedenen Lebensverhältnisse und um die subjektiv differenten Verarbei
tungsformen mit den gesellschaftlich und institutionell vorstrukturierten Er
wartungshaltungen und Anforderungen, die wiederum abhängig sind von den
jeweils lebensgeschichtlich und sozial erworbenen Ressourcen (Luger 1991,
S.68).
Es gilt somit, unter sozialisationstheoretischen Gesichtspunkten auf ver
schiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Perspektiven die vielen Ver
heißungen und Glücksversprechen sowie die individuellen Wahlmöglichkei
ten und Chancen unserer, mit vielen unterschiedlichen Begriffiichkeiten
skizzierten (post)modemen, erlebnisorientierten und individualisierten Ar
beitsgesellschaft (vgl. Ferchhoff;tNeubauer 1997) gleichzeitig mit den Kehr
seiten und Risiken des Scheitems im Hinblick auf das Aufwachsen von Ju
gendlichen in Familie, Schule, Beruf, Freizeit und Gleichaltrigengruppe in
den Blick zu nehmen. Obgleich es an einer soziologischen "Präzisienmg" des
recht unscharfen und vieldeutigen Individualisierungs- und gleichsam auch
des Globalisierungsbegriffs sowie an einer "empirischen Evidenz" der bei den
Ansätze mangeln soll, so daß erhebliche Vorbehalte, Einwände und auch
Widerlegungen der Kritiker im Zusammenhang des zuweilen modischen Ge
brauchs solcher catch-all-terms formuliert worden sind (so etwa Burkart
1993, S. 159ff.; Geyer 1998; Beck 1997d), möchte ich dennoch mit den Pro
tagonisten der Individualisierungsdiskussion der letzten 15 Jahre an den zen
tralen Einsichten der sehr differenziert und im Medium von Globalisierungs
prozessen zu betrachtenden Individualisierungs theorie festhalten, die mehr
als messianische, soziologisch-vulgärexistentialistische Ich-Mythologie und
Erklärungsrhetorik beanspruchen.
Die Grundthese lautet: Die individualisierte Gesellschaft produziert Zu
wächse und Ansprüche (Autonomie, Freiheit, Selbstentfaltung, Sinnerflil
lung, Gerechtigkeit) und erschwert gleichzeitig ihre Verwirklichung. Indivi-
10
dualisierung meint sowohl die Aufweichung, ja sogar die Auflösung als auch
die "Ablösung industrie gesellschaftlicher Lebensformen durch andere, in de
nen die einzelnen ihre durchaus globalisierte Biographie im Zentrum des ei
genen Lebens selbst herstellen, inszenieren, zusammen schustern müssen, und
zwar ohne die einige basale Fraglosigkeit sichernden, stabilen sozial-morali
schen Milieus, die es durch die gesamte Industriemoderne hindurch immer
gegeben hat und als Auslaufmodelle immer noch gibt" (Beck/Beck-Gerns
heim 1993, S. 179). Hinzu kommt, daß Individualisierung und Globalisie
rung nicht als Neuauflagen eines neo liberalistischen Programms mißverstan
den werden sollten (Beck 1997d, S. 13ff.; 1998, S. 52) und so gesehen mit
der Individualisierung und Globalisierung der Gesellschaft nicht eine
"Auflösung, sondern immer eine Verschärfung sozialer Ungleichheit" ein
hergeht (Beck 1993; BecklBeck-Gernsheim 1994; Berger 1996). Es entsteht
jenseits der Fülle von individuellen Wahlmöglichkeiten, die allerdings nur
noch sehr begrenzt den handelnden Subjekten zuzurechnen sind (Habermas
1995, S. 4), in dieser, immer mehr vom Utilitarismus und globalisierten
Markt- und Medienprozessen sowie von weitverzweigten resp. verdichteten
anonymisierten und system ischen Verbindungen geprägten entraditionalisier
ten und entritualisierten Gesellschaft ein quasi struktureller und wiederum
gemeinschaftsbildender Zwang sich selbst zu verwirklichen - das Leben in
eigene Regie zu nehmen. Das Spezifische des Globalisierungsprozesses liegt
vor allem in der ,,Ausdehnung, Dichte und Stabilität wechselseitiger regio
nal-globalerBeziehungsnetzwerke und ihrer massenmedialen Selbstdefinition
sowie sozialer Räume und jener Bilder-Ströme auf kultureller, politischer,
wirtschaftlicher, militärischer und ökonomischer Ebene" (Beck 1997d, S.
31). Das alltägliche Ringen um das eigene Leben und Handeln über national
staatliche Grenzen hinweg "ist zur kollektiven Erfahrung der westlichen Welt
geworden" (Beck 1995, S. 9). Jeder muß sich nicht nur individuell behaupten
und durchsetzen, sondern auch noch in einer Art "vorbildlosen" Eigenver
antwortung und subjektiven Gewißheit seine individuelle Einzigartigkeit und
Unverwechselbarkeit stets selbstinszenierend unter Beweis stellen. Wir sind,
um mit Sartre zu sprechen, zur Individualisierung "verdammt". Es handelt
sich um einen "paradoxen Zwang" zur Selbstgestaltung und Selbstinszenie
rung der eigenen Bastelbiographie, auch via Medien, Konsum und Touristik
"ihrer transnationalen Einbindungen und Netzwerke" (BecklBeck-Gernsheim
1993, S. 179; Beck 1997d, S. 31) sowie ihrer "moralischen, sozialen und po
litischen Bindungen - allerdings: stets unter strukturellen sozialstaatlichen
Vorgaben wie Ausbildung, Arbeitsmarkt, Arbeits- und Sozialrecht" etc.
(Beck 1993; 1998). Nicht nur Freiheitsgewinn, sondern eine spannungsrei
che, konfliktreiche Mischung" "riskanter Freiheiten" (BecklBeck-Gernsheim
1993a; BecklBeck-Gernsheim 1994) scheint der biographische Grund- oder
Strukturtypus einer so verstandenen individualisierten Gesellschaft zu sein.
Die Risiken des Scheiterns sind zweifellos rur viele Menschen so groß, daß
11
ein derartig anspruchsvolles Lebenskonzept zumindest nicht von allen erfüllt
werden kann; statt dessen können nicht nur Irritationen, sondern auch Bela
stungen aller Art und GefUhle von Unsicherheit, Ohnmacht, Überforderung,
Hilflosigkeit und Entfremdung überhand nehmen.
Der Differenzierung, Pluralisierung, Individualisierung und Globalisie
rung von - in ihren schichtspezifischen und subkulturellen Zugehörigkeiten
und Grenzziehungen unbestimmbarer werdenden - jugendlichen Lebensla
gen, jugendkulturellen Milieuzusammensetzungen und Lebensstilen werden
nunmehr besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der Trend geht immer mehr
weg von den sozialmilieuspezijischen Jugendsubkulturen und hin zu den in
dividualitätsbezogenen Jugendkulturen (Ferchhoff 1990). Inzwischen schei
nen darüber hinaus im Anschluß an eine differenzierte Betrachtung des mitt
lerweile zerfaserten und immer imaginärer werdenden Jugendhegrifjs sowohl
der Verzicht auf verallgemeinerbare Generations- und Jugendbilder sich an
zudeuten als auch die traditionellen Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen
in Frage gestellt zu werden. Alle Versuche, die Jugend auf einen gemeinsa
men Nenner zu bringen, sind mindestens schwierig. Dies gilt zweifellos auch
fUr die ,,jugendlight Versionen Generation X, die 8ger oder ähnliche Unter
nehmungen" (Farin 1997b, S. 309).
Wer also im ausgehenden 20. Jahrhunderts ein Bild der Jugend zu schil
dern versucht, der kommt in einer sozialwissenschaftlich orientierten und in
terdisziplinär angelegten Forschungsperspektive nicht umhin, neben den
empirisch nachgewiesenen Veränderungen der Heranwachsenden im körper
lich-gesundheitlichen, seelisch-geistigen und sozialen Bereich und neben den
demographischen Veränderungen - die Jugend ist gesamtgesellschaftlich ge
sehen zu einer Minderheit geschrumpft und die unmttelbaren Kontakte der
Älteren gegenüber den Jüngeren nehmen immer mehr ab -, neben dem ver
änderten Aufwachsen und den gewandelten Lebenssituationen von Jugendli
chen der Vielfalt der kulturschöpferischen jugendlichen Lebensformen und
Lebensstile (neben Familie und Schule spielen Gleichaltrige, Freizeit, Me
dien, Musikkulturen, Konsum, Mode, Sportivität und vor allem die Transkul
turalität Anderer im eigenen Leben sowie die unausgrenzbare Multikulturali
tät hierbei eine ganz zentrale Rolle), aber auch der vielen, vor allem in den
Medien immer greller gezeichneten Problemkonstellationen (offene und ver
deckte Gewaltbereitschaft, auch Kriminalität, Familien-, Schul-, Leistungs-,
Konsumstreß etc., Gesundheitsrisiken und -gefahrdungen, Allergien, psycho
somatische Beschwerden und Verhaltensauffalligkeiten, Tabak-, Alkohol-,
Medikamenten-, anderer Drogenkonsum u.v.m.) von jugendkulturellen Le
bensmilieus Rechnung zu tragen.
Aber nicht nur die Jugendphase wird neu definiert, weil sie ihre traditio
nelle Gestalt und Selbstverständlichkeit als festumrissener und geregelter
Übergangsstatus in die Erwachsenengesellschaft eingebüßt hat, sondern auch
der (pädagogische) Umgang mit Jugendlichen in Familie, Schule und außer-
12