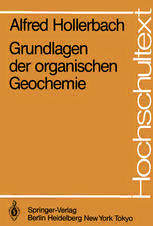Table Of ContentHochschultext
Alfred Hollerbach
Grundlagen
der organischen Geochemie
Mit 35 Abbildungen
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York Tokyo
Privatdozent Dr. Alfred Hollerbach
Institut fOr Erd61forschung
Walther-Nernst-Str. 7
0-3392 Clausthal-Zellerfeld
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek. Hollerbach, Alfred: Grundlagen der organi
schen Geochemie/Alfred Hollerbach. - Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer, 1985.
(Hochschultext)
ISBN-13: 978-3-540-15959-9 e-ISBN-13: 978-3-642-70824-4
DOl: 10.1007/978-3-642-70824-4
Das Werk ist urheberrechtlich geschOtzt. Die dadurch begrOndeten Rechte, insbesondere die
der Obersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der
Wiedergabe auf photomechanischem oder ahnlichem Wege und der Speicherung in Daten
verarbeitungsanlagen bleiben, auch beinur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Ver
gOtungsansprOche des § 54, Abs. 2 UrhG werden durch die "Verwertungsgesellschaft Wort",
MOnchen, wahrgenommen.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1985
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohrie besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB solche
Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden dOrften.
2152/3140-543210
Inhaltsverzeichnis
TEll A: BllDUNG VON ORGANISCHEM MATERIAL 1
A.!, Prabiotische Entstehung von organischem Material 2
A.2. Evolution der Biosphare 4
A.3. Photosythese 7
A.4. Chemosynthese 10
A.5. Zusammensetzung der Biomasse 11
A.6. Kohlenstoff-Kreislauf 13
A. 6.I. Aerobe Atmung 13
A. 6.2. Anaerobe Dissimilation 14
A. 6.3. Anaerobe Atmung 14
A.6.4. Aufbau und Abbau der organischen Substanz 15
A. 6.5. Primarproduktion und Massenbilanzen 16
A. 7. Isotopengeochemie des Kohlenstoffs 20
TEll B: SEDIMENTATION UNO AKKUMUlATION VON ORGANISCHEM MATERIAL 23
B.!. Bildung von Sedimenten 24
B. 2. Organisches Material in aquatischen Systemen 25
B. 3. Terrestrische organische Ablagerungen 27
TEll C: DIAGENESE DES ORGANISCHEN MATERIALS 29
C. I. Biogeochemischer Abbau 29
C. 2. Organische Substanzen in rezenten Sedimenten 32
C. 2. I. lipidahnliche Stoffe 33
C.2.I.1. Kohlenwasserstoffe 33
C.2.I.2. Alkohole, Cabonsauren, Ester und Ketone 42
C.2.I.3. Terpenoide Verbindungen 51
C. 2.2. Chlorophyll 71
C. 2.3. Kohlenhydrate 74
C.2.4. Aminosauren und Protein~ 77
C.2.5. Bildung von Huminstoffen 80
VII
TElL D: INKOHLUNG DER ORGANISCHEN SU~STANZ 89
D.l. Kerogenbildung 89
D.l.l. Geothermische Umwandlung des Kerogens 91
D. 2. Abbauprodukte des Kerogens 95
D.2.1. Neubildung von Bitumen 97
D.2.2. Aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe 98
D. 2.3. Terpenoide Kohlenwasserstoffe 102
D. 2.4. Heterokomponenten 110
D. 2.5. Porphyrine 114
D.2. 6. LeichtflUchtige organische Verbindungen 116
D. 3. Ul- und Gasbildung 118
D. 3.1. Geochemie des Erdols 121
D. 3.2. Teersande und Schwerole 124
D. 4. Ulschiefer 125
D. 5. Geochemie der Kohlen 126
D. 5.1. Kohlenbildung 127
D. 5.2. Inkohlungsreihe 128
D. 5.3. Kohlenmacerale 130
D. 5.4. Chemischer Aufbau 131
D. 5.5. Bitumen 132
D.5.6. Kohlenwasserstoffe 134
D. 5.7. Heteroverbindungen 144
D. 6. Geochemische lnkohlungsparameter 146
TElL E: ANWENDUNGSGEBIETE DER ORGANlSCHEN GEOCHEMlE 151
AUSGEW~HLTE
E.l. Umweltchemie 151
E.l.l. Kohle, Erdol, Erdgas 152
E. 2. Erdolexploration 156
E.2.1. Identifizierun9 von Muttergesteinen 156
E. 2.2. Reifegradbestimmung des organischen Materials 157
E.2.3. Korrelation von Erdolen und Sedimenten 160
E. 3. Biodegradation von Ulen 162
E. 4. Fazielle EinflUsse auf die Diagenese organischer
Subs tan zen 167
E. 5. Phylogenetische und molekularpalaontologische
Aspekte von Chemofossilien 169
E. 6. Geochronologie mit Hilfe von Aminosauren 170
OBERSlCHTSLlTERATUR 173
GLOSSARlUM 182
SACHVERZElCHNlS 187
Vorwort
Dieses Buch soll Grundkenntnisse in der organischen Geochemie vermitteln.
Deshalb ist es in erster Linie fUr fortgeschrittene Studenten aus dem
Bereich der Geowissenschaften geschrieben, die sich auf diesem Gebiet
einarbeiten wollen. Es soll somit al.s Grundlage fUr die inzwischen um
fangreiche weiterfUhrende Literatur dienen. Gewisse Grundkenntnisse Uber
organische Verbindungen mUssen vorausgesetzt werden. Die organische Gea
chemie hat sich mittlerweile zu einem eigenstandigen Teilgebiet der Geo
chemie entwickelt und befaBt sich mit dem Schicksal der organischen Sub
stanz und der sie aufbauenden chemischen Verbindungen in der Geosphare.
Der Aufbau des Buches ist so gestaltet, daB nach einem kurzen AbriB Uber
die Bildung und Sedimentation von organischem Material, die Prozesse der
Di agenese und Inkohl ung behandel t werden. Di e Di agenese organi scher Sub
stanzen verlauft weitgehend im rezenten und subrezenten Bereich, wahrend
die Inkohlung mit der gleichzeitigen Fossilisierung und Bildung von Erd-
01 und Kahle zusammenfallt. SchlieBlich folgen einige ausgewahlte Kapi
tel aus einigen mittlerweile etablierten Anwendungsbereichen der orga
nischen Geachemie.
Dieses Buch ist aus einem Vorlesungszyklus entstanden, den ich seit 1973
an der Rhein-Westf. Technischen Hochschule Aachen halte. In diesem Zu
sammenhang sei Herrn Professor Dr. D.H. Welte recht herzlich dafUr ge
dankt, daB er mit groBer Geduld mein Interesse auf das bislang wenig
bekannte Gebiet der organischen Geochemie gelenkt und mir groBe Unter
stUtzung gewahrt hat. Ferner war Frau E.-G. Wiese bei der endgUltigen
Fertigstellung des Manuskriptes sehr engagiert. Frau C. Kutzmutz und
Frau B. Palakci haben die Zeichnungen angefertigt. Herr Dr. G. Remberg
hat schlieBlich durch seine kritische Durchsicht geholfen, die Fehler
in Text und Formeln zu minimieren. Ihnen allen gilt mein Dank.
Teil A: Bildung von organischem Material
Organisches Material besteht zum groBten Teil aus Verbindungen des
Kohlenstoffes, der aufgrund seines besonderen atomaren Aufbaues in der
Lage ist, mit sich selbst VerknUpfungen herzustellen. Als eine weitere
Besonderheit kommt hinzu, daB die homoopolaren Kohlenstoffbindungen ver
schiedene raumliche Vorzugsrichtungen aufweisen. Aus diesen Gegebenhei
ten laBt sich die Vielfalt und Variationsbreite der organischen Mole
kUle und damit der organischen Chemie erklaren. Deshalb besteht das or
ganische ,Leben aus den chemischen Reaktionswegen des Kohlenstoffes und
seiner nachst~n Nachbarn Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, unter Ein
beziehung des Wasserstoffes. Ferner laufen die organisch-chemischen Re
aktionen bei relativ niedrigen Temperaturen abo Deshalb ist das gebil
dete organische Material thermolabil und weist eine geringe Resistenz
gegenUber thermischen Beanspruchungen von Uber 80° C auf.
Man kann unzweifelhaft davon ausgehen, daB die Hauptmasse des heutzu
tage gebildeten organischen Materials von pflanzlichen Organismen ab
stammt. Deshalb ist die Photosynthese als der bedeutendste
~ologische
ProzeB zur Erzeugung von reduzierten Kohlenstoff-Verbindungen anzusehen.
Die "Erfindung" der Photosynthese ist mindestens 2 bis 2,5 Milliarden
Jahre alt und stand schon den sehr alten ("primitiven") Organismen zur
VerfUgung, die diesen komplizierten photochemischen ProzeB in etwa ei
nem Zeitraum von 1 Mrd. Jahren entwickelt haben mUssen.
Mit der Entwicklung der Photosynthese ist eine Evolution von photosyn
thetischen Organismen aus den nicht photosynthetischen Organismen ein
hergegangen. Die ersten einfachen lebenden Systeme konnen sich nach dem
heutigen Verstandnis nur aus organischem Material entwickelt haben, das
auf abiotischem Wege im Rahmen einer chemischen Evolution der Kohlen
stoff-MolekUle vorher zur VerfUgung stand. Der biologischen Evolution
muB also eine differenzierte chemische Evolution vorausgegangen sein,
wobei letztere in Form der biochemischen Evolution weitergefUhrt wur
de.
z
A.l. Pr~biotische Entstehung von organischem Material
Ober die Entstehung von abiologisch gebildeten organischen MolekUlen
und Bildung von organischen "Aggregaten" ~uf der primordialen Erde vor
etwa 4 Mrd. Jahren laBt sich nur spekulieren, da keine direkten Zeug
nisse erhalten sind. Allerdings erhalt man aus Laborexperimenten gewisse
Hinweise. Man kann annehmen, daB die prabiotische Synthese organischer
Substanzen, die ja reduzierte Kohlenstoffverbindungen darstellen mUssen,
nur unter mehroder weniger reduzierenden Bedingungen moglich war. Fer
ner lassen sich dazu als auBere Energiequellen elektrische Entladungen,
ultraviolette und radioaktive Strahlungen und thermische EinflUsse dis
kutieren.
Aus den verschi edenen in einer Atmosphare vorhandenen Gasen wi e Ammoni ak,
Wasserstoff und Wasserdampf, eventuell auch Kohlendioxid, Kohlenmonoxid
und Stickstoff lassen sich unter Energiezufuhr in einer ersten Stufe
kleine organische MolekUle, wie Glycin und Alanin, Blausaure, Formalde
hyd und einfache Carbonsauren herstellen. In einer weiteren ~tufe konnten
aus Blausaure weitere Aminosauren und cyclische Stickstoffverbindungen,
sowie verschiedene Zucker aus Formaldehyd entstanden sein:
Ausgangsmaterial:
,
1. Stufe: HCN HCOOH
Glycin Blausaure Ameisensaure
CH3-CH(NHZ)-COOH, HCHO CH3COOH
Alanin Formaldehyd Essigsaure
V
2. Stufe: Asparaginsaure, Phenylalanin, Valin, Prolin,
Leucin, Isoleucin,
Adenin, Uracil, Guanin,
Triosen bis Hexosen
Ein weiterer Schritt ware dann eine Polykondensation der entsprechenden
Monomeren zu MakromolekUlen unter thermischem Einflu6, die in den mei
sten Fallen von Wasseraustritt begleitet ist und deshalb kaum in aqua
tischen Systemen stattgefunden haben dUrfte. So lassen sich proteinahn
liche Substanzen, Nucleotid-Polymere und Monosaccharid-Polymere aus den
3
entsprechenden Einzelbausteinen herstellen, die zumindest ansatzweise
die Eigenschaften aufweisen, die wir in den biochemisch gebildeten Poly
meren vorfinden.
Eine Zusammenlagerung von MakromolekUlen dUrfte zu einer Ausbildung von
prabiotischen Systemen gefUhrt haben, die durch Selbstorganisation in
die Lage versetzt wurden, bestimmte Substanzen bevorzugt aufzunehmen und
sich zu hoheren Strukturen zusammenzulagern. Auf diese Weise sollte es
moglich sein, Coazervat-Tropfchen oder Mikrospharen zu bilden. Die Coa
zervate haben keine feste Membran, die das Innere gegen die Umgebung ab
grenzt und sind gegen Milieuveranderungen empfindlich. Dagegen sind ar
tifizielle Protenoid-Mikrospharen zu Wechselwirkungen mit Nucleinsauren
und zu primitiven Formen von Wachs tum und Replikation befahigt, womit
sie schon Eigenschaften von Prazellen oder Protozellen aufweisen.
Die Simulationsexperimente sind aIle mit dem Problem behaftet, daB die
Verhaltnisse auf der urtUmlichen Erde weitgehend unbekannt sind und man
deshalb Uber die Zusammensetzung der Uratmosphare und Hydrosphare nur
mehr oder weniger spekulieren kann.
Die Simulationsexperimente regten natUrlich auch zu theoretischen Ober
legungen an, die das Phanomen der Entstehung des Lebens Uber physikalisch
chemische Prozesse erklarbar machen sollen. Die in stofflichen Systemen
ablaufenden Vorgange lassen sich mit physikalisch-chemischen Methoden
beschreiben, wobei davon ausgegangen wird, daB eine Protozelle ein offe
nes System darstellt, die sowohl Stoffe als auch Energie mit der Umgebung
austauscht. Die Existenz replikativer Systeme setzt voraus, daB Struktu
ren ausgebildet werden, die erworben und weitergegeben werden mUssen. Es
muB also ein Informationstransfer moglich sein, der einen selektieren-
den Charakter hat, da ein Informationsvorsprung eine bessere Anpassung
an die sich andernden Lebensbedingungen bewirkt und somit in Konkurrenz
mit anderen eine Selektion eingeht, die zwangslaufig auch in der Struk
tur zu einem "hoheren Ordnungsgrad" fUhrt.
Zusammenfassend lassen sich Uber die Entstehung des Lebens zwei Phasen
unterscheiden:
Bei der chemischen Evolution ist in der Uratmosphare eine Synthese
verschiedener kleiner organischer Kohlenstoff-Verbindungen erfolgt.
Ein ZusammenschluB der reaktionsfahigen organischen Verbindungen be
wirkte den Aufbau groBerer MolekUlverbande und die Entstehung von
makromolekularen Polymeren.
4
- die molekulare Evolution setzt~ sich in der Selbstorganisation der
MakromolekUle zu funktionsfahigen und sich selbst reproduzierenden
Einheiten fort. Die Ausbtldung zeJlahnlicher Strukturen fUhrte
schlieBlich zu den Urfomen des Lebens, wie sie heute noch in vie
len Einzellern zu finden sind.
Die Suche nach palaontologischen Zeugnissen von Protobionten konzentrier
te sich auf prakambrische Schildregionen der Erde. In den geologisch sehr
alten Formationen wurden eine Reihe von Spuren gefunden, die auf eine ehe
malige Existenz von Mikrofossilien hindeuten. In dem 3,8 Mrd. Jahre al
ten Isua-Quarzit aus Gronland lassen sich solche Mikrostrukturen andeu
tungsweise finden. Dies gilt auch fUr archaische Gesteinsserien in SUd
afrika, die 2,5 bis3,O Mrd. Jahre alt sind.
Ferner wird die Ausbildung von Stromatolithen, die als karbonathaltige
Algenriffe angesehen werden, als Indikation fUr biotische Aktivitaten
angesehen. Die altesten Stromatolithen sind vor 2,7 bis 3,1 Mrd. Jahren
(Bulawayen) entstanden. Da man nur die Morphologie dieser kohligen Mi
krofossilien kennt und organisch-chemische Analysen sehr schwierig sind,
ist es nicht auszuschlieBen, daB es fossile Ablagerungen von Protobion
ten sind, und der geologische Zeitraum ihrer Biogenese nicht bekannt ist.
A.2. Evolution der Biosphare
Man kann als sicher annehmen, daB im Prakambrium die Biogenese, d.h. der
Obergang von der nicht lebenden zur lebenden organischen Materie vollzo
gen worden ist, nachdem Lebensaktivitaten durch die Kooperation eines
Sortimentes von spezifischen Substanzen in einem geordneten System mog
lich geworden ist. Die ersten Lebensformen fUhrten sicherlich eine hete
rotrophe Lebensweise, da sie das auf abiologischem Wege gebildete orga
nische Material noch reichlich fUr ihre Umsetzung vorfanden. Aus einer
reduzierenden Atmosphare und Hydrosphare, die an organischem Material
immer mehr verarmten, mUBten sich im Rahmen der Oberwindung der "ersten
Energiekrise" autotrophe Lebensformen entwickelt haben, die in der Lage
waren, das Sonnenlicht als Energiequelle zu nutzen.
Etwas andere Vorstellungen Uber die Entwicklung des Lebens grUnden sich
auf die Entdeckung von "Urbakterien". Diese, als Archaebakterien bezeich
nete Bakteriengruppe, stellt eine eigenstandige Entwicklungsreihe dar,
die sich phylogenetisch von den "normal en "Eubakterien ebenso unterschei
det wie die letzteren von den Eucaryonten. Die formenreichste Gruppe der