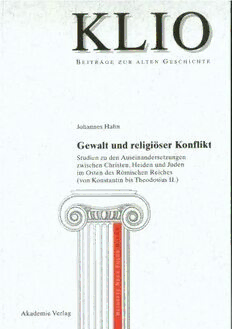Table Of ContentJohannes Hahn
Gewalt und
religiöser Konflikt
KLIO
Beiträge zur Alten Geschichte
Beihefte
Neue Folge Band 8
Unter Mitarbeit von
Manfred Clauss und
Hans-Joachim Gehrke
herausgegeben von
Hartwin Brandt und
Martin Jehne
Johannes Hahn
Gewalt und
religiöser Konflikt
Studien zu den Auseinandersetzungen
zwischen Christen, Heiden und Juden
im Osten des Römischen Reiches
(von Konstantin bis Theodosius II.)
Akademie Verlag
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ISBN 3-05-003760-1
ISSN 1438-7689
© Akademie Verlag GmbH, Berlin 2004
Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages
in irgendeiner Form - durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein
anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von
Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Einbandgestaltung: Jochen Baltzer, Berlin
Druck: Druckhaus „Thomas Müntzer", Bad Langensalza
Bindung: Norbert Klotz, Jettingen-Scheppach
Printed in the Federal Republic of Germany
Inhalt
Einleitung 9
Alexandria . .. 15
Alexandria ad Aegyptum: Strukturmerkmale der Metropolis Ägyptens
unter dem Imperium Romanum 15
Das Heidentum im spätantiken Alexandria 22
Heidnische Infrastruktur und kultisches Leben 22
Sarapis- und Isis-Verehrung 26
Die Stellung des alexandrinischen Christentums 32
Die Anfänge der Gemeinde bis zum Ende der Verfolgungen 32
Das melitianische Schisma und die Suprematie Alexandrias 36
Die Kirche im Wirtschaftsleben des 4. Jahrhunderts 40
Das Mönchtum und Bischof Athanasius 43
Athanasius: Persönlichkeit und Position in Alexandria 46
Politische Intervention, religiöser Konflikt und städtisches Leben unter
dem Episkopat des Athanasius 48
Erste Unruhen und arianische Agitation in der Stadt 48
Die Eskalation der Auseinandersetzungen im Frühjahr 339 51
Die Politik Gregors von Kappadokien (339 - 345) 55
Die .goldene Dekade' des Athanasius (346 - 356) 56
Die Bemühungen des Kaiserhofes in Alexandria (353 - 356) 58
Der Sturm auf die Theonas-Kirche (8./9. Februar 356) 60
Die Unterdrückung der Anhänger des Athanasius 64
Die Ermordung Georgs von Kappadokien 361 : religiös motivierte Gewalt? . .. 66
Georgs Amtsführung in Alexandria 68
Täter und Opfer: Politische Perspektiven 71
Heiden und Christen unter Julian und die letzte Phase arianischer Dominanz 74
Die Zerstörung der heidnischen Kulte in Alexandria 78
Die Zuspitzung des christlich-heidnischen Konflikts 78
Cod. Theod. 16,10,11 und die Zerstörung des Sarapeions 81
Der Fall des Sarapis als Paradigma christlicher Geschichtsschreibung 85
Die Zerstörung des Sarapeions nach anderen Quellen 89
Die Teilnehmer an den Auseinandersetzungen 92
Tempel, Götter, Schätze - und ihr Schicksal 95
Die neue Identität: Alexandria, die christusliebende Stadt 97
Die Eroberung des suburbanen Raums: Kanopos, Menuthis 101
Die Machtübernahme der Kirche in Gesellschaft und Politik der Stadt 106
Die Vertreibung der Novatianer und Juden durch Bischof Kyrill 106
Kyrill, Orestes und die Ermordung der Hypatia 110
Der Einfluß der Hypatia - politische Opposition gegen Bischof Kyrill 114
Antiochia 121
Antiochia, caput Syriae et Orientis: Strukturen und innere Entwicklung 121
Konflikte im spätantiken Antiochia 121
Geographie, Topographie und Bevölkerungssituation 123
Grundzüge des wirtschaftlichen und politischen Lebens 127
Das Heidentum in Antiochia 130
Die Situation der Tempel 130
Heidnische Feste 134
Antiochenische Oberschicht und Heidentum 136
Juden in Antiochia 139
Die Juden in der Geschichte und in der Gesellschaft der Stadt 139
Die Predigten des Chrysostomos gegen judaisierende Christen 143
Das antiochenische Christentum 146
Die Anfange der Gemeinde und ihre Geschichte bis ins 4. Jahrhundert 146
Wachstum oder Stagnation? Aspekte der Situation des antiochenischen
Christentums im 4. Jahrhundert 148
Das Mönchtum vor der Stadt 152
Das antiochenische Schisma 157
Die Zuspitzung des religiösen Konflikts unter Julian 161
Die Überführung der Reliquien des Babylas durch Gallus 161
Julian in Antiochia: Der Versuch der Restauration des Heidentums 163
Die Auseinandersetzung um den Kultort Daphne 168
,Martyrien' in Antiochia unter Kaiser Julian 173
Die späteren Auseinandersetzungen 178
Antiochia nach dem Tode Julians: Der Brand des Traianeums 178
Die Übernahme der Grabstätte der makkabäischen Märtyrer durch die Kirche . 180
Spuren im Dunkeln 185
Gaza 191
Palästina im 4. Jahrhundert: Kräfte des Wandels 191
Gaza: Stadt und Territorium im Zeichen der Christianisierung 193
Hilarión, Gaza, Marnas 198
Bischof Porphyrios und die christliche Gemeinde in Gaza 202
Patronage und Macht 209
Das Ende der Tempel 212
Die neue Identität: Legitimation und Herausforderung 215
Schernite von Atripe & das Heidentum in Panopolis 223
Schenute und die Überlieferung 223
Die Anfange des Klosterwesens bei Panopolis 227
Die Eigenart des monastischen Lebens unter Schenute 232
Schenute als Patron der Landbevölkerung: Sein Kampf gegen
heidnischepossessores in Panopolis 237
Heidentum und Kultur in Panopolis 242
Christen in Panopolis 246
Der Mönch und der Bischof: Schenute und die Kirche 250
Schenute und die Tempel 254
Die Haltung der römischen Provinzialverwaltung 257
Theologie und Gewalt? Zur Vorstellungswelt Schenutes 260
Die Klosterkirche Schenutes: Monument des Triumphs über das Heidentum 263
Schenutes Bedeutung 266
Zusammenfassende Betrachtungen 271
Religiöser Konflikt, Gewalt und lokale Gesellschaft 271
Der Bischof als Schlüsselfigur 276
Die Gläubigen: Religiosität oder Loyalität? 281
Die Zentraladministration: Tätigwerden und Passivität 285
Ausblick 292
Literaturverzeichnis 295
Register 333
Quellen 333
Gesamtregister 343
Vorwort
Diese Arbeit ist ursprünglich an der Universität Heidelberg entstanden und im Frühjahr
1993 dort vom Fachbereich Orientalistik und Altertumswissenschaften als Habilitations-
schrift angenommen worden. Den Anstoß zur Beschäftigung mit dem Themenfeld
verdanke ich - ebenso wie vielfaltige Förderung am Heidelberger Institut für Alte
Geschichte - Géza Alföldy. Daneben habe ich in Heidelberg von weiteren Seiten
Anregung und konstruktive Kritik erfahren. Ich nenne nur Albrecht Dihle, Bärbel
Kramer, Adolf Martin Ritter und Helmuth Schneider. Ihnen allen und zahlreichen weite-
ren, hier namentlich nicht genannten Personen sei herzlich gedankt.
In den zurückliegenden Jahren in Münster, in denen einzelne Fragestellungen der Arbeit
im Zusammenhang des Forschungsprojektes „Tempel und Tempelzerstörungen -
Verlust religiöser Zentren: Gründe, Wirkung und Bewältigung" am Sonderforschungs-
bereich 493 vertieft weiterverfolgt werden konnten, habe ich aus Diskussionen mit
Kollegen und Mitarbeitern Gewinn ziehen dürfen. Mein Dank gilt besonders Stephen
Emmel, Ulrich Gotter und Bernd Isele.
Weder die ursprüngliche Schrift noch die jetzt vorliegende Monographie wären
allerdings ohne die Unterstützung, Sympathie und Ermunterung eines Kreises von
Heidelberger Freunden zum Abschluß gekommen. Ihnen widme ich dieses Buch.
Einleitung
Die Bedeutung von inneren Unruhen für die Geschichte der Spätantike steht außer Frage.
Geschehnisse dieser Art stellten eine der verbliebenen Möglichkeiten der von politischer
Partizipation ausgeschlossenen breiten Bevölkerung dar, ihren Willen öffentlich kundzu-
tun und das Handeln der politischen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Auch öffnen
die zeitgenössischen Berichte über diese Unruhen eines der wenigen in der spätantiken
Überlieferung bewahrten Blickfenster auf die Lebensumstände und Einstellungen der
überwältigenden Mehrheit der Reichsbevölkerung. Und schließlich muß die Frage nach
der inneren Stabilität der spätrömischen Gesellschaft und ihres politischen Systems zur
Frage nach den Wurzeln und der Bedeutung der Unruhen in ihrem Gefüge führen.1
In seiner klassischen Darstellung der Spätantike unterschied A.H.M. Jones drei Ursa-
chenfelder für Ausbrüche öffentlichen Aufruhrs: religiöse Konflikte, Lebensmittelknapp-
heiten und Rivalitäten der Zirkusparteien. Diese Typologie hat ihre wissenschaftliche
Fruchtbarkeit erwiesen.2 Lebensmittelversorgung und Hungeraufstände sowie Zirkuspar-
teien und -revolten haben dabei in der neueren Forschung ein reges Interesse gefunden.3
Das weitgehende Fehlen von systematischen Studien4 zu den religiös motivierten Unru-
hen in der Spätantike muß hingegen angesichts der zeitgenössischen Aufmerksamkeit für
diese Vorfalle erstaunen: Für keine der genannten Kategorien besitzen wir nach Zahl und
Dichte so ausführliche Informationen wie für die mit gewaltsamen Mitteln in der Öffent-
lichkeit ausgetragenen Auseinandersetzungen religiösen Hintergrundes.5
Dabei zeigen religiös motivierte Unruhen gegenüber Hunger- oder Zirkusrevolten in
mancher Hinsicht eine größere Komplexität. Zunächst: Schauplatz der Zirkus- und Hun-
gerrevolten ist die Stadt. Unruhen, die vom Zirkus, dem wichtigsten Unterhaltungsort und
Treffpunkt der Stadtbevölkerung ausgehen oder aus Problemen der Lebensmittelversor-
gung erwachsen, stellen damit ein spezifisches Problem der Urbanen Kultur im Imperium
Entsprechende Erklärungsansätze fur den Niedergang des spätantiken Imperiums etwa bei AlfÖldy
1984, 172ff.; Demandt 1984, 274ff. 333ff.; MacMullen 1990; Liebeschuetz 2001, 249ff.
Jones 1964, 694. Siehe Cameron 1976, 271 mit den Einschränkungen bei Whitby 1999, 232.
Hungerunruhen: Teall 1959, Martindale 1960, Kohns 1961, Tengström 1974, Gregory 1983, Wie-
mer 1995a, 269ff., Aja Sanchez 1998. Allgemein Gamsey 1988, Garnsey - Humfress 2001, llOff.
und Durliat 1990. Zirkusrevolten: Browning 1952, Martindale 1960, 63ff., Jariy 1968; grundlegend
Cameron 1976 (vgl. Cameron 1974 und 1980), weiterhin Kneppe 1979, Gregory 1983, French
1985, Aja Sanchez 1998, zuletzt Whitby 1999 und Liebeschuetz 2001, 213ff. 250ff.
Gregory 1979 behandelt die Vorfälle um Johannes, Nestorius und Dioskoros in Konstantinopel,
Ephesos u.a. sowie Alexandria. Ähnlich McLynn 1992 zur Eigenart des religiösen Konflikts in der
Reichshauptstadt. Reiches Material, v.a. Einzelstudien, bei Trombley 1993/94. Alexandria: Haas
1997; Aiston 2002,287: Liste. Sauer 2003 fokussiert auf Ikonoklasmus im archäologischen Befund.
Martindale 1960, 107; Cameron 1976, 290. So formuliert MacMullen 1990, 266 zur Geschichte des
4. und 5. Jh.s: „... there is no denying that history during all that long period consisted more in reli-
gious disputes than in anything else." Brown 1995a, 118; Garnsey - Humfress 2001, 150.
10 Einleitung
Romanum dar. Unruhen, denen religiöse Konflikte zugrunde liegen, sind zwar für viele
Städte bezeugt, doch ist das Phänomen nicht auf sie beschränkt: Ländliche Regionen
erlebten ebenso gewaltsame religiöse Auseinandersetzungen; weitere Fälle sind topogra-
phisch oder sozial gerade in der Übergangszone von Stadt und Land festzustellen.
Die Ausgangssituationen von Zirkus- und Hungerrevolten lassen sich genau bestim-
men: Erstere waren Ausfluß der Erregung über den Ablauf der Spiele - nicht aber durch
politische oder religiöse Überzeugungen des Publikums bestimmt.6 Mit Hungerunruhen
reagierte die niedere städtische Bevölkerung auf tatsächliche oder vermeintliche Engpässe
in der öffentlichen Lebensmittelversorgung. Aufgrund dieser klar umrissenen Bedingun-
gen waren Zirkus- wie Hungerrevolten zu einem gewissen Grad voraussehbar. Die Aus-
gangskonstellationen religiös motivierter Gewaltausbrüche waren weit vielfaltiger. Bi-
schofswahlen konnten ebenso Krawalle auslösen wie Übergriffe von Personen oder orga-
nisierten Gruppen auf sakrale Orte anderer Religionsgemeinschaften; latente Feindselig-
keit zwischen Glaubensgruppen vermochte aus geringen Anlässen in offene Gewalt um-
zuschlagen. Solche Eruptionen von Gewalt dürften selten vorauszusehen gewesen sein.
Für die Beurteilung von Unruhen als Indikatoren sozialer, wirtschaftlicher oder religiö-
ser Spannungen ist die Frage nach dem Kreis und der Rekrutierung der Beteiligten von
schlüsselhafter Bedeutung. Die Zeugnisse zu Hungerrevolten lassen keinen Zweifel dar-
an, daß die von Versorgungsengpässen bedrohte städtische Bevölkerung für Interventio-
nen der öffentlichen Organe zu demonstrieren begann, die Zusammenrottungen aber zu
Krawallen ausarten konnten. Bei Zirkusrevolten agierten die in den Zirkusparteien organi-
sierten Anhänger der unter verschiedenen Farben antretenden Rennställe und Schauspie-
ler. Die für die Parteien geläufige Bezeichnung δήμοι markiert ihre soziale Basis: Es ist
die niedere Bevölkerung, die sich hier sammelte und bei den von Spielen ausgehenden
Unruhen aufeinanderstieß oder sich Straßenschlachten mit Ordnungskräften lieferte.7 Die
Teilnehmer an Hunger- wie Zirkusrevolten rekrutierten sich somit aus denselben Urbanen
Schichten. Zudem gilt: Die sich hier artikulierenden Gruppen waren immer klar bestimm-
bare Bestandteile derselben Lokalgesellschaft, die sie mit ihrer Gewalt überzogen.
Demgegenüber ist es nicht möglich, klare gesellschaftliche Linien festzustellen, nach
denen sich Teilnehmer an religiös motivierten Unruhen rekrutierten. Christen, Orthodo-
xe', 'Häretiker', Heiden, Juden etc., mithin Gruppen, die hier allenfalls nach ihnen ge-
meinsamen religiösen Überzeugungen zu bestimmen sind, lassen sich im Einzelfall als
Urheber und Opfer von Gewaltausbrüchen erfassen, die erklärtermaßen oder faktisch aus
Glaubensgründen erfolgten. Doch eine Zugehörigkeit der Beteiligten oder Betroffenen zu
spezifischen gesellschaftlichen Schichten ist - sieht man von bestimmten Gruppen auf
Seiten der Kirche ab - nicht generell, allenfalls im Einzelfall zu erkennen.
Für eine Einschätzung der Bedeutung religiöser Unruhen ist es entscheidend, die betei-
ligten Gruppen näher zu fassen und die konstitutiven Faktoren ihres Zusammenhaltes zu
bestimmen. Vor allem stellt sich die Frage nach den treibenden Kräften hinter den gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen. Wie aktiv, ja offensiv - oder passiv - waren die einzelnen
religiösen Gruppen? Welche Personen oder Gruppen beanspruchten die Führung? Ange-
Cameron 1974 und ders. 1976, 126ff. sowie 1980 gegen Jarry 1968 und die ältere Forschung.
Die periodischen Exzesse der Zirkusparteien zeigen regelrecht rituelle Züge; Cameron 1976, 296
sprach deshalb von einem durch sie bewirkten Abbau sozialer und politischer Spannungen.