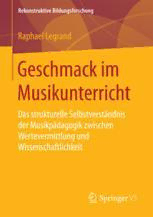Table Of ContentRekonstruktive Bildungsforschung
Raphael Legrand
Geschmack im
Musikunterricht
Das strukturelle Selbstverständnis
der Musikpädagogik zwischen
Wertevermittlung und
Wissenschaftlichkeit
Rekonstruktive Bildungsforschung
Band 14
Reihe herausgegeben von
Martin Heinrich, Bielefeld, Deutschland
Andreas Wernet, Hannover, Deutschland
Die Reihe ‚Rekonstruktive Bildungsforschung‘ reagiert auf die zunehmende Etab
lierung und Differenzierung qualitativrekonstruktiver Verfahren im Bereich der
Bildungsforschung. Mittlerweile hat sich eine erziehungswissenschaftliche For
schungstradition gebildet, die sich nicht mehr nur auf die Rezeption sozialwissen
schaftlicher Methoden beschränkt, sondern die vielmehr eigenständig zu methodi
schen und methodologischen Weiterentwicklungen beiträgt. Vor dem Hintergrund
unterschiedlicher methodischer Bezüge (Objektive Hermeneutik, Grounded Theo
ry, Dokumentarische Methode, Ethnographie usw.) sind in den letzten Jahren wei
terführende Forschungsbeiträge entstanden, die sowohl der Theorie als auch der
Methodenentwicklung bemerkenswerte Impulse verliehen haben.
Die Buchreihe will diese Forschungsentwicklung befördern und ihr ein ange
messenes Forum zur Verfügung stellen. Sie dient vor allem der Publikation qual
itativrekonstruktiver Forschungsarbeiten und von Beiträgen zur methodischen und
methodologischen Weiterentwicklung der rekonstruktiven Bildungsforschung. In
ihr können sowohl Monographien erscheinen als auch thematisch fokussierte Sam
melbände.
Reihe herausgegeben von
Martin Heinrich Andreas Wernet
Wiss. Einrichtung OberstufenKolleg Institut für Erziehungswissenschaft
Universität Bielefeld Leibniz Universität Hannover
Bielefeld, Deutschland Hannover, Deutschland
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/11939
Raphael Legrand
Geschmack im
Musikunterricht
Das strukturelle Selbstverständnis
der Musikpädagogik zwischen
Wertevermittlung und
Wissenschaftlichkeit
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans Bäßler
Raphael Legrand
Hannover, Deutschland
Zugl.: Hannover, Hochsch. für Musik, Theater und Medien, Diss., 2016
Rekonstruktive Bildungsforschung
ISBN 9783658202026 ISBN 9783658202033 (eBook)
https://doi.org/10.1007/9783658202033
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: AbrahamLincolnStr. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Danksagung
Fu¨r das fortw¨ahrende Vertrauen, die langj¨ahrige bereichernde Zusammen-
arbeit und die Offenheit gegenu¨ber dem f¨acheru¨bergreifenden Promotions-
vorhabenbedankeichmichbeimeinemDoktorvaterProf.Dr.HansB¨aßler;
sein philosophisch-anthropologischer Forschungsansatz war ein Grundbau-
stein des wissenschaftlichen Duktus der vorliegenden Dissertation.
Prof. Dr. Andreas Wernet bin ich zu Dank verpflichtet fu¨r die Beratung
im Hinblick auf die Forschungsmethode und das Theoriekonstrukt; seine
Ratschl¨ageaufsoziologischerunderziehungswissenschaftlicherEbenewaren
¨außerst gewinnbringend.
Ebenso danke ich Prof. Dr. Gaja von Sychowski fu¨r ihre Begleitung der
Forschungsarbeit, die sie mit ihrer fachlichen Ausrichtung einer musikbezo-
genen Erziehungswissenschaft – quasi als Bindeglied – unterstu¨tzt hat.
Mein Dank gilt auch Prof. Dr. Franz Riemer, dessen Forschungsperspekti-
ve der vergleichenden und historischen Musikp¨adagogik die systematischen
Aspekte der Arbeit mit gepr¨agt haben.
Fu¨r das minuzi¨ose und fundierte Lektorat danke ich Gunda Landwehr.
Fu¨r die zahlreichen Ratschl¨age, die emotionale Begleitung und die berei-
chernden Hinweise danke ich außerdem:
JanBiring,IngaClemens,Dr.JorisDoelle,derFallwerkstattderUniversit¨at
Hannover, Lara Grove, Imke Kollmer, Prof. Dr. Reinhard Kopiez, Philipp
undKarlaLegrand,Prof.Dr.AndreasLehmann-Wermser,Dr.LorenzLuy-
ken, Sebastian Meller, Jun.-Prof. Dr. Friedrich Platz, Dr. Rita Spiller, Dr.
Anna Wolf, Maria Zech, Dr. Ramona Zeimet und Prof. Dr. Thomas Ziehe.
Raphael Legrand
Geleitwort
In allt¨aglichen Situationen des Musikunterrichts bildet die individuelle Ori-
entierunganbestimmteMusikeneinezentraleRolle,ohnedassdiesetats¨ach-
lich zur Sprache gebracht werden muss. Die Diastase zwischen dem jeweili-
gen–geradeauchuntereinanderdivergierenden–Schu¨lergeschmackaufder
einenundderjeweiligenmusikalischenPr¨aferenzderLehrer*inaufderande-
renSeiteschwingtunterschwelliginsogutwiejedemUnterrichtmitundver-
mag Konfliktpotenzial zu haben. Diese unterschiedlichen Pr¨aferenzen aber
basieren auf einem weitaus gr¨oßeren Unterschied — dem der Identit¨ats-
orientierung und damit auch der Verschiedenheit von Biographien. Hinzu
kommt noch ein zweites Problem: das der Lehrpl¨ane und Richtlinien, auf
deren Basis Unterricht geplant werden muss. In ihnen sind bereits Vorga-
ben und damit Geschmackspr¨aferenzen vorgenommen, die ggf. von denen
der Lehrer*innen und Schu¨ler*innen abweichen. Doch selten werden solche
grunds¨atzlichen Fragen analysiert, sondern eher als gegeben und unl¨osbar
hingenommen.
Der Autor nimmt sich diesem Desiderat an und befasst sich in seiner Ar-
beit mit dem musikalischen Geschmack“ als einer Komponente des unter-
”
richtlichen Geschehens. Er stellt ein Untersuchungsmodell vor, das einen
anderen Weg einschl¨agt als herk¨ommliche Untersuchungsstrategien zu Ge-
schmackspr¨aferenzenundderenAuswirkungenaufdaskommunikativeVer-
halten (egal in welchem Zusammenhang auch immer). Von daher ergeben
sich u¨berraschende Einsichten in fu¨r die Musikp¨adagogik neue M¨oglichkei-
ten der Analyse von Unterrichtsdetails durch die Objektive Hermeneutik;
gleichzeitig aber k¨onnen grunds¨atzliche U¨berlegungen zur Zielgerichtetheit
von A¨ußerungen in kontextbezogenen und kontextunabh¨angigen Situatio-
nen angestellt werden. Raphael Legrands zentrale Forschungsfrage ergibt
sich aus dieser Spannung: Wird Musikunterricht von praktizierenden Leh-
”
rern als U¨bermittlung von Werten verstanden oder wird eine wissenschaft-
lichdistanzierte,neutralePerspektiveaufMusikkulturvermittelt?Undwie
zeigt sich die jeweilige U¨berzeugung in der Praxis?“ Damit untersucht der
Autor nicht weniger als die Basis musikp¨adagogischen Handelns: die Hal-
tung zum unterrichtlichen Gegenstand und zu den Schu¨lern.
VIII Geleitwort
Diehierangestellten U¨berlegungenbauenaufdreiFallstudienauf,dienach
dem von Oevermann entwickelten und von Wernet fortgefu¨hrten Verfahren
analysiert, und zudem
(a) ineinenZusammenhangmitderhistorischenwieaugenblicklichenDe-
batte der Musikp¨adagogik gestellt werden, und sich
(b) sowohl auf Webers Paradigma der Wissenschaften beziehen, Haber-
masdreiRealit¨atsebenenreflektierenundBourdieus Geschmackund
”
Distinktion“ fu¨r die weiteren Abhandlung als konstitutiv verstehen.
Die notwendige Grundlegung dieser genuin forschenden Arbeit geschieht
in drei Schritten: einem musikp¨adagogischen, in dem ein Aufriss der Ge-
schichtedesFachesgegebenwird,eineminweitestemsoziologischen(wobei
die Musikpsychologie hier zugleich soziologisch verstanden wird) und einer
ausfu¨hrlichen Darstellung des Verfahrens der Objektiven Hermeneutik.
Fu¨r das gew¨ahlte Verfahren der Objektiven Hermeneutik spricht, dass sich
Aspekte struktureller Natur hinter dem subjektiv-situativen Kontext ana-
lysieren lassen und nicht durch Vordergru¨ndiges u¨berdeckt werden. So wird
das u. U. problematische Verh¨altnis zwischen Interpretationsannahme und
Fallstrukturhypothese durch die Sequenzanalyse relativiert.
Die drei analysierten Fallbeispiele ( Werte zuschreiben“, Zwischen Wer-
” ”
tevermittlung und Wissenschaftlichkeit“ sowie Dekonstruktion von Wer-
”
ten“) stellen Bezu¨ge zu parallelen Erfahrungsmomenten (gerade auch au-
ßerhalb der Schule) her, um zugleich die sozialen Strukturen zwischen Leh-
rer*innen und Schu¨ler*innen und Schu¨ler*innen untereinander differenziert
zu decodieren. Dieses Verfahren erh¨alt seinen Sinn im Aufdecken unbewus-
ster Bezu¨ge und Beziehungen und begru¨ndet damit eine besondere Sen-
sibilit¨atsstufe fu¨r den (Musik-)Unterricht, die im Normalfall nur intuitiv
approximiert werden mag. Und gleichzeitig ist dieser erste Aufschlag der
Methode der Objektiven Hermeneutik fu¨r die Musikvermittlung von be-
sonderem Wert fu¨r einen neu zu denkenden Bezug zwischen Allgemeiner
P¨adagogik und Musikp¨adagogik.
Hans B¨aßler
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XI
Erl¨auterungen formaler Aspekte XIII
Zusammenfassung XV
Abstract XVII
1 Ein aktuelles Verst¨andnis von Musikunterricht 1
2 Eine soziologische Perspektive auf Musikunterricht 15
2.1 Webers Wissenschaftslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.1 Dichotomie: Wissenschaft und Wertstandpunkt . . . . 16
2.1.2 Annex: Webers Kultivationsbegriff . . . . . . . . . . . 22
2.1.3 Habermas: Drei Realit¨atsebenen . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Bourdieu: Geschmack und Distinktion . . . . . . . . . . . . . 32
2.3 Geschmack aus Sicht der psychologischen Musikp¨adagogik . . 47
2.4 Zwischenbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3 Methodische U¨berlegungen: Das Untersuchungsdesign 65
3.1 Methodologie der Objektiven Hermeneutik . . . . . . . . . . . 67
3.2 Prinzipien der Objektiven Hermeneutik . . . . . . . . . . . . 77
3.3 Kritische Aspekte der Objektiven Hermeneutik . . . . . . . . 81
3.4 Auswahl des empirischen Datenmaterials . . . . . . . . . . . . 84
3.4.1 Modus des Neu-Schaffens von Musik . . . . . . . . . . 88
3.4.2 Modus des Nach-Schaffens von Musik . . . . . . . . . 95
4 Musikgeschmack im Musikunterricht: Fallrekonstruktionen 105
4.1 Erster Fall: Werte zuschreiben. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.1.1 Die Aufgabenstellung der Unterrichtssequenz . . . . . 106
4.1.2 Sequenzanalyse: Konfrontation auf Werte-Ebene . . . 110
4.1.3 Zwischenbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
X Inhaltsverzeichnis
4.2 Zweiter Fall: Zwischen Wertevermittlung und Wissenschaft-
lichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.2.1 Die Aufgabenstellung der Unterrichtssequenz . . . . . 131
4.2.2 Sequenzanaylse: Gemeinsames Entdecken Neuer Musik142
4.2.3 Zwischenbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.3 Dritter Fall: Dekonstruktion von Werten . . . . . . . . . . . . 155
4.3.1 Die Aufgabenstellung der Unterrichtssequenz . . . . . 156
4.3.2 Sequenzanalyse: Offenlegung distinktiver Strukturen . 162
4.3.3 Zwischenbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5 Conclusio 181
5.1 Strukturgeneralisierung:MusikunterrichtzwischenWertever-
mittlung und Wissenschaftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.2 Erg¨anzung zur Theorie der musikbedingten Distinktion . . . 187
5.3 Ein Musikunterricht ohne Musikgeschmack? . . . . . . . . . . 189
5.4 Forschungsperspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Literaturverzeichnis 195