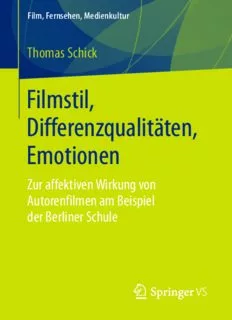Table Of ContentFilm, Fernsehen, Medienkultur
Thomas Schick
Filmstil,
Differenzqualitäten,
Emotionen
Zur affektiven Wirkung von
Autorenfilmen am Beispiel
der Berliner Schule
Film, Fernsehen, Medienkultur
Schriftenreihe der Hochschule für Film und
Fernsehen „Konrad Wolf“
Herausgegeben von
L. Mikos, Potsdam, Deutschland
M. Wedel, Potsdam, Deutschland
C. Wegener, Potsdam, Deutschland
D. Wiedemann, Potsdam, Deutschland
Die Verbindung von Medien und Kultur wird heute nicht mehr in Frage gestellt.
Medien können als integraler Bestandteil von Kultur gedacht werden, zudem ver-
mittelt sich Kultur in wesentlichem Maße über Medien. Medien sind die maß-
geblichen Foren gesellschaftlicher Kommunikation und damit Vehikel eines
Diskurses, in dem sich kulturelle Praktiken, Konflikte und Kohärenzen struktu-
rieren. Die Schriftenreihe der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF knüpft
an eine solche Sichtweise von Medienkultur an und bezieht die damit verbun-
denen Themenfelder ihren Lehr- und Forschungsfeldern entsprechend auf Film
und Fernsehen. Dabei werden unterschiedliche Perspektiven eingenommen, in
denen es gleichermaßen um mediale Formen und Inhalte, Rezipienten und Kom-
munikatoren geht. Die Bände der Reihe knüpfen disziplinär an unterschiedliche
Fachrichtungen an. Sie verbinden genuin film- und fernsehwissenschaftliche
Fragestellungen mit kulturwissenschaftlichen und soziologischen Ansätzen, dis-
kutieren medien- und kommunikationswissenschaftliche Aspekte und schließen
Praktiken des künstlerischen Umgangs mit Medien ein. Die theoretischen Aus-
führungen und empirischen Studien der Schriftenreihe erfolgen vor dem Hinter-
grund eines zunehmend beschleunigten technologischen Wandels und wollen der
Entwicklung von Film und Fernsehen im Zeitalter der Digitalisierung gerecht
werden. So geht es auch um neue Formen des Erzählens sowie um veränderte
Nutzungsmuster, die sich durch Mobilität und Interaktivität von traditionellen
Formen des Mediengebrauchs unterscheiden.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/12512
Thomas Schick
Filmstil,
Differenzqualitäten,
Emotionen
Zur affektiven Wirkung von
Autorenfilmen am Beispiel
der Berliner Schule
Thomas Schick
Berlin, Deutschland
Dissertation an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, Medienwissen-
schaft, 2015
Film, Fernsehen, Medienkultur
ISBN 978-3-658-19142-9 ISBN 978-3-658-19143-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-19143-6
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Danksagung
Während der Zeit der Entstehung dieser Arbeit wurde ich von vielen Menschen
begleitet und unterstützt. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich dan-
ken. Prof. Dr. Gunther Witting und Prof. Dr. Henri Schoenmakers von der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg danke ich, dass sie mich zu dieser
Dissertation ermutigt und mit mir meine ersten Ideen diskutiert haben, ebenso
danke ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Doktorandenkolloquien in
Erlangen. Joris Freisinger, Barbara Glökler, Christina Hein, Jan Keller, Tobias Ott,
Martin Paul, Julia Rupprecht und Nina Stazol waren in dieser Anfangszeit und
auch darüber hinaus als Freundinnen und Freunde für mich da und haben mich
bestärkt, an einem Dissertationsprojekt zu arbeiten.
Die Stipendien der ‚DEFA-Stiftung‘ und des Erlanger Graduiertenkollegs ‚Kul-
turhermeneutik im Zeichen von Differenz und Transdifferenz‘ ermöglichten mir
erste vorbereitende Recherchen und eine erste Orientierung im Themenfeld mei-
ner Arbeit.
Die entscheidenden Impulse für meine Dissertation erhielt ich durch meine
Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Film und Fern-
sehen „Konrad Wolf“, der jetzigen Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.
Bei Prof. Dr. Peter Wuss bedanke ich mich herzlich für seinen unermüdlichen
Zuspruch, weiter an meinem Dissertationsprojekt zu arbeiten, für seine zahlrei-
chen Anregungen und Hinweise in Gesprächen und für s eine inspirierenden Vor-
lesungen, aus denen ich viele Denkanstöße mitgenommen habe. Meine Kollegin-
nen und Kollegen von der Filmuniversität Arne Brücks, Dr. Susanne Eichner, Dr.
Jesko Jockenhövel, Anna Luise Kiss, Prof. Dr. Lothar Mikos, Prof. Dr. Martina
Schuegraf, Claudia Töpper, Prof. Dr. Chris Wahl, Prof. Dr. Claudia Wegener und
V
VI Danksagung
Yulia Yurtaeva sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Doktorandenkol-
loquiums haben meine Arbeit an der Dissertation in den letzten Jahren in vielfälti-
ger Weise unterstützt, wofür ich mich bei ihnen ebenso herzlich bedanken möchte.
Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothek und Mediathek der
Filmuniversität gilt mein Dank. Sie waren mir jederzeit bei der Beschaffung von
Literatur, Filmen und Material für mein Dissertationsprojekt behilfl ich. Prof. Dr.
Dieter Wiedemann, Dr. Uta Becher, Michael Flügger und Astrid v. Gliszczynski
ermöglichten mir den Besuch zahlreicher Tagungen, bei denen ich meine For-
schungsarbeit vorstellen und diskutieren konnte.
Mein besonderer Dank gilt Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann. Er hat die Arbeit
aufmerksam gelesen und mit vielen Anmerkungen verbessert; außerdem hat er
mich immer bestärkt, nicht aufzugeben und meine Forschungen weiter zu ver-
folgen.
Besonders herzlich möchte ich mich bei Prof. Dr. Michael Wedel für seine
kompetente Betreuung, sein unermüdliches Engagement, seine Geduld und sei-
ne Ermutigungen bedanken, ohne die ich diese Arbeit wohl nicht beendet hätte.
Die Gespräche mit ihm, seine gründliche Lektüre verschiedener Textfassungen
und seine Kommentare und Anregungen haben entscheidend zur Entstehung der
Arbeit beigetragen. Prof. Dr. Jens Eder gilt mein Dank für die Übernahme des
Zweitgutachtens und seine Hinweise und Anmerkungen.
Für Aufmunterungen, Ablenkungen vom Alltag am Schreibtisch und für Zu-
spruch in Zeiten, in denen das Durchhalten manchmal schwerfi el, bedanke ich
mich bei meinen Berliner Freundinnen und Freunden, insbesondere bei Nicole
Binner, Evelin Haible, Johanna Hasse, Patrick Kleinschmidt, Jana Meyerrose und
Christine Wallesch. Als Freundinnen und Freunde standen mir auch immer Mar-
tina Fries, Doreen Orda, Matthias Orda-Klöß, Heike Tagsold, Christian Tagsold
und Eva-Karen Tittmann zur Seite; zusätzlich danke ich ihnen herzlich, dass sie
die Arbeit sorgfältig Korrektur gelesen haben.
Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, die mich auf dem
langen Weg von den ersten Ideen bis zur fertigen Dissertation begleitet hat. Mei-
ne Schwester Andrea Zumkeller und meine Eltern Gerlinde und Wilhelm Schick
hatten immer ein offenes Ohr für mich. Meine Eltern waren es auch, die mir mein
Studium ermöglicht, immer an mich geglaubt und mir dadurch die Kraft gegeben
haben, meine Dissertation zu beenden. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.
Berlin, im April 2017
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
1 Einleitung: Kunstwerke und affektives Erleben. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vom antiken Theater zum Kino
2 Filmrezeption und affektives Erleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Philosophisch-ästhetische Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Psychologisch-kognitivistische Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3 Emotionstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1 Was ist eine Emotion?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Evolutionstheoretische Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3 Neurologische Emotionstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.4 Sozialkonstruktivistische Emotionstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.5 Bewertungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.6 Integrative Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4 Theorien zu Filmrezeption und affektivem Erleben . . . . . . . . . . . . . . 43
Ein Überblick
4.1 Ed Tan: Der Spielfi lm als ‚Emotionsmaschine‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Murray Smith: ‚Engagement‘ mit Figuren zur Lenkung der Emo-
tionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.3 Torben Grodal: Evolution, Kultur und Emotion . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.4 Greg Smiths ‚mood cue approach‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
VII
VIII Inhaltsverzeichnis
4.5 Carl Plantingas kognitiv-perzeptueller Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.6 Die Hauptelemente der Theorien –
eine kritische Gegenüberstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.6.1 Objekte fi lmischer Emotionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.6.2 Zuschauermodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.6.3 Spielfi lme als emotional vorfokussierte Texte . . . . . . . . . . . . . 95
4.6.4 Der klassische Spielfi lm als primärer Untersuchungsgegen-
stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.6.5 Figuren und affektive Wirkungen von Spielfi lmen:
Sympathie, Empathie und Identifi kation . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.6.6 Erzählstrukturen und stilistische Konstruktionen . . . . . . . . . . 101
4.6.7 Genres und emotionale Wirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.6.8 Kulturelle Einfl üsse und affektive Wirkungen von Spielfi lmen 105
5 Jenseits des ‚klassischen‘ Spielfi lms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Innovation, Abweichung und Differenzqualität
5.1 Was bedeutet Differenzqualität? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2 Herausforderung der Wahrnehmung und der
Erwartungen des Zuschauers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.3 Der ‚klassische Spielfi lm‘ als Norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.3.1 Das Prinzip der fi gurenzentrierten Kausalität . . . . . . . . . . . . . 129
5.3.2 Zielorientiert handelnde Figuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.3.3 Die Rolle von Konfl ikten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.3.4 Doppelte Struktur: ‚Private‘ und ‚gesellschaftliche‘ Hand-
lungslinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.3.5 Der ‚unsichtbare‘ Stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.3.6 Die Stabilität des klassischen Paradigmas . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.3.7 Grenzen der Stabilität des klassischen Paradigmas:
Das postklassische Kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.4 Der europäische Autorenfi lm und das ‚Art Cinema‘: Differenz-
qualitäten und Innovationspotential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.4.1 Merkmale des Autorenfi lms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.4.2 Die Rolle des kulturellen und institutionellen Kontextes . . . . . 163
5.5 Das Feld der Differenzqualitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.5.1 Fallbeispiel: Tom Tykwers LOLA RENNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.5.2 Fallbeispiel: Jean-Pierre und Luc Dardennes LE FILS . . . . . . . . 186
5.5.3 Fallbeispiel: Cristi Puius MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU . . . . 190
Inhaltsverzeichnis IX
6 Differenzqualitäten und affektives Erleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.1 Differenzqualitäten, Diskrepanzen und Schemata:
George Mandlers Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6.2 Konfl ikte, Problemlösungsprozesse und das Bedürfnis
nach Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6.3 Affektive Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6.3.1 Filmstrukturen und affektive Wirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6.3.2 Dispositionen des Zuschauers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
6.3.3 Der Begriff des affektiven Feldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.3.4 Mentale Strukturen: Integration verschiedener
Emotionstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
6.3.5 Filmische Strukturen und Darstellungsebenen . . . . . . . . . . . . . 236
6.3.6 Dominanten und Interaktionen im affektiven Feld . . . . . . . . . 266
7 Thesen zum affektiven Erleben
von Spielfi lmen mit Differenzqualitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
8 Differenzqualität und affektives Erleben
bei den Filmen der Berliner Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
8.1 Die ‚Berliner Schule‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
8.1.1 Entstehung und Vertreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
8.1.2 Die Themen der Filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
8.1.3 Stilistische Gemeinsamkeiten der Filme . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
8.1.4 Leitfragen für die Analyse der Fallbeispiele. . . . . . . . . . . . . . . 322
8.2 Thomas Arslans DER SCHÖNE TAG (2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
8.2.1 Entstehung und Kontext des Films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
8.2.2 Die Erzählstruktur des Films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
8.2.3 Dominante Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
8.2.4 Affektive Mikrofelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
8.2.5 Affektive Makrofelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
8.2.6 Zur affektiven Gesamtwirkung von DER SCHÖNE TAG . . . . . . . . 395
8.3 Angela Schanelecs MEIN LANGSAMES LEBEN (2001) . . . . . . . . . . . . . . 398
8.3.1 Entstehung und Kontext des Films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
8.3.2 Die Erzählstruktur des Films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
8.3.3 Dominante Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
8.3.4 Affektive Mikrofelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
8.3.5 Affektive Makrofelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
8.3.6 Zur affektiven Gesamtwirkung von MEIN LANGSAMES LEBEN . . 464
Description:Thomas Schick entwickelt ein Analysemodell, mit dem die Bedeutung stilistischer Mittel für die affektive Wirkung von Spielfilmen erfasst werden kann. Im Rahmen der Arbeit werden vor allem Autorenfilme untersucht, die durch ihre spezifischen Gestaltungsweisen von etablierten Normen und Konventionen