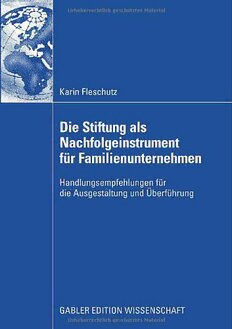Table Of ContentKarin Fleschutz
Die Stiftung als Nachfolgeinstrument
für Familienunternehmen
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Karin Fleschutz
Die Stiftung als
Nachfolgeinstrument
für Familienunternehmen
Handlungsempfehlungen für
die Ausgestaltung und Überführung
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Axel G. Schmidt
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Dissertation Universität Trier, 2007
1. Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten
© Gabler | GWVFachverlage GmbH, Wiesbaden 2008
Lektorat: Frauke Schindler /Britta Göhrisch-Radmacher
Gabler ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.
www.gabler.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbe-
sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. indiesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN 978-3-8349-1400-2
Meinen Eltern
Geleitwort
Mit Blick auf den in zahlreichen Familienunternehmen bevorstehenden oder sich bereits
vollziehenden Generationswechsel haben bestimmte Gestaltungsformen des Generations-
wechsels wie etwa die familieninterne Nachfolge, MBI und MBO oder der Verkauf an Dritte
bereits recht viel Aufmerksamkeit in wissenschaftlichen und praxisorientierten Publikationen
erhalten. Dem gegenüber findet die unternehmensverbundene Stiftung in der ökonomisch
geprägten Literatur zu Familienunternehmen in der Regel lediglich dadurch Beachtung, dass
auf die Stiftung als weitere mögliche Gestaltungsform hingewiesen wird. Im wissenschaft-
lichen Schrifttum zum Stiftungswesen hingegen dominieren juristische Abhandlungen, die sich
etwa mit steuer- oder erbrechtlichen Aspekten befassen.
Daher sind wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten rar, die eine Verbindung zwischen
unternehmensverbundener Stiftung und dem Generationswechsel in Familienunternehmen
herstellen. Insofern ist die von Frau Fleschutz verfasste Dissertation auch als eine Art
interdisziplinärer Brückenschlag zu verstehen, indem sie unter Einbeziehung von
Erkenntnissen aus anderen wissenschaftlichen Fachrichtungen die unternehmensverbundene
Stiftung als Instrument zur Gestaltung der Nachfolge in Familienunternehmen in das Zentrum
ihrer Untersuchung rückt.
Ihr übergeordnetes Forschungsziel liegt darin, existierende Erkenntnislücken an der Schnitt-
stelle zwischen Familienunternehmen und Stiftungswesen zu schließen und hier insbesondere
die Frage zu beantworten, welche belastbaren Handlungsempfehlungen sich hinsichtlich der
Ausgestaltung und Überführung der Stiftung auf der Basis theoretischer Überlegungen und
selbst erhobener empirischer Erkenntnisse ableiten lassen.
Insgesamt betrachtet leistet diese Schrift einen erheblichen Beitrag zur Schließung von
Erkenntnislücken. Dies ist nicht zuletzt auf die umfangreichen und interessanten empirischen
Befunde zurück zu führen, die mit außerordentlich hohem Aufwand unter Verwendung
diverser empirischer Methoden erarbeitet wurden. Hier hat Frau Fleschutz ein Stück
Pionierarbeit geleistet. Vor diesem Hintergrund wünsche ich dieser Arbeit die ihr gebührende
Beachtung in Wissenschaft und unternehmerischer Praxis.
Univ.-Prof. Dr. Axel G. Schmidt, Universität Trier
Vorwort
Die Unternehmensnachfolge zählt zu den erfolgskritischsten Momenten insbesondere für
Familienunternehmen. Beinahe jedes fünfte Familienunternehmen steht in den kommenden
fünf Jahren vor dieser Herausforderung. Die Stiftung ist eine der Möglichkeiten, die sich als
Nachfolgelösung bietet und die auf Grund ihrer Vorzüge zunehmende Verwendung findet.
Heutzutage existieren über 400 Beispiele stiftungsgetragener Unternehmen in Deutschland, von
denen 25 Prozent in den letzten 10 Jahren initiiert wurden.
Der Fokus bisheriger wissenschaftlicher Untersuchungen lag auf juristischen, insbesondere
steuerrechtlichen oder erbrechtlichen Aspekten der unternehmensverbundenen Stiftung. Über
die betriebswirtschaftliche Ausgestaltung von Stiftungslösungen bzw. den Überführungs-
prozess mangelte es an Transparenz. Selbst in Gesprächen mit Vertretern stiftungsgetragener
Unternehmen wurde deutlich, dass diesen häufig nur ihre eigene Lösung bekannt war und
ihnen Vergleichsmöglichkeiten fehlten.
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Herleitung von Handlungsempfehlungen für die betriebs-
wirtschaftliche Ausgestaltung einer Stiftungslösung und den Überführungsprozess. Dabei war
es mir wichtig, eine möglichst große Vielfalt an Themen zu addressieren, mit denen sich
Unternehmer bei der Gestaltung ihrer Lösung auseinandersetzen müssen. Um der Heterogenität
der Zielsetzung einzelner Stifter und der Charakteristika der zu überführenden Unternehmen
Rechnung tragen zu können, wurde eine differenzierte Auswertung der empirischen Ergebnisse
vorgenommen. Die vorliegende Studie soll jedoch nicht nur eine Hilfestellung für Unternehmer
sein, die sich mit der Option der Stiftung für ihr Unternehmen auseinandersetzen, sondern auch
für Vertreter bestehender Stiftungslösungen, die diese kritisch hinterfragen bzw. optimieren
möchten.
Im August 2007 wurde die vorliegende Arbeit vom Promotionsausschuss der Universität Trier
als Dissertation angenommen. Zu ihrem Gelinger haben die Unterstützung und die
Anregungen, die ich von zahlreichen Personen erfahren habe, einen wichtigen Beitrag geleistet:
Allen voran bin ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Axel G. Schmidt zu großem Dank
verpflichtet. Seine konstruktiv-kritische Hinterfragung meiner Arbeit, seine stetige und
immerzu zeitnahe Unterstützung sowie seine motivierende und anspornende Art waren
entscheidend für ihr Gelingen. Für die freundliche Übernahme des Zweitgutachtens danke ich
Herrn Prof. Dr. Walter Schertler.
Ohne den intensiven Austausch mit Vertretern unternehmensverbundener Stiftungen, stiftungs-
getragener Unternehmen sowie Stiftern und Stiftungsexperten wäre die Entwicklung und
empirische Fundierung meiner Hypothesen nicht möglich gewesen. Ihnen danke ich sehr für
ihre Bereitschaft zu ausführlichen Gesprächen, dem Teilhabenlassen an ihren Erfahrungen und
den konstruktiv kritischen Diskussionen.
X Vorwort
Zudem gilt mein Dank meinem Arbeitgeber The Boston Consulting Group (BCG), der die
Rahmenbedinungen für diese Arbeit geschaffen hat. Ebenso danke ich der Friedrich-Naumann-
Stiftung, deren Stipendiatin ich während dieser Zeit sein konnte.
Viele Freunde und Kollegen haben mir während dem Entstehen dieser Arbeit unterstützend zur
Seite gestanden – auch Ihnen danke ich sehr, sehr herzlich. Ein ganz besonderer Dank gilt Max,
der mir den notwendigen Rückhalt gegeben und entscheidend dazu beigetragen hat, dass diese
Zeit so wunderschön war.
Meinen Eltern, die mich stets bedingungslos unterstützt, gefördert und ermutigt haben, widme
ich diese Arbeit in tief empfundener Liebe und Dankbarbeit.
Karin Fleschutz
Inhaltsübersicht
I Einleitung………………………………………………………………………………. 1
II Methodisches Vorgehen und Forschungsdesign…………………………………….. 19
III Grundlegende Begrifflichkeiten, konzeptioneller und theoretischer Bezugsrahmen… 41
IV Einzelfallstudien…………………………………………………………………….. 121
V Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungen zur Ausgestaltung der
unternehmensverbundenen Stiftung………………………………………………… 141
………….. 265
VII Weiterreichende Aspekte……………………………………………………………. 331
VIII Schlussbetrachtung………………………………………………………………….. 367
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht........................................................................................................................XI
Inhaltsverzeichnis..................................................................................................................XIII
Abkürzungsverzeichnis.........................................................................................................XXI
I Einleitung............................................................................................................................1
1 Einführung in das Forschungsthema und Diskussion seiner Relevanz............................1
2 Bisheriger Stand der Forschung.......................................................................................6
3 Ziel: Ableitung von Handlungsempfehlungen entlang von Leitfragen............................9
4 Realismus als wissenschaftstheoretischer Bezugsrahmen der Arbeit............................13
5 Struktur der Arbeit.........................................................................................................15
II Methodisches Vorgehen und Forschungsdesign............................................................19
1 Methodisches Vorgehen.................................................................................................19
2 Forschungskonzeption....................................................................................................22
3 Aussagekraft der Studie.................................................................................................27
3. 1 Kritische Betrachtung der Fallstudien-Forschung als Forschungsmethode...........27
3. 2 Reliabilität und Validität der Studie.......................................................................28
4 Datenerhebung...............................................................................................................28
4. 1 Bestimmung der Grundgesamtheit der uv. Stiftungen und ihrer Charakteristika..29
4. 2 Datenerhebung für die Stiftungslösungen und bei der Expertengruppe................30
4. 3 Datenerhebung bei Einzelfallstudien.....................................................................32
5 Materialaufbereitung......................................................................................................33
6 Datenauswertung............................................................................................................33
6. 1 Datenauswertung der Ist-Ausgestaltung.................................................................34
6. 2 Datenauswertung für die Ableitung der Handlungsempfehlungen........................34
6. 3 Faktorenanalyse als weiterführende Datenauswertung..........................................36
6. 4 Die Definition von Erfolg......................................................................................38