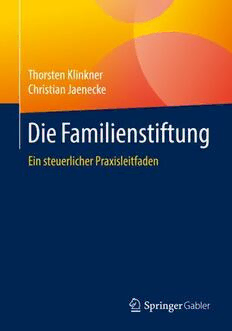Table Of ContentThorsten Klinkner
Christian Jaenecke
Die Familienstiftung
Ein steuerlicher Praxisleitfaden
Die Familienstiftung
Thorsten Klinkner • Christian Jaenecke
Die Familienstiftung
Ein steuerlicher Praxisleitfaden
Thorsten Klinkner Christian Jaenecke
Meerbusch, Deutschland Meerbusch, Deutschland
ISBN 978-3-658-25171-0 ISBN 978-3-658-25172-7 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25172-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich
vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk
bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt,
auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers
sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem
Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder
die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder
Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröf-
fentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist
ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Inhaltsverzeichnis
1 Errichtung einer Familienstiftung ................................... 1
1.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Begriffsabgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Ablauf des behördlichen Anerkennungsverfahrens . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3 V ermögensübertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 B esteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Erbschaft- und Schenkungsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1.1 Steuerpflicht .................................... 8
1.2.1.2 Wertermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1.3 Steuerberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.2.1.4 Steuerfestsetzung und Erhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.2 Grunderwerbsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.3 U msatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.2.4 Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.2.4.1 Übertragung von Betriebsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.2.4.2 Übertragung von Privatvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.2.5 K örperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2.5.1 Verlustvorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2.5.2 Zinsvortrag und EBITDA-Vortrag bei Anwendung der
Zinsschranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2.6 G ewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.2.7 U mwandlungssteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2 Laufende Besteuerung einer Familienstiftung .......................... 49
2.1 S teuerarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.1 Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.2 Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.2.1 Steuerpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.2.2 Gewerbliche Infizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.1.3 Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
V
VI Inhaltsverzeichnis
2.2 R echtsbeziehungen zwischen der Stiftung, dem Stifter und den
Begünstigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.1 Z ahlungen des Stifters an die Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.2 Z ahlungen der Stiftung an den Stifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.3 G ehaltszahlungen an den Vorstand und Mitglieder eines
Aufsichtsgremiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.4 Betriebsaufspaltung und umsatzsteuerliche Organschaft . . . . . . . . . 57
2.3 Besteuerung von Beteiligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.1 P ersonengesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.1.1 Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.1.2 Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.2 Kapitalgesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.2.1 Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.2.2 Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4 Besteuerung von Immobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.4.1 Ertragsteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.4.2 Internationales Steuerrecht – Besteuerung nach OECD-
Musterabkommen/Doppelbesteuerungsabkommen . . . . . . . . . . . . . 72
2.4.3 V erkehrsteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.5 Besteuerung sonstiger Wirtschaftsgüter des Privatvermögens . . . . . . . . . . . 77
2.6 B uchführung, Bilanzierung und steuerliche Gewinnermittlung . . . . . . . . . . 78
2.6.1 Handelsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.6.2 Bürgerliches Gesetzbuch und Landesstiftungsgesetze . . . . . . . . . . . 79
2.6.3 S teuerrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.7 Ö rtlich zuständige Finanzämter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.7.1 Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.7.2 Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.7.3 U msatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.7.4 Grundsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.7.5 Grunderwerbsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3 Besteuerung der Begünstigten ....................................... 87
3.1 Natürliche Personen als Begünstigte einer Familienstiftung . . . . . . . . . . . . . 88
3.1.1 Vermögenssorge von Eltern für minderjährige Kinder . . . . . . . . . . . 88
3.1.2 Z uwendung einer deutschen Familienstiftung an einen
Begünstigten im Inland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.1.3 Zuwendung einer deutschen Familienstiftung an einen
Begünstigten im Ausland nach dem OECD-Musterabkommen . . . . 91
3.1.3.1 Artikel 10 OECD-MA („Dividenden“) . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1.3.2 Artikel 21 OECD-MA („Andere Einkünfte“) . . . . . . . . . . 94
3.1.4 Zuwendung einer ausländischen Familienstiftung an einen
Begünstigten im Inland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.2 Juristische Personen als Begünstigte einer Familienstiftung . . . . . . . . . . . . . 97
Inhaltsverzeichnis VII
4 Besteuerung der Auflösung einer Familienstiftung ...................... 99
4.1 Erbschaft- und Schenkungsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2 Grunderwerbsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.3 Umsatzsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.4 Körperschaft- und Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.5 Gewerbesteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5 Erbersatzsteuer auf das Vermögen einer Familienstiftung ............... 105
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Errichtung einer Familienstiftung 1
1.1 Einleitung
1.1.1 Begriffsabgrenzungen
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und die Stiftungsgesetze der Länder enthalten keine
gesetzliche Definition des Begriffs „Stiftung“.
Eine selbstständige Stiftung im Sinne der §§ 80 bis 89 BGB1 ist eine juristische Person,
die (vergleichbar mit einer natürlichen Person) keine Anteilseigner, Gesellschafter oder
Mitglieder hat. Es handelt sich um eine verselbstständigte Vermögensmasse. Mit den lau-
fenden Erträgen des Stiftungsvermögens ist ein bestimmter Zweck2 zu erfüllen, den der
Stifter in der Satzung festlegt.
Ist laut Satzung keine zeitliche Begrenzung vorgesehen, kann die Stiftung so lange be-
stehen, wie ihr Zweck erfüllbar ist. Im Fall der Familienstiftung handelt es sich bei dem
Zweck der Stiftung um die Förderung und Unterstützung der laut Satzung begünstigten
Familienmitglieder. Anschließend wird die Stiftung entweder aufgelöst oder es tritt ein
durch den Stifter festgelegter Anschlusszweck in Kraft. Bei einem solchen Anschluss-
zweck kann es sich typischerweise um einen gemeinnützigen Zweck handeln, der im Fall
des Versterbens des letzten begünstigten Familienmitglieds in Kraft tritt.
1 Neben den rein stiftungsrechtlichen Normen der §§ 80 bis 89 BGB sind außerdem bestimmte Vor-
schriften des Vereinsrechts anzuwenden: Die Vorschriften der §§ 26 und 27 Abs. 3 und der §§ 28 bis
31a und 42 BGB finden entsprechend Anwendung. Die §§ 26 Abs. 2 S. 1, 27 Abs. 3 und 28 BGB
sind nur anwendbar, wenn die Stiftungsverfassung keine anderen Regelungen vorsieht.
2 § 81 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BGB.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019 1
T. Klinkner, C. Jaenecke, Die Familienstiftung,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-25172-7_1
2 1 Errichtung einer Familienstiftung
Der Wert des in der Satzung festgelegten Grundstockvermögens3 darf nicht vermindert
werden. Zulässig sind reine Vermögensumschichtungen, im Zuge derer der Wert des
Grundstockvermögens erhalten bleibt. Typischer Anwendungsfall der Vermögensum-
schichtung ist die Bargründung einer Stiftung, die mit ihrem Barvermögen anschließend
Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen erwirbt. Umgekehrt können auch Teile des
Grundstockvermögens gewinnbringend veräußert werden. Als zu erhaltender Wert kann in
der Satzung entweder der nominale oder der reale Wert des Grundstockvermögens fest-
gelegt werden.
Beraterhinweis
Anders als bei anderen Rechtsformen, wie der GmbH, AG oder Personengesellschaften
können die anlässlich der Gründung eingezahlten Barmittel des Grundstockvermögens
einer Stiftung nur zur Vermögensumschichtung, nicht aber für laufende Aufwendungen
genutzt werden. Gerade im Hinblick auf die Anfangszeit einer Stiftung ist sorgfältig zu
planen, dass mit dem Stiftungsvermögen ausreichend laufende Erträge erzielt werden,
um laufende Aufwendungen, wie Personalkosten, Miete oder Kontoführungsgebühren
zu finanzieren.
Da der Zweck der Stiftung aus den laufenden Erträgen heraus finanziert wird, gibt es
keinen „Schwellenwert“ des Vermögens, ab dem sich die Errichtung einer Stiftung lohnt.4
Maßgebend ist, ob die Höhe der laufenden Erträge des Stiftungsvermögens dazu aus-
reicht, den Zweck der Stiftung zu erfüllen und laufende Aufwendungen zu finanzieren.
Alternativ kann der Bestand der Stiftung auf einen bestimmten Zeitraum von mindestens
zehn Jahren begrenzt werden. Es handelt sich dann um eine Verbrauchsstiftung.5 Ihrem
Namen entsprechend darf die Verbrauchsstiftung neben den laufenden Erträgen auch ihre
Vermögenssubstanz verbrauchen, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Typischer Anwen-
dungsfall von Verbrauchsstiftungen sind Stiftungen, die anstelle von Unternehmensbetei-
ligungen, Immobilien oder anderen Ertragsquellen mit hohen Barvermögen ausgestattet
sind. Aus der Substanz des Barvermögens heraus können die Familienmitglieder über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg in dosierter Form unterstützt werden. Eigentümer des Ver-
mögens ist die Verbrauchsstiftung als juristische Person. Anders als im Fall der Dauertes-
tamentsvollstreckung6 ist das Vermögen damit nicht an das persönliche Schicksal eines
oder mehrerer Testamentsvollstrecker gebunden.
3 § 81 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 BGB.
4 In Literatur und Verwaltungspraxis wird zum Teil vertreten, dass eine Stiftung erst ab einer Min-
destvermögensausstattung von ca. EUR 50.000 anerkennungsfähig sei. Vgl. [9] Fischer in Feick
(2015), Stiftung als Nachfolgeinstrument, § 8 Rn. 4; [50] Schlüter/Stolte (2016), Stiftungsrecht,
Kap. 2 Rn. 96; [8] Ellenberger in Palandt (2019), Kommentar BGB, § 80 BGB Rn. 5. Die Zusage
eines Mindestvermögens ablehnend vgl. [6] Burgard (2002), NZG 2002, S. 699; [19] Hof (2014):
§ 6 Rn. 179; [17] Götz/Pach-Hassenheimb (2018), Handbuch der Stiftung, Rn. 133.
5 § 80 Abs. 2 S. 2 BGB.
6 §§ 2209, 2210 BGB.
1.1 Einleitung 3
Anders als die selbstständige Stiftung nach §§ 80 bis 89 BGB ist die nicht-rechtsfähige
Stiftung, die synonym auch als „Treuhandstiftung“, „unselbstständige Stiftung“ oder
„fiduziarische Stiftung“ bezeichnet wird, keine Rechtsform im eigentlichen Sinne, son-
dern ein Treuhandvermögen. Daher setzt die Handlungsfähigkeit jeder nicht-rechtsfähigen
Stiftung einen Stiftungsträger (= Treuhänder) voraus.
Beraterhinweis
Soll ein zeitlich unbegrenzter Bestand des Treuhandvermögens erreicht werden, empfiehlt sich eine
bereits bestehende selbstständige Stiftung als Treuhänderin. Auf diese Weise bietet auch die nicht-
rechtsfähige Stiftung die Möglichkeit, die rechtsformbedingten Vorteile einer selbstständigen Stif-
tung zum Beispiel gegenüber einer Dauertestamentsvollstreckung7 zu nutzen, ohne dabei selbst eine
selbstständige Stiftung errichten zu müssen.
Folgen der fehlenden Rechtsfähigkeit sind, dass die Regelungen des BGB und der Landes-
stiftungsgesetze keine Anwendung finden, kein behördliches Anerkennungsverfahren durch-
laufen wird und der Stiftungsträger nicht der Aufsicht durch die Stiftungsbehörde unterliegt.
Der Stiftungszweck8 kann entweder vorsehen, dass die Erträge des Stiftungsvermögens
einem bestimmten Personenkreis oder der Allgemeinheit zu Gute kommen. Bei einem ab-
geschlossenen Personenkreis handelt es sich um eine privatnützige Stiftung, bei einer Be-
günstigung der Allgemeinheit um eine Stiftung zur Erfüllung gemeinnütziger, mildtätiger
oder kirchlicher Zwecke.
Eine gängige Form der privatnützigen Stiftung ist die Familienstiftung. Merke: Die
Familienstiftung ist damit weder gemeinnützig, noch fällt sie in den Anwendungsbereich
der steuerbegünstigten Zwecke i.S.d. §§ 51 bis 68 AO. Die Unterscheidung von Stiftungen
anhand der verschiedenen Zwecke ist in der Abb. 1.1 zusammengefasst:
Stiftungszweck
gemeinnützig mildtätig kirchlich privatnützig
Familienstiftung sonstige Begünstigung
eines abgeschlossenen
Kreises an Begünstigten
Steuerbegünstigte Zwecke Regelbesteuerung
Abb. 1.1 Kategorisierung von Stiftungszwecken
7 §§ 2209, 2210 BGB.
8 § 81 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BGB.