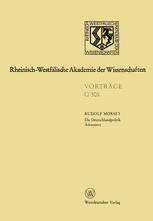Table Of ContentRheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften
Geisteswissenschaften Vorträge . G 308
Herausgegeben von der
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften
RUDOLF MORSEY
Die Deutschlandpolitik Adenauers
Alte Thesen und neue Fakten
Westdeutscher Verlag
340. Sitzung am 18. Juli 1990 in Düsseldorf
CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Morsey, Rudolf:
Die Deutschlandpolitik Adenauers: Alte Thesen und neue Fakten / Rudolf Morsey.
-Opladen: Westdeutscher Verlag 1991
(Vorträge / Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften: Geisteswissen
schaften; G 308)
ISBN 978-3-322-99046-4
NE: Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften <Düsseldorf>:
Vorträge / Geisteswissenschaften
Der Westdeutsche Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann International.
© 1991 by Westdeutscher Verlag GmbH Opladen
Herstellung: Westdeutscher Verlag
Satz, Druck und buchbinderische Verarbeitung: Boss-Druck, Kleve
ISSN 0172-2093
ISBN 978-3-322-99046-4 ISBN 978-3-322-99045-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-99045-7
Inhalt
I. Die Fehlbarkeit politischer Prognosen. 7
II. Die "Gespenster-Debatte" von 1989 . . 9
III. Methodologische Vorbemerkungen . . 10
IV. Deutschlandpolitische Zielvorstellungen bis 1949 14
V. Europäische Neudefinition der deutschen Interessen. 18
VI. Widersprüchliche Zeitangaben . . . . . . . . 21
VII. Offenhalten der Grenzfrage . . . . . . . . . . . 22
Vlli. Prioritätensetzung: Freiheit, Friede, Einheit .. 24
IX. Die "Bindungsklausel" des Deutschlandvertrags 25
X. Auch 1952: kein deutscher Sonderweg . . 27
XI. Verhandlungspartner aus eigener Stärke. . 30
XII. Die Verfestigung des Status quo. . . . . . . 33
Xlli. Die vertagte Lösung der Deutschen Frage. 36
XIV. Im Schatten der Berlin-Krisen . . . . . . . 39
XV. Der Mauerbau von 1961: "Die Stunde der großen Desillusion". 41
XVI. Das Offenhalten von Rechtspositionen . . . . . . . . . . . 44
XVII. "Der Realist als Visionär" .................. 46
XVlli. Exkurs: Die Suche nach der Quelle eines Adenauer-Zitats . 50
1 Die Fehlbarkeit politischer Prognosen *
Im Juni 1990 erschien die zweite Auflage eines 1988 erstmals veröffentlichten
Sammelwerks mit zwölf Beiträgen unter dem Titel "Adenauer und die Deutsche
Frage", herausgegeben von Josef Foschepoth. In einem Prospekt des Verlags
Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen wurde die Neuauflage wie folgt ange
priesen: "Wiedervereinigung - deutsche Einheit - die Deutsche Frage. Zum
Thema des Jahres."
Wenn die deutsche Einheit noch in diesem Jahr vollendet wird, dann aller
dings nicht wegen, sondern entgegen der Zielsetzung der meisten Autoren dieses
Sammelwerks und vor allem entgegen den Intentionen seines Herausgebers.
Denn in seinem Vorwort ist Foschepoth davon ausgegangen, die Lösung der
Deutschen Frage stehe "natürlich [I] weiterhin in den Sternen", um dann ebenso
apodiktisch zu erklären: "Zur Zweistaatlichkeit Deutschlands gibt es keine Alter
native."!
Diese grandiose Fehlprognose entwickelte er aus seiner Kritik der Deutschland
politik Adenauers, der nicht ernsthaft die Wiedervereinigung angestrebt habe.2
Nun ist die Abhängigkeit der Geschichtsschreibung von politischen Gegen
wartsströmungen nichts Neues, waren Zeitgeschichts-Debatten "stets auch Stell-
* Überarbeitete, erweiterte und mit Belegen versehene Fassung meines Vortrags vom 18. Juli 1990,
in die Ergebnisse der Diskussion eingearbeitet sind. - Eine Vorstudie ist veröffentlicht in: Vierzig
Jahre Deutschlandpolitik im internationalen Kräftefeld, hrsg. von Alexander Fischer. Köln 1989,
S. 16-31.
1 Adenauer und die Deutsche Frage. Göttingen 1988, S. 9 und 10. Das folgende Zitat ebd., S. 16. Dazu vgl.
auch Anm. 22.
2 Rolf Steininger hat die Ergebnisse dieses von ihm als "hervorragend" bewerteten Sammelbands auf
den "einfachen Nenner" gebracht: "Adenauer wollte die Wiedervereinigung nicht." In: Militärge
schichtliche Mitteilungen 46 (1989), S. 275. Demgegenüber urteilte Eckhard Jesse zutreffend, "die mei
sten" der insgesamt dreizehn Autoren verträten die Auffassung, Adenauer habe die Wiederver
einigung niemals gewollt, und fuhr fort: "Dies kann aber kein Makel sein, wenn es stimmt (und dafür
spricht so gut wie alles), daß eine Wiedervereinigung nicht im Bereich des Möglichen war." In: Süd
deutsche Zeitung vom 30. August 1988.
8
vertreterkriege" . 3 Nur hat die historische Wirklichkeit inzwischen alle diejenigen
eingeholt, die noch bis vor wenigen Monaten glaubten, aus dem Verlauf der
letzten vierzig Jahre der deutschen Geschichte Prognosen für die Dauerhaftig
keit der Zweistaatlichkeit Deutschlands ableiten zu können. In dieser Hinsicht
wird neben dem erwähnten Sammelband das Protokoll Nr. 88 des Bergedorfer
Gesprächskreises, der am 6. und 7. September 1989 in Bonn tagte,4 künftig eine
Geschichtsquelle für politische Wunschvorstellungen bilden.5
Welche neuen Ergebnissen und Erkenntnisse demgegenüber aus neuen Inter
pretationen schon bisher zugänglicher Quellen gewonnen werden können, zeigt
die vor wenigen Monaten publizierte, von Karl Dietrich Bracher betreute Bon
ner Dissertation von Peter Siebenmorgen. Er hat unter dem - m. E. allerdings
unglücklich gewählten - Titel "Gezeitenwechsel" den "Aufbruch zur Entspan
nungspolitik" (so der Untertitel) untersucht,6 und zwar mit folgendem Ergebnis:
Der erste deutsche Politiker, der sich der Vokabel und des Begriffs Entspannung
bediente, war Konrad Adenauer, und zwar schon seit Ende 1951.
Nun hat Hans-Peter Schwarz darauf bereits 1965/68 aufgrund seiner nach wie
vor gültigen Analyse von Adenauers Memoiren hingewiesen7 und diesen Gedan
kengang 1978 und 1979 ausführlicher entfaltet.8 Auf jeden Fall dürfte die neue,
systematisch angelegte Beweisführung von Siebenmorgen alle jene nachdenklich
3 So Konrad Repgen, Konrad Adenauer und die Wiedervereinigung Deutschlands in einem freien ver
einten Europa, in: Heimat und Nation, hrsg. von Klaus Weigelt. Mainz 1984, S. 306.
4 Hamburg o.J. Das Tagungsthema lautete: "Auf dem Wege zu einem neuen Europa? Perspektiven
einer gemeinsamen westlichen Ostpolitik."
, Hier nur drei Zitate: "Ich sage klar, dies [die Realisierung des Anspruchs auf Selbstbestimmung]
wird niemanden in den nächsten fünfzehn Jahren beschäftigen müssen"; "Wenn unsere Forde
rungen darauf hinauslaufen, den Menschen drüben ihren Staat wegzunehmen, dann werden sie dies
mit Sicherheit nicht zulassen" (Egon Bahr, S. 44, 62); "Die deutsche Frage wird gelöst werden, aber
sicherlich erst im nächsten Jahrhundert" (Helmut Schmidt, S. 47). Vgl. auch Anm. 27. Egon Bahr
wenig später: "Laßt uns in aller Welt aufhören, von der Einheit zu träumen oder zu schwärmen."
Bild am Sonntag 1. Oktober 1989.
6 Bonn 1990. - Der Aufsatz von"Waiter Voge~ Vertane Chancen? Die Deutschlandfrage in den Kon
zeptionen der Besiegten in Westdeutschland 1945-1955, in: Geschichte in Wissenschaft und Unter
richt 41 (1990), S. 396-417, konnte für den Vortrag nicht mehr einbezogen werden. Ich gehe darauf
in einigen Anmerkungen ein.
7 Weitergeführt in seinem Beitrag "Das außenpolitische Konzept Konrad Adenauers", in: Adenauer
Studien 1, hrsg. von RudoH Morsey und Konrad Repgen. Mainz 1971, S. 71ff., bes. 90f., 98. (Nach
druck in: Klaus Gotto, Hans Maier, Rudolf Morsey, Hans-Peter Schwarz, Konrad Adenauer. Seine
Deutschland-und Außenpolitik. München 1975, S. 97ff.) Vgl. auch einschlägige und entsprechend
ausgewertete Adenauer-Zitate bei Anneliese Poppinga, Konrad Adenauer. Geschichtsverständnis,
Weltanschauung und politische Praxis. Stuttgart 1975, S. 140ff., 267ff. u. ö. Zum Verlauf der For
schung P. Siebenmorgen, Gezeitenwechsel (wie Anm. 6), S. 415ff.
8 Zunächst 1978 in den "Rhöndorfer Gesprächen" unter dem Titel "Die deutschlandpolitischen Vor
stellungen Konrad Adenauers 1955-1958" in: Entspannung und Wiedervereinigun~ hrsg. von Hans
Peter Schwarz. Stuttgart 1989, S. 17ff.; ders., Adenauer und Europa, in: Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte 27 (1979), S.477, 511.
9
machen, die den ersten Bundeskanzler nur als immobilen "Kalten Krieger" und
Verfechter einer "Politik der Stärke" in Erinnerung haben.
/L Die "Gespenster·Debatte" von 1989
Der letzte Versuch, Adenauers Deutschlandpolitik politisch zu instrumentalisie
ren, erfolgte vor Jahresfrist. Mitte Juli 1989 erhielt die im Frühsommer 1989 aktua
lisierte, aber bereits wieder abgeklungene politische Debatte um Deutschlands
Rechtslage durch eine vermeintlich sensationelle historische. Entdeckung einen
neuen Akzent. Der Kölner Politikwissenschaftler Karl Kaiser behauptete, Bundes
kanzler Adenauer habe in den frühen fünfziger Jahren - später grenzte er ein: im
November/Dezember 1951, im Zuge der Verhandlungen um den Deutschlandver
trag - gegenüber den drei Westmächten die Oder-Neiße-Grenze förmlich, jedoch
insgeheim, anerkannt.9
Kaiser - seit 1973 auch Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesell
schaft für Auswärtige Politik in Bonn - war allerdings nicht in der Lage, die ver
meintliche Verzichtserklärung Adenauers auf die deutschen Ostgebiete zu datie
ren, geschweige denn zu belegen. Als Quelle nannte er einen anonym bleibenden
Informanten, kehrte die Beweislast für seine Enthüllung um und schob sie der
Bundesregierung zu.
Er behauptete, die betreffenden Dokumente - zunächst war von einem Ver
trag aus zwei Paragraphen bzw. von einer "einseitigen Erklärung" die Rede,
schließlich von angeblichen "Briefen" Adenauers an die Regierungen der drei
Westmächte - befänden sich im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in
Bonn sowie in den Archiven der drei Vertragspartner.
Die Märchenerzählung des Kölner Politikwissenschaftlers - den Rudolf Aug
stein als Historiker vorstelltelO - entfesselte schlagartig eine Phantom-Diskussion. 11
9 Am 11.Juli 1989 im Deutschlandfunk (Köln), zitiert auch am folgenden Tage in den "Informationen
am Abend" des gleichen Senders. Kaisers Behauptungen sind in der Presse am 13. Juli und in den
folgenden Tagen ausführlich referiert, von einigen Zeitungen sogar als Spitzenmeldungen gebracht
worden (Kölnische Rundschau: "Wirbel um ,Geheimzusage'"; Expreß [Köln]: "Sensationelle Ent
hüllungen über Adenauer"; Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Verwirrung um eine angebliche Ver
zichterklärung Adenauers"; Die Welt: "Suche nach Adenauer-Brief"; Die Zeit vom 28. Juli: "innen
politische Bombe").
10 In: Der Spiegel vom 17. Juli 1989, S. 22, wo aber schon bemerkenswert distanzierend von "dem
eigentlich [I] renommierten Wissenschaftler" Kaiser die Rede war (S. 19). In Presseberichten war
Kaisers SPD-Mitgliedschaft erwähnt (seit 1964: vgl. Munziger-Archiv/lnternationales Biographi
sches Archiv 49/1989, S. 2).
11 In einem Interview wird Kaiser so zitiert: "Ich hin Politologe und kein Zeithistoriker" , und weiter:
"Ich rede doch nicht von einem Phantompapier. Es ist gesehen worden." Stern (Hamburg) vom
27.Juli 1989, S. 19.
10
Dieser "Sommerloch-Knüller"12 galt als neuer "Historikerstreit".l3
Der Fall Kaiser ist aus zwei Gründen exemplarisch. Zunächst zeigte er In
concreto, wie nützlich es erschien, zur Durchsetzung politischer Zielel4 - in
diesem Falle: Anerkennung der Ostgrenze Deutschlands - eine gleichsam histo
rische Bestätigung vorweisen zu können, wenn nicht gar den ersten Bundes
kanzler gegen dessen "Erben" auszuspielen.
Zum anderen bestätigte die von Kaiser ausgelöste "Gespenster-Debatte",IS ein
wie dankbares Objekt Adenauer für politische Spekulationen geblieben war; ihm
traute man ohne weiteres das jeweils "Schlimmste" ZU.16
IIf. Methodologische Vorbemerkungen
Weil das so ist, möchte ich meinem Referat zwei methodologische Hinweise
zur Denk-und Arbeitsweise des Historikers voranstellen. Zunächst wird bei der
Behandlung unseres Themas nicht immer genügend unterschieden zwischen dem
Verlauf der Geschichte, also der Tatsächlichkeit historischer Ereignisse, ihrer
Wahrscheinlichkeit und ihrer (Denk-)Möglichkeit. An die Notwendigkeit einer
klaren Unterscheidung dieser drei "logischen Grundformen jeder geschichts
wissenschaftlichen Erkenntnis (und Aussage über sie)" hat erst kürzlich Konrad
Repgen wieder erinnert. 17
13 Am 14.Juli 1989 im General-Anzeiger (Bonn), in der Neuen Ruhr-Zeitung ("Historiker streiten um
Adenauer") und in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. In der Süddeutschen Zeitung war von
einem "unfertigen Beitrag" Kaisers zur Grenzdiskussion die Rede. -Am Tage des Düsseldorfer Vor
trags (18. Juli 1990) hat ein Kommentator des Westdeutschen Rundfunks vom "Historikerstreit des
vergangenen Jahres" gesprochen. Hinweis von Konrad Repgen in der Diskussion des Vortrags.
14 Kaiser war 1980 Kandidat für das Amt des Wirtschaftsministers im Schattenkabinett von Oskar
Lafontaine im Landtagswahlkampf im Saarland. Laut Munziger-Archiv (wie Anm. 10).
1S So General-Anzeiger (Bonn) vom 15. Juli 1989. "Gespenstische Diskussion"lautete eine Zwischen
überschrift in einem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung vom gleichen Tage. Die in Anm. 10
zitierte Biographie Kaisers schließt mit der Feststellung: "Ein schlüssiger Beweis für die Existenz
des Papiers wurde bisher nicht geliefert." Ludwig Biewer spricht von einer "zum Teil leidenschaft
lieh geführten Diskussion", deren Initiator keinen Beweis für seine Behauptung habe vorlegen
können. Konrad Adenauer und der Osten -sein Verhältnis zu Preußen und Berlin, in: Auswärtiger
Dienst H. 2/3 (1989), S. 157.
16 Eine Überschrift in der Frankfurter Rundschau vom 15. Juli 1989 lautete: "Zuzutrauen war's ihm
schon". Ähnlich in einem Kommentar von Detmar Cramer im Deutschlandfunk am gleichen
Tage: "Möglich ist es durchaus, ..." . In einem späteren Artikel "Die Bundesregierung stellt keine
Ansprüche ..." sprach Kaiser von seinem "auf Zeugen gestützten Hinweis" vom Juli, und beharrte
darauf, daß das ominöse "Dokument" existiere. In: Die Zeit vom 29. September 1989. Die bisher
abschließende Stellungnahme bei Wilhe1m G. Grewe, Eine unsinnige Behauptung und eine falsch
gelesene Quelle, Leserbrief in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. Oktober 1989, zustimmend
referiert von Diether Passer, Die deutsche Frage, in: Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden
1 (1990), S. 5.
11
Konkret: Von manchen Historikern wird jede einzelne, noch so sehr aus ihrem
Zusammenhang isolierte Äußerung Dritter, die geeignet erscheint, den Wieder
vereinigungswillen Adenauers in Frage zu stellen, zum Nennwert genommen.
Den gleichen Stellen- und damit Quellenwert erhalten deutschlandpolitische
Planungen und Überlegungen von politischen Gegenspielern des ersten Bundes
kanzlers. Auf diese Weise wird Denkmöglichkeiten und Konzeptionen, deren
Tragfähigkeit nicht erprobt zu werden brauchte, von vornherein der Rang reali
stischer Alternativen zugesprochen. Selbst Aussagen kommunistischer Diktato
ren sind davon keineswegs generell ausgenommen.
Das genau umgekehrte Verfahren hingegen wird auf Adenauers eigene Äuße
rungen über seine Deutschlandpolitik angewandt. Sie werden nicht im Sinne
einer Zielsetzung und ihrem Gehalt nach befragt, sondern, im günstigsten Fall,
als taktisch gemeinte Manöver toleriert und interpretiert.18 Dabei bleiben zwei
Tatsachen unberücksichtigt: die große Zahl und die Konstanz einschlägiger Aus
sagen des ersten Bundeskanzlers in der Öffentlichkeit wie in nicht öffentlichen
Äußerungen. Sie aber sprechen gegen die Möglichkeit einer gezielten Verschleie
rung und für eine Identität dieser Auffassungen, "die nicht anders erklärt werden
kann als aus der Authentizität des Gesagten".19
So hat Adenauer alle Fragen nach seiner langfristigen Wiedervereinigungs
strategie zwar mit situationsbezogenen Varianten beantwortet, sich aber niemals
widersprochen: "Er hat daran geglaubt".20 Eine so allgemein formulierte Aussage
wie die von Willy Brandt, "der ,Alte vom Rhein'" habe "über weite Strecken
anders geredet als gedacht",21 führt für unsere Fragestellung nicht weiter.
Eine zweite methodologische Vorbemerkung gilt der Ansicht, Adenauers
Äußerungen über seine deutschlandpolitischen Ziele seien vornehmlich oder gar
nur als Ablenkungs- und Durchhalteparolen zu verstehen, als Alibi-Argumen
tation vor allem gegenüber den Vertriebenen- und Flüchtlingsverbänden. Das
Offenhalten der Grenzfrage habe dazu gedient, die "Bedrohungsangst vor dem
17 Reichskonkordats.Kontroversen und historische Logik, in: Demokratie und Diktatur, hrsg. von
Manfred Funke u. a. Düsseldorf 1987, S. 158.
18 Josef Foschepoth geht von vornherein davon aus, daß zwischen Adenauers Worten und seiner "tat
sächlichen Politik" in der Wiedervereinigungsfrage "eine große Kluft" bestanden habe. Adenauers
Moskaureise 1955, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 22 (1986), S. 38. Ebenso Dieter Staritz,
Von der "Befreiung" zur "Verantwortungsgemeinschaft". Die Deutschlandpolitik der Bundes
republik und der DDR, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 37 (1987), S. 39.
19 So Heinz Hürten, Der Patriotismus Konrad Adenauers. Bonn 1990, S. 20.
20 So Hans-Peter Schwarz, Die deutschlan4'politischen Vorstellungen Adenauers (wie Anm. 8), S. 18.
21 Erinnerungen. Frankfurt 1989, S. 54. Ahnlich ("falls Adenauer wirklich glaubte, was er sagte")
Rolf Steininger, Freie, gesamtdeutsche Wahlen am 16. November 1952? In: Die Republik der fünf
ziger Jahre. Adenauers Deutschlandpolitik auf dem Prüfstand, hrsg. von Jürgen Weber. München
1989, S. 109.