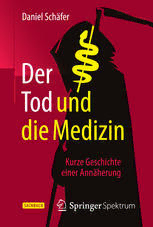Table Of ContentDer Tod und die Medizin
Daniel Schäfer ist Arzt, Medizin-
historiker und Professor am Institut
für Geschichte und Ethik der Medi-
zin der Universität zu Köln. Schon
früh begeisterten ihn sowohl Life
Sciences als auch Geisteswissen-
schaften, deshalb studierte er Medi-
zin und Germanistik. Eine kreative
Verbindung fand sich schließlich
in der Medizingeschichte, über die
er seit 1995 an der Universität zu Köln lehrt und forscht.
Literarische Neigungen zum Vergänglichen offenbaren be-
reits seine beiden Dissertationen zum Tod im Spätmittel-
alter (Germanische Philologie) und zum historischen Kai-
serschnitt an der toten Frau (Humanmedizin). Auch die
Habilitation über den ärztlichen Blick auf das Alter in der
Frühen Neuzeit thematisiert die letzte Lebensphase. Seit ei-
niger Zeit arbeitet Schäfer zu medizinischen Todeskonzep-
ten, zur Geschichte des Gesundheitsbegriffs und über Ent-
würfe eines guten Alter(n)s in Geschichte und Gegenwart.
Daniel Schäfer
Der Tod und die
Medizin
Kurze Geschichte einer Annäherung
Daniel Schäfer
Institut für Geschichte
und Ethik der Medizin
Universität zu Köln
Deutschland
ISBN 978-3-662-45206-6 ISBN 978-3-662-45207-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-45207-3
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben
und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die
Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt
des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Spektrum
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist,
bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen
usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der
Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-
Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt
werden dürften.
Planung: Frank Wigger
Einbandabbildung: deblik, Berlin
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Spektrum ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der
Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer-spektrum.de
Vorwort
Seit das Schreiben erfunden wurde, gibt es Literatur über
das Sterben. Auch die Geschichte des Todes ist (nicht erst
seit Philippe Ariès) ein gut erkundetes Terrain der Kultur-
und Mentalitätshistorie, der Archäologie, der Demografie
und vieler anderer Wissenschaftsdisziplinen. Längst haben
Medizingeschichte und Medizinethik den Tod entdeckt,
vielleicht zuerst bei der Untersuchung spektakulärer Seu-
chen und der vermeintlich gruseligen Anatomie. Inzwi-
schen füllen die Analysen zu Sterbehilfe, Palliativmedizin
und Organtransplantation ganze Bibliotheken. Doch we-
sentlich seltener wird über den beruflichen Umgang des
Arztes1 mit Sterbenden oder gar seine theoretische Ausein-
andersetzung mit Sterben und Tod reflektiert. Und schließ-
lich finden sich – verständlich angesichts der Komplexität
der einzelnen Themen – kaum fach- oder epochenübergrei-
fende Darstellungen. Nur gelegentlich stellen Publikatio-
nen Bezüge zwischen den einzelnen Bereichen her, in denen
1 Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren Ärzte fast immer Männer, aber
demnächst gibt es in Deutschland mehr Ärztinnen als Ärzte. Selbstverständlich
behandel(t)en sie auch Patientinnen oder hatten mit Sterbenden (Frauen) zu
tun. Deshalb sind in diesem Buch mit Ärzten, Patienten und weiteren sozialen
Gruppen selbstverständlich beide Geschlechter gemeint, sofern dies der histori-
schen Realität entspricht.
VI Der Tod und die Medizin
Medizin und Tod einander begegnen, und fast nie weisen
sie auf Bindeglieder zwischen Geschichte und Gegenwart
dieser Begegnungen hin. Was hat die erste Herzverpflan-
zung mit der medizinischen Todesfeststellung zu tun, was
der Wunsch nach Sterbehilfe mit der Medikalisierung des
Ablebens im westlichen Kulturkreis und was die Erfindung
des Reihengrabes mit der zeitgleichen Abnahme der Kin-
dersterblichkeit?
Dieses Buch will keine neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse im engeren Sinne vermitteln; vielmehr will es
einem breiten Publikum neue Überblicke bieten. Es soll
Lust machen zum (Wieder-)Entdecken der vielfältigen Be-
züge, die zwischen Heilkunde und Lebensende im jeweili-
gen zeithistorischen Kontext bestanden und bestehen. Als
Zeitrahmen werden dabei die vergangenen drei Jahrtau-
sende aufgespannt; der kulturelle Fokus richtet sich auf das
Abendland. In fünf Kapiteln sowie einigen Exkursen soll
mit vielen unterhaltsamen Beispielen ein breites medizin-
und kulturhistorisches Panorama vor Augen geführt und
stets auch die Brücke zur Gegenwart geschlagen werden –
wodurch sich manche aktuelle Positionen und Probleme
erklären. Die Darstellung beginnt mit der etwas trockenen
Frage nach einer Definition und Deskription des Todes –
konnten Mediziner dazu eigene Antworten jenseits von
Philosophie und Theologie entwickeln? Die weiteren Ka-
pitel orientieren sich dann stärker an der medizinischen
Praxis: Wie wurde und wird der bevorstehende Tod er-
kannt, wie der eingetretene festgestellt, und was davon war
zu welcher Zeit wichtiger? Henker oder Helfer, machtlose
Sterbliche oder erbitterte Kämpfer gegen den Tod – welche
Rollen nehmen die Heiler angesichts der letzten Dinge ein?
Vorwort VII
Wie haben sich Ursachen und Umstände des Sterbens ver-
ändert, und wie gehen Ärzte mit Sterbenden um: mit ihnen
leidend, sie meidend oder gar als Versuchsobjekte missbrau-
chend? Und schließlich: Was bedeutet die Leiche für den
Mediziner: Entsorgungsproblem, Studierobjekt oder gar
Organbank? Am Ende soll ein knappes Resümee, gewisser-
maßen als roter Faden des ganzen Buches, die zwei gro-
ßen Verbindungslinien zwischen den vielen verschiedenen
Themen verdeutlichen: einerseits die fortwährende Distanz
zwischen Heilkunde und Tod, die nur auf den ersten Blick
erstaunlich ist, und andererseits eine vorsichtige Annähe-
rung der beiden ungleichen Partner über die Jahrhunderte.
Tod und Medizin – es ist auch für den Autor erstaunlich,
wie groß die Berührungs- und Reibungsflächen zwischen
diesen beiden Antagonisten waren und sind und welche
produktiven, aber auch destruktiven Energien aus diesem
Spannungsverhältnis entstehen können. Er dankt dem Ver-
lag Springer Spektrum für die Bereitschaft, ein Buch über
ein so breites Thema zu wagen und seine Entstehung sorg-
fältig zu begleiten. Und er wünscht seinen Leserinnen und
Lesern eine dementsprechend unerschrockene, aber auch
spannende Lektüre.
Inhalt
1
Was ist der Tod? ����������������������������������������������������������������� 1
2
Den Tod erkennen − den Tod vermeiden ������������������������� 53
3
Ärztliches Image im Umgang mit dem Tod ���������������������� 95
4
Woran, wie und wo wir sterben ��������������������������������������� 149
5
Nach dem Tod: Umgangsweisen mit der Leiche �������������� 191
6
Medicine meets death – ein Resümee ����������������������������� 229
Index ����������������������������������������������������������������������������������� 235
1
Was ist der Tod?
Wenn ein Mensch in Deutschland verstorben ist, so stellt
ein Arzt den Tod fest und dokumentiert das Ergebnis der
Untersuchung in einem Totenschein. Dieser Vorgang ist
zumindest für unsere heutigen westlichen Gesellschaften
selbstverständlich: Ärztinnen und Ärzte haben gewöhn-
lich den staatlichen Auftrag, ja geradezu das Monopol, den
Tod zu bestimmen. Von ihrem Urteil hängen viele weitere
Schritte ab: Der Körper des Verstorbenen, jetzt eine Leiche,
muss bestattet werden; sein Hab und Gut geht in andere
Hände über.
Was für uns heute völlig normal ist, war lange Zeit an-
ders. Erst seit den letzten 150 bis 200 Jahren übernehmen
Ärzte die Todesfeststellung; vorher waren es meist medi-
zinische Laien, in erster Linie Angehörige des Verstorbe-
nen, die diese Aufgabe besorgten. Wie das konkret geschah
und warum es zu dieser Veränderung kam, werden wir im
nächsten Kapitel betrachten. Doch hier soll zunächst über-
legt werden, was Ärzte grundsätzlich über den Tod dachten,
wie sie ihn beschrieben und definierten. Dass sie das taten,
liegt nahe; denn diejenigen, die den Tod feststellen, setzen
sich am ehesten auch damit auseinander, was der Tod ist.
D. Schäfer, Der Tod und die Medizin, DOI 10.1007/978-3-662-45207-3_1,
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015