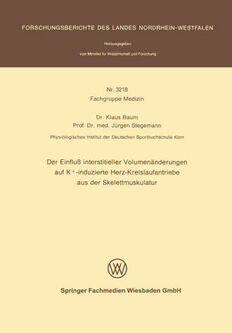Table Of ContentFORSCHUNGSBERICHTE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN
Nr. 3218 / Fachgruppe Medizin _
Herausgegeben vom Minister für Wissenschaft und Forschung
Dr. Klaus Baum
Prof. Dr. med. Jürgen Stegemann
Physiologisches Institut
der Deutschen Sporthochschule Köln
Der Einfluß interstitieller Volumen
änderungen auf K+-induzierte Herz-Kreislauf
antriebe aus der Skelettmuskulatur
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 1987
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Baum, Klaus:
Der Einfluss interstitieller Volumenănderungen
auf K+-induzierte [K-induzierte] Herz-Kreislauf
antriebe aus der Skelettmuskulatur 1 Klaus Baum;
Jtirgen Stegemann. - Opladen: Westdt. Verl., 1987
(Forschungsberichte des Landes Nordrhein
Westfalen; Nr. 3218: Fachgruppe Medizin)
NE: Stegemann, Jtirgen:; Nordrhein-Westfalen:
Forschungsberichte des Landes ...
ISBN 978-3-663-19987-8 ISBN 978-3-663-20337-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-20337-7
© 1987 by Springer Fachmedien Wiesbaden
Ursprlinglich erschienen bei Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen 1987.
I I I
Inhalt
1 Einleitung 1
1.1 Hinweise auf Herz-Kreislaufantriebe aus der
arbeitenden Muskulatur 1
1.1.1 Zusammenhang zwischen Herzfrequenz und Stoff
wechsel 1
1.1. 2 Interstitielle freie Nervenendigungen und deren
mögliche Reizgrößen 2
1.1. 3 Herzfrequenzsteigerungen nach arterieller KCl
Infusion 5
1.1. 4 Gruppenzugehörigkeit der Herz-Kreislauf beein
flussenden Afferenzen 6
1.2 Problemstellung der vorliegenden Arbeit: tlber-
prüfung der Grundthese vorangegangener Unter
suchungen 7
1.3 Notwendige Bedingungen des Präparates 10
1.4 Übersicht über Volumina eines Muskelgebietes 12
1. 4.1 Extrazellulärraum 13
1.4.1.1 Volumen des Vasal raumes 13
1.4.1.2 Volumen des Interstitiums 14
2 Methode 17
2.1 Untersuchungsgut 17
2.2 Narkose und Präparation 18
2.3 Versuchs aufbau 19
2.3.1 Perfusionslösungen 21
IV
2.3.2 Perfusionssystem 22
2.4 Gewichtsbestimmungen 22
2.5 Berechnung des Proteingehaltes der ödem
flüssigkei t 23
2.6 Volumenbestimmungen 24
2.7 Herzfrequenz 26
2.8 Stoffwechselgrößen 26
2.8.1 Sauerstoffverbrauch 26
2.8.2 Laktatausschwemmung 27
2.9 Kaliumausschwemmung 27
2.10 Einteilung der Versuche in einzelne Serien 28
3 Ergebnisse 32
3.1 Ergebnisse der Serien 1 und 2 (Perfusion
mit konstanter [K3) 32
3.1.1 Muskelgewichte 32
3.1. 2 Gewichtsveränderungen des Perfundates 33
3.1. 3 Größe und Veränderung des Saccharoseraumes 34
3.1.4 Sauerstoffaufnahme 35
3.1. 5 Laktazider Stoffwechsel 35
3.1. 6 K+-Bilanz 37
3.1. 7 Korrelation zwischen K+- und Laktat
ausschwemmung 38
3.1. 8 Herzfrequenz 39
3.2 Ergebnisse der Serien 3, 4 und 5 (Sprungförmige
[!c:J
Veränderung der arteriellen bei freier
Vo1umenexpansion) 42
3.2.1 Muske1gewichte 42
3.2.1.1 Gewichtsveränderungen des Perfundates 43
3.2.2 Gesamtwiderstand des Präparates 45
3.2.3 Laktatausschwemmung 45
3.2.4 pH und pC02 47
3.2.5 Saccharoseeinschwemmung 49
v
3.2.5.1 Saccharosekonzentration im Venenausfluß 49
3.2.5.2 Saccharoseraum 51
3.2.6 Glukoseeinschwemmung 53
3.2.6.1 Glukosekonzentration im Venenausfluß 53
3.2.6.2 Glukoseraum 53
3.2.7 K+-Einschwemmung 54
3.2.7.1 K+ Konzentration im Venenausfluß 54
3.2.7.2 K+-Raum 56
3.2.8 Herzfrequenz 56
3.3 Ergebnisse der Serie 6 (Perfusion mit arteriell
sprungförmig veränderter [K:) und Volumenreduk-·
tion des Interstitiums) 60
3.3.1 Stoffwechsel größen 60
3.3.2 Gewichtsveränderungen des Perfundates 60
3.3.3 Saccharose-Raum 60
3.3.4 Herzfrequenz 61
4 Diskussion 63
4.1 Flüssigkeitsaustausch zwischen Gefäßraum und
Interstitium 63
4.2 Ödementwicklung des Perfundates 65
4.3 Volumen des Extrazellulärraumes 66
4.4 Einschwemmkinetiken von Saccharose und K+ 67
4.5 Stoffwechsel 69
4.5.1 Die Bedeutung des aeroben und anaeroben Stoff
wechsels für die Energiebereitstellung 69
4.5.2 Zusammenhang zwischen arterieller K+ und Stoff
wechsel 72
4.5.3 K+-Bilanzierung 73
4.6 Herzfrequenz 79
4.6.1 Die Auswirkung der Narkose auf die Herzfrequenz 79
4.6.2 Das Herzfrequenzverhalten bei Veränderung der
extrazellulären (K:J 80
VI
4.6.3 Die Grundtendenz der Herzfrequenz während der
Perfusionszeit 83
4.7 Hypothese über den Ursprung der Volumenabhän
gigkeit der Rezeptoren 86
4.7. I Versuch einer quantitativen Abschätzung der
Aktivitätsverteilung mobiler Ionen zwischen
Gel- und Flüssigkeitsphase 88
4.8 Zusammenfassende Hypothese: Die intrazelluläre
Kreatinphosphat-Konzentration als indirekte
Regelgröße der Herzfrequenz bei Arbeit 92
4.9 Die Bedeutung der Ergebnisse für nachfolgende
Untersuchungen 92
5 Zusammenfassung 94
6 Literatur 96
Lebenslauf
VII
Übersicht über die wichtigsten verwendeten Abkürzungen:
AVD Arterio-venöse Differenz
Cl Chlorion
EZR Extrazellulärraum
Feuchtgewicht der Kontrollmuskulatur
Trockengewicht der Kontrollmuskulatur
Trockengewicht der Perfusionsmuskulatur
Wasserstoffion
HR Herzfrequenz
Kaliumion
Lak Laktat
Na+ Natriumion
Pi anorganisches Phosphat
Sacch Saccharose
SD Standardabweichung
SE Standardfehler
Fil trat ion
Sauerstoffaufnahme
Gewichtsveränderung der Perfusionsmuskulatur während
der Perfusion
[zJ Konzentration der Substanz z
als Indizes:
a arteriell
e extrazellulär
G Glukose
S Saccharose
v venös
- 1 -
1 Einleitung
1.1 Hinweise auf Herz-Kreislaufantriebe aus der arbeitenden Mus
kulatur
1.1.1 Zusammenhang zwischen Herzfrequenz und Stoffwechsel
Veränderungen der Stoffwechsellage, z.B. bei erhöhter Aktivität
der Skelettmuskulatur, führen zu Änderungen des Sympathikustonus.
Als Indikator dieser Umstellung im autonomen Nervensystem wird in
vielen Untersuchungen die Herzfrequenz benutzt, da sie leicht und
ohne großen apparativen Aufwand zu erfassen ist. Allgemein aner
kannt wird hierbei, daß sich das individuelle Belastungsniveau
mit Hilfe der Herzfrequenz abschätzen läßt. Dagegen herrscht über
den ursächlichen Zusammenhang zwischen Leistung und Herzfrequenz
noch Uneinigkeit. Die in der Literatur diskutierten Theorien
wurden im Jahr 1971 von Stegemann und Kenner sowie in neuerer
Zeit von Rowell (1980) zusammengestellt. In beiden Arbeiten wird
die Regelung durch metabolische "Muskelrezeptoren" favorisiert,
da die primäre Bedeutung anderer Theorien (zentrale Mitinervation
des Kreislaufzentrums, Pressorezeptorenreflex, Bainbridgereflex)
durch verschiedene Untersuchungen entkräftet werden konnten (As
mus sen et al. 1943, Holmgren 1956, Guyton 1963, Stegemann 1963,
Bevegard und Shepherd 1966, Rowell et al. 1968).
Die These von muskulären Rezeptoren, deren Afferenzen Herz-Kreis
laufreflexe auslösen, entwickelte sich aus den Untersuchungen von
A1am und Smirk aus den Jahren 1937 und 1938. Die Autoren isolier
ten im Humanversuch Extremitäten humoral durch Druckmanschetten,
- 2 -
wobei der verwendete Druck oberhalb des systolischen lag. Sowohl
der mittlere Blutdruck als auch die Herzfrequenz stiegen bei
Arbeit mit der isolierten Muskulatur an und blieben so lange
erhöht, bis die humorale Verbindung wieder hergestellt wurde. Die
Signalübermittlung konnte wegen der Okklusion nur neuronal er
folgt sein.
In den letzten Jahren konnten diese Befunde mit methodisch
vergleichbaren Ansätzen bestätigt und detailierter beschrieben
werden (Stegemann 1963a, Rowe11 et a1. 1976, Freund et a1. 1978).
Demnach ist das Herzfrequenzverhalten nach Belastung abhängig von
der abgebundenen Muskelmasse und bei gleicher Masse von der Dauer
der Okklusion, zusammengefaßt also von dem Betrag der Sauerstoff
schuld.
Für eine enge Kopplung zwischen Stoffwechselintensität und Herz
frequenz spricht darüberhinaus die lineare Beziehung zwischen 02-
Aufnahme und Herzfrequenz bei Leistungsstufen unterhalb der
Dauerleistungsgrenze (Douglas und Haldane 1922, Berggren und
Christensen 1950, Gleeson und Baldwin 1981) sowie bei einem unter
Hypothermie verringerten Stoffwechsel (Brendel 1957). Weiterhin
erbrachte eine Gegenüberstellung der Zeitverläufe von Herzfre
quenz und der intrazellulären Konzentration an Kreatinphosphat
sowohl unterhalb als auch oberhalb der Dauerleistungsgrenze sehr
hohe Übereinstimmungen, wobei sich die beiden Größen umgekehrt
proportional verhalten (Stegemann und Kenner 1971).
1.1.2 Interstitielle freie Nervenendigungen und deren mögliche
Reizgrößen
Die im vorigen Kapitel beschriebenen Beziehungen zwischen musku
lärer Stoffwechsel lage und Herzfrequenz setzen Afferenzen voraus,