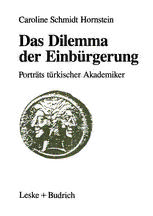Table Of ContentCaroline Schmidt Hornstein
Das Dilemma der Einbürgerung
Caroline Schmidt Hornstein
Das Dilemma der
Einbürgerung
Porträts türkischer Akademiker
Leske + Budrich, Opladen 1995
ISBN 978-3-322-95776-4 ISBN 978-3-322-95775-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95775-7
© 1995 by Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Einleitung ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Saniye Bekt~ ..................................... 16
Migrationsgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
Herauslösung aus dem Familienverband .................. 18
Die "cemaatlar" ................................... 19
Rückkehr oder Bleiben .............................. 21
Erziehung ....................................... 24
Saniye und ihre Geschwister .......................... 25
Rollenerwartungen an Saniye als Frau und Türkin .. . . . . . . . .. 29
Strategien der Selbstbestimmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33
Die Verlobung .................................... 34
Überlagerung zweier Konfliktlinien: Ehe und Auszug. . . . . . . .. 37
Als Türkin unter Deutschen .......................... 39
Der Status als "Ausländerin" .......................... 43
Der kulturalistische Blick ............................ 45
Das Spiel mit Zuordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48
Einbürgerung ................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49
Burcu Mahler 55
Biographische Daten ................................ 57
Der Weg zur Emigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58
Die Politisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63
Die Schriftstellerin ................................. 67
Zwischenbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68
5
Zugehörigkeit und Staatsangehörigkeit ................... 70
Kultur und Typisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
Interessenvertretung ................................ 75
Einbürgerung und doppelte Staatsbürgerschaft .............. 76
Aydm Gültekin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80
Die Auswanderung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82
Kinderjahre - als Türke in einer deutschen Kleinstadt ........ 83
Anpassungsnotwendigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85
Der Eintritt ins Gymnasium .......................... 89
Konfrontation mit den Eltern ......................... 92
Die Rolle der "turkish community" ..................... 96
Die Assimilierungsfalle .............................. 98
Die Spannung der Bikulturalität ............... . . . . . . .. 101
Die Einbürgerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Einbürgerung in eine Abstammungsgemeinschaft 109
Die Eingliederung von Immigranten
im internationalen Vergleich ......................... 110
Doppelte Staatsbürgerschaft .......................... 117
Das "Staatsvolk" als Abstammungsgemeinschaft . . . . . . . . . . .. 122
Anerkennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126
Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132
Literatur ........................................ 133
6
Einleitung
Mit einem bilateralen Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und der
Bundesrepublik hat die Geschichte der Einwanderung türkischer Staats
angehöriger nach Deutschland 1961 ihren Anfang genommen. Es war keine
Einwanderung im klassischen Sinne, die mit der Absicht einer dauerhaften
Niederlassung geplant wurde, sondern eine Arbeitsmigration auf Zeit. Daß
die damaligen "Gastarbeiter" ihre Rückkehr ins Herkunftsland nur in
Ausnahmen verwirklichten, ist allgemein bekannt. Diese Einwanderer der
ersten Generation haben heute bereits Kinder und Enkel. Doch auch sie
werden wie ihre Eltern als »Einwanderer" betrachtet. Im Rechtssinn sind
sie "Ausländer", faktisch aber ist ihr gesellschaftlicher Status der von
Inländern ohne deutsche Staatsangehörigkeit.
Wegen dieser paradoxen Situation ist eine Debatte über ihre Einbürge
rung in den deutschen Staatsverband und über deren Regelung und Praxis
unumgänglich geworden. Denn die erste, zweite und dritte Generation hat
ihren ständigen Lebensmittelpunkt in Deutschland. Ihr Rechtsstatus be
hauptet jedoch Gegenteiliges. Der Begriff des »Ausländers" nämlich, so
interpretiert Rittstieg in seinem einführenden Kommentar zum Deutschen
Ausländerrecht, »bezeichnet dem ursprünglichen Wortsinn nach einen
Menschen, dessen Lebensmittelpunkt sich außerhalb des Landes befindet,
und der daher nicht zu diesem Land und seiner Gesellschaft gehört"
(Rittstieg, 1992).
Wie diese »inländischen Ausländer"! sich mit ihrer rechtlich und gesell
schaftlich prekären Stellung in Deutschland auseinandersetzen, möchte ich
am Beispiel von drei Porträts zeigen. Diese Porträts sind auf der Grundlage
Die Bezeichnung geht auf Uli Bielefeld zurück, vgl. Bielefeld 1991.
7
von Interviews entstanden, die ich 1993 mit türkischen Akademikern in
der Bundesrepublik geführt habe.
Im ersten Porträt stelle ich Saniye Bekta~ vor, die in Berlin Ethnologie
studiert. Sie ist in der Bundesrepublik geboren, ihre Eltern kamen als
Arbeitsmigranten Mitte der 60er Jahre ins Land. Saniyes Lebensgeschichte
reflektiert die Perspektive einer Frau, die im Spannungsfeld zwischen
gesellschaftlichen und kulturellen Sozialisationsmustern steht.
Das zweite Gespräch fand mit der Schriftstellerin Burcu Mahler statt. Sie
gehört zwar zur ersten Generation, da sie ohne Eltern im Alter von 17
Jahren 1967 in die Bundesrepublik kam. Doch ist sie keine typische Ver
treterin dieser Generation, da schon damals eine dauerhafte Emigration aus
der Türkei ihr Anliegen war. Aufgrund ihrer besonderen Biographie kann
sie als Vermittlerin zwischen den Generationen betrachtet werden. Dies
zeigt sich vor allem auch in ihren schriftstellerischen Arbeiten.
Aydm Gültekin, mein dritter Gesprächspartner, war acht Jahre alt, als er
1965 mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Er lebt in Frankfurt und
arbeitet als praktischer Arzt. Die Geschichte seiner Assimilation eröffnet
einen Blick auf die Problematik der Anerkennung der zweiten Migranten
generation.
Die individuellen Erfahrungen und jeweiligen Geschichten innerhalb
einer Generation sind so verschieden, daß sie keineswegs als einheitlich
betrachtet werden können. Wenn ich hier dennoch von »der zweiten
Generation" spreche, dann deshalb, weil alle Gesprächspartnerinnen und
-partner sich auf einen gemeinsamen Erfahrungszusammenhang beziehen:
sie setzen sich jeweils in ihrer Biographie mit der Frage der Zugehörigkeit
zur Bundesrepublik und zur Türkei auseinander. Die Einbürgerung, die sie
entweder bereits hinter sich oder beantragt haben, war Anlaß und Aus
gangsfrage unserer Gespräche.2
2 Ich habe auch mit Personen gesprochen, die eine Einbürgerung für sich nicht in Betracht
ziehen oder grundsätzlich ablehnen. Daß ich hier nur auf solche Positionen eingehe, die
eine .positive" Entscheidung getroffen haben, liegt daran, daß mich besonders die
Überlegungen, die der Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft vorausgingen, als auch
die Erfahrungen als Immigrant mit deutscher Staatsangehörigkeit beschäftigen. Denn
gerade diese Positionen, so habe ich den Eindruck gewonnen, lassen die Abwägungen für
oder wider die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft deutlich werden.
8
Die rassistischen Gewalttaten im wiedervereinten Deutschland haben den
unsicheren Status der eingewanderten Bevölkerungsgruppen offensichtlich
gemacht. Rostock, Mölln und Solingen sind der Gipfel der Ausgrenzung
von Nicht-Deutschen. Diese Pogrome sind aus dem Bewußtsein der Immi
granten nicht mehr wegzudenken. Sie stehen im Zusammenhang mit einer
allgemeinen Neuorientierung des nationalen Selbstverständnisses in der
Bundesrepublik. Die Diskussion ist eine um Nationalstaatlichkeit: Wer ist
das Staatsvolk? Was qualifiziert den einzelnen als Teil des Ganzen? Wie ist
Nationalität definiert? Wer gehört dazu, wer nicht? Welche Kriterien
müssen erfüllt sein, um ein legitimes Mitglied der Nation zu werden?
Der deutsche Nationalstaat definiert sich über das ius sanguinis exklusiv
als ethnisch homogene Abstammungsgemeinschaft. Die Kriterien für die
Zugehörigkeit zum Staatsvolk sind ethno-kultureller Art. "Deutsche Volks
zugehörige" etwa (im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG), die eine andere
Staatsbürgerschaft besitzen, gelten im Rechtssinn nicht als "Ausländer",
sondern als »Auslandsdeutsche". Eingewanderte dagegen, die keine deut
schen Vorfahren haben, können die Bedingung der ethno-kulturellen
Zugehörigkeit nicht erfülle!l. Selbst wenn sie sich einbürgern lassen, wer
den sie in der Bevölkerung regelmäßig als »Nicht-Deutsche" wahrgenom
men.3 Die mit dem neuen Ausländergesetz am 1.1.1991 in Kraft getretenen
Einbürgerungserleichterungen für »Nicht-Volkszugehörige" sind nach wie
vor Ausnahmeregelungen für den Fall, daß »ein öffentliches Interesse an
der Einbürgerung besteht" (vgl. Rittstieg 1992). So gibt es nach der derzeit
gültigen Rechtssprechung neben den üblichen Ermessenseinbürgerungen
nur beschränkte Einbürgerungsansprüche für die zweite und dritte Ein
wanderergeneration. Dabei werden die Ermessenseinbürgerungen auf
Länderebene von den zuständigen Behörden unterschiedlich gehandhabt.
Die Einbürgerungsrichtlinien des Bundes bleiben im Grundsatz der Idee
der Abstammungsgemeinschaft verpflichtet: »Die Bundesrepublik Deutsch
land ist kein Einwanderungsland; sie strebt nicht an, die Anzahl der deut-
3 Im Gegensatz zur Bundesrepublik besteht in anderen Staaten eine Mischform zwischen
ius sanguinis und ius soli, sodaß neben der Abstammung vor allem die Geburt im Land
das entscheidende Kriterium ist, das die Staatsangehörigkeit regelt. Siehe S. 111ff.
9
schen Staatsangehörigen gezielt durch Einbürgerung zu vermehren"
(EinbürgRiLi, 2.3).4
Alle von meinen Gesprächspartnerinnen und -partnern vorgebrachten
Gründe für eine Einbürgerung zielen im Kern darauf ab, die rechtliche
Gleichstellung mit Deutschen zu erlangen. Denn diese Gleichstellung ist
für sie - entgegen der offiziellen staatlichen Version, die unter Einbürge
rung den Abschluß eines "gelungenen Integrationsprozesses" versteht - die
unabdingbare Voraussetzung, um sich gegen soziale Ausgrenzung behaup
ten zu können. Sie kritisieren eine mangelnde Integrationsbereitschaft der
Gesellschaft, deren Mitglieder meinen, mit Toleranz gegenüber "Fremden"
ihr Soll bereits erfüllt zu haben. Mit ihrem Entschluß zur Einbürgerung
wollen sie auch ein Beispiel setzen, an das sich die Hoffnung knüpft, daß
viele ihm folgen, und so die herrschende Segregation zwischen Deutschen
und Nicht-Deutschen überwunden wird.5
In erster Linie nennen die Betroffenen rechtliche Aspekte als Grund für
die Einbürgerung. Dies wirft ein Licht auf den defizitären Rechtsstatus der
hier lebenden "Ausländer" und auf die an ihn geknüpften Bestimmungen.
Im Gesetzestext wird beispielsweise von "ausländerrechtlichen Sondernor
men" gesprochen. Folgt man dieser Terminologie, hilft die Einbürgerung
vor allem, den diskriminierenden "Sonderstatus" abzulegen. Mit der Staats
bürgerschaft erhalten Eingebürgerte Rechtssicherheit: sie sind vor Aus
weisung und Abschiebung geschützt. Besitzt man als "Ausländer" bereits
eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung oder eine Aufenthaltsberechti
gung, ist zwar auch ein relativer Schutz vor Ausweisung garantiert. Meine
Gesprächspartner beschrieben jedoch ein latentes Mißtrauen gegenüber dem
Staat und seinen Zugriffsmöglichkeiten, die je nach politischen Konjunktu
ren sich schnell zum Nachteil ändern könnten. Die häufige Novellierung
des Ausländergesetzes hat dieses Mißtrauen eher verstärkt als den Betroffe
nen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Auch die Erfahrung ständiger
4 V gl. Rittstieg 1992.
5 Es gibt jedoch auch dezidierte Positionen unter hier lebenden türkischen Staatsangehöri
gen, die gerade in der Ablehnung einer Einbürgerung ihr Selbstverständnis behaupten.
Für sie bedeutete eine Einbürgerung ein Zugeständnis an die Strukturen der Ausgren
zung, die den Einbürgerungsanforderungen inhärent sind. Ihre Weigerung bezieht sich
vor allem auf die Forderung, die bisherige Staatsangehörigkeit ablegen zu müssen.
10
Behördengänge, mit denen die eigene Anwesenheit immer wieder legiti
miert werden muß, trägt dazu bei.
Als weiteren Grund für die Einbürgerung nannten meine Gesprächs
partner die Erlangung des Wahlrechts. Denn durch die Möglichkeit zu
wählen oder gewählt zu werden, können sie aus der verordneten Passivität
heraustreten und sich aktiv an der politischen Willensbildung beteiligen.
Neben dieser Möglichkeit, politische Interessen wahrzunehmen, spielen für
sie auch berufliche Perspektiven eine wichtige Rolle. Aufstiegschancen
sowie arbeitsrechtliche Aspekte sind ebenso an die Staatsangehörigkeit
geknüpft, die auch damit für den eigenen Entfaltungsspielraum entschei
dend ist. Wer beispielsweise bestimmte Berufe wie eine Beamtenstellung
oder die Niederlassung als Arzt anstrebt, kann - solange er "Ausländer" ist
- die standesrechtlichen Bedingungen nicht erfüllen. Auch in der Frage der
Reisefreizügigkeit geht es den Betroffenen um die Aufhebung bisheriger
Einschränkungen.
Diskriminierungen auf unterschiedlichsten Ebenen bestärken fortwährend
die Erfahrung, wohl als "Ausländer", nicht aber als gleichberechtigtes
Gesellschaftsmitglied anerkannt zu sein. Auch die Binnendifferenzierung
zwischen EG- und Nicht-EG-Ausländern gewinnt dabei zunehmend an
Bedeutung.
Betrachtet man die Auseinandersetzungen mit der Frage der Einbürge
rung im Kontext von Immigrantenfamilien, so ist auffällig, daß diese
wichtige Frage nur selten mit den Eltern erörtert wird. Die Kinder von
Einwanderern lösen ihren Lebensentwurf aus dem Familienzusammenhang
heraus und stellen ihn damit in Frage. Spätestens mit der Entscheidung zur
Einbürgerung realisieren die Eltern, daß ihre Kinder weiterhin in Deutsch
land leben wollen, und sind genötigt, vor diesem Hintergrund ihre Alters
perspektiven aufs Neue zu überdenken. Denn viele der Eltern hegen noch
immer Rückkehrpläne, die aber kaum umgesetzt werden. Der Gedanke an
eine Rückkehr wird oft auf die Nachkommen projiziert, und die Eltern
selbst beginnen, mit dem Eintritt in den Ruhestand zwischen Deutschland
und der Türkei hin- und herzupendeln.
In dieser widersprüchlichen Situation fragen sich Immigranten der zwei
ten Generation: Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was für einen
Platz habe ich in dieser Gesellschaft? Und was möchte ich in Deutschland
erreichen? Was sind meine Perspektiven?
11